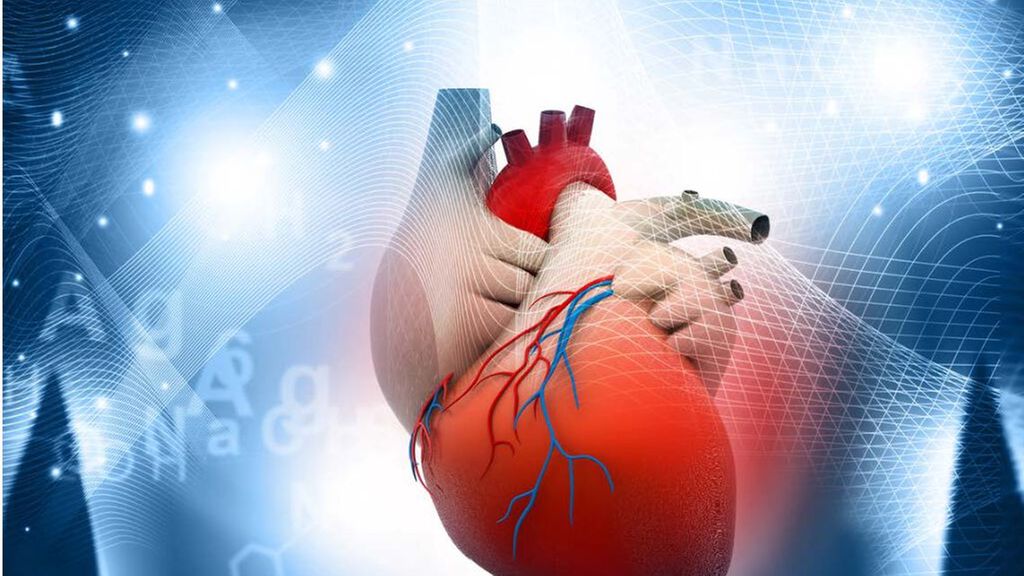
ESC-Kongress-Highlights 2020: auch im virtuellen Format mit spannenden Daten
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Der ESC-Kongress wurde, wie so viele Kongresse in diesem Jahr, nicht als Präsenzveranstaltung wie geplant in Amsterdam abgehalten, sondern fand als „Digital Experience“ online statt. Dennoch konnten wieder wissenschaftlich wichtige Daten und auch neue ESC-Guidelines vorgestellt werden – hier ein kurzer Ausschnitt.
ESC-Guidelines
ESC-Guidelines zu Vitien bei Erwachsenen
Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei erwachsenen Patienten liefert die ESC detaillierte Empfehlungen für den Umgang mit den Spätkomplikationen dieser Erkrankungen. Die Leitlinie unterstreicht, dass die Betroffenen zumindest einmal in einem spezialisierten Zentrum vorstellig werden sollen, damit Art und Frequenz der erforderlichen Kontrollen festgelegt werden können. Das Management kongenitaler Vitien erfordert dabei immer den Einsatz eines multidisziplinären Teams. In vielen Fällen kann eine genetische Beratung sinnvoll sein, was nicht nur Frauen, sondern auch Männer betrifft. Die Guideline gibt detaillierte Empfehlungen zum Management von Komplikationen kongenitaler Vitien, wie der pulmonalen Hypertonie, die sich häufig bei Patienten mit Shuntläsionen einstellt. Im Falle einer Stenose der Pulmonalklappe ist die Ballonvalvuloplastie die Intervention der Wahl, sofern es sich nicht um eine dysplastische Klappe handelt. Indikation für den Klappenersatz besteht bei symptomatischen Patienten mit schwerer Stenose, wenn eine interventionelle Behandlung nicht möglich ist. Darüber hinaus werden Faktoren gelistet, die auch in Abwesenheit von Symptomen eine Indikation für den Klappenersatz bedeuten können.
ESC-Guidelines zu Sport und Training
Die Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen empfiehlt Training für Gesunde ebenso wie für die Mehrheit der kardiologischen Patienten. Für praktisch alle Personengruppenwird Training empfohlen, wobei die Empfehlung bei 150 Minuten pro Woche mit moderater oder 75 Minuten mit hoher Intensität liegt. Wird dieses Training graduell auf 300 Minuten mit moderater Intensität oder 150 Minuten mit hoher Intensität gesteigert, so ist mit zusätzlichem Benefit zu rechnen. Abgeklärt sollten Personen mit hohem oder sehr hohem kardiovaskulärem Risiko werden, die intensives Training beginnen möchten. Dabei sollte auch die maximale Belastbarkeit erhoben werden. Auch Patienten mit koronarer Herzkrankheit sollen trainieren, wobei sich die Empfehlungen der ESC an verschiedenen Risikofaktoren orientieren. Jedenfalls sollte bei Patienten mit chronischer, stabiler KHK vor Beginn jeglichen Trainings eine Risikoevaluation vorgenommen werden. Ähnliches gilt für Patienten mit Herzinsuffizienz. Diese sollten jede Art von Training nur beginnen, wenn sie sich in einem klinisch stabilen Zustand befinden und sorgfältig abgeklärt wurden. In diesem Fall soll ein individualisierter Trainingsplan erstellt werden.
Ich verweise hier auf die Tagung Sportkardiologie (Info zu Anmeldung und Termin Seite 30), über die wir in Kooperation mit Prof. Josef Niebauer berichten werden.
ESC-Guidelines zum Vorhofflimmern
Mit der Präsentation der neuen Leitlinie zu Diagnose und Management von Vorhofflimmern haben ESC und EACTS (European Association for Cardio-Thoracic Surgery) einen Paradigmenwechsel hin zu einem patientenzentrierten Ansatz vollzogen. Die beiden Gesellschaften empfehlen beim Vorgehen die sogenannte „ABC-Strategie“.
Was die Guideline für die Praxis und den klinischen Alltag bedeutet, werdenProf. Scherr und sein Team in einer der nächsten Ausgaben ausführlich darstellen.
ESC-Guideline zum NSTEMI
Die aktualisierte ESC-Leitlinie zum Management des akuten Koronarsyndroms(ACS) ohne ST-Streckenhebung enthält Änderungen, die vor allem Abläufe straffen und einfacher und schneller machen sollen, mit dem Ziel, Patienten möglichst rasch einer PCI zuzuführen. Neu ist dabei Prasugrel als First-Line-Therapie bei PCI. Das diagnostische Workup bei Patienten mit Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom sollte auf vier Säulen basieren – nämlich klinischer Untersuchung, EKG, kardialem Troponin bei Präsentation sowie Veränderung des kardialen Troponins. Als neue Empfehlung gibt die ESC dabei dem 2-Stunden-Algorithmus gegenüber dem 1-Stunden-Algorithmus den Vorzug. Ein Upgrade hat auch die kardiale Bildgebung (CT-Angiografie) erfahren, die statt einer invasiven Angiografie zum Ausschluss eines ACS eingesetzt werden kann, wenn die Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzkrankheit moderat oder gering ist und EKG oder Troponin negativ oder inkonklusiv sind.
Das Team um Prof. Dr. Christian Müller vom Universitätsspital Basel war maßgeblich an der Entwicklung des 2-Stunden-Algorithmus beteiligt und wird in der nächsten Ausgabe darüber berichten.
Akutes Koronarsyndrom
Schneller Troponintest aus dem Speichel?
Israelische Forscher präsentierten eine Pilotstudie zum Nachweis von kardialem Troponin aus dem Speichel. Die Ergebnisse sind vielversprechend, viele Fragen bleiben allerdings derzeit noch offen und sind zu klären, bevor ein solcher Test verfügbar sein kann. Ziel ist ein simpler und genauer Test mit einem Ergebnis in 10 Minuten.
Herzinsuffizienz
Mortalitätsreduktion durch Impfungen
Passend zum bevorstehenden Winter mit Influenza und Covid-19 präsentieren Forscher aus den USA Daten, die die Wichtigkeit von Impfungen gegen respiratorische Infekte aus kardiologischer Sicht untermauern. Die Registerdaten zeigen eine Halbierung der Mortalitätszahlen von geimpften gegenüber nicht gegen Grippe und Pneumokokken geimpften Herzinsuffizienzpatienten im Rahmen einer Hospitalisierung.
ARIADNE-Register-Daten zu Sacubitril/Valsartan: Früher ist besser
Ebenfalls aus dem Real-World-Setting stammen die Resultate des prospektiven ARIADNE-Registers, bei dem der Real-World-Einsatz des ARNI Sacubitril/Valsartan mit einer konventionellen Herzinsuffizienztherapie verglichen wurde. Im Video-Interview in unserem ESC-Newsroom mit Prim. Priv.-Doz. Dr. Johann Altenberger erklärt dieser den Aufbau und die Resultate von ARIADNE. Seine Schlussfolgerungen: Sacubitril/Valsartan bringt Vorteile für die Patienten und sollte daher früher von den behandelnden Ärzten eingesetzt werden. Das Video-Interview finden Sie im Newsroom.
Kognitive Sicherheit
Es gab theoretische Bedenken, dass die Inhibition von Neprilysin mit Sacubitril/Valsartan das Risiko kognitiver Nebenwirkungen birgt, zumal der Neprilysin-Pathway eine Rolle in der Clearance von Amyloid-beta-Peptiden aus dem Gehirngewebe spielt. Eine präspezifizierte Analyse der Phase-III-Studie PARAGON-HF zeigt, dass Sacubitril/Valsartan im Hinblick auf die kognitive Entwicklung der Patienten neutral ist.Eine Post-hoc-Analyse von PARAGON weist jedoch auf einen Zusammenhang zwischen reduzierter Kognition und ungünstigem Outcome bei Patienten mit HFpEF hin. Die Auswertung zeigte, dass über eine mediane Beobachtungszeit von 35 Monaten sowohl der kombinierte primäre Endpunkt als auch seine Komponenten und die Gesamtmortalität mit abnehmender kognitiver Funktion zunahmen. Bereits eine leichte kognitive Einschränkung war ein Prädiktor eines ungünstigen Outcomes.
PARALLAX: Sacubitril/Valsartan bei HFpEF
Die Studie PARALLAX erreichte leider nur einen ihrer beiden koprimärenEndpunkte. Sacubitril/Valsartan reduziert bei Patienten mit Herzinsuffizienz und erhaltener linksventrikulärer Auswurffraktion zwar das NT-proBNP, verbesserte aber nicht die 6-Minuten-Gehstrecke. Auch wenn das Ergebnis enttäuschte, wurden interessante Erkenntnisse zu Hospitalisierungen und Veränderungen der Nierenfunktion gewonnen, denn es zeigte sich, dass Ereignisse im Zusammenhang mit Herzinsuffizienz (Hospitalisierungen, Verschlechterung der Herzinsuffizienz etc.) bei Patienten unter konventioneller Therapie häufiger auftraten. In der Folge wurde eine Post-hoc-Analyse durchgeführt, die in der Sacubitril/Valsartan-Gruppe ein um 50% signifikant reduziertes Risiko von Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz zeigte. Zudem kam es in der Sacubitril/Valsartan-Gruppe über 24 Wochen zu einersignifikant geringeren Abnahme der Nierenfunktion.
Neues zu SGLT2-Inhibitoren
DAPA-CKD: Dapagliflozin reduziert renale Endpunkte und Gesamtsterblichkeit
Weitere spannende Ergebnisse zur Nierenfunktion wurden auch für den SGLT2-Inhibitor Dapagliflozin präsentiert. In die Studie DAPA-CKD waren mehr als 4000 Patienten eingeschlossen, die eine eGFR zwischen 25 und 75ml/min/1,73m2 sowie ein Albumin-Kreatinin-Verhältnis (Urine Albumin-to-Creatinine Ratio – UACR) zwischen 200 und 5000mg/g aufwiesen und, sofern keine Kontraindikationen bestanden, bereits einen ACE-Hemmer oder einen Angiotensinrezeptorblocker (ARB) in maximal verträglicher Dosierung als Hintergrundtherapie einnahmen. Primärer Endpunkt war ein Kompositum aus Verschlechterung der Nierenfunktion (anhaltende Abnahme der eGFR um mehr als 50% oder terminale Niereninsuffizienz) sowie Tod aus renaler oder kardiovaskulärer Ursache. Die Patienten erhielten zusätzlich zu ihrer Hintergrundtherapie10mg Dapagliflozin oder Placebo.
Über ein medianes Follow-up von 2,4 Jahren trat der primäre Endpunkt bei 197 Patienten der Dapagliflozin- und 312 Patienten der Placebogruppe auf, was einer signifikanten Risikoreduktion von 39% entspricht. Daraus ergibt sich eine Number Needed to Treat (NNT) von 19. Eine Analyse der einzelnen Komponenten des primären Endpunkts zeigte fast durchgehend deutliche und signifikante Risikoreduktionen. Dapagliflozin reduzierte im Vergleich zu Placebo auch alle drei untersuchten sekundären Endpunkte: Kompositum aus Verschlechterung der Nierenfunktion und Tod durch Nierenversagen (–46%), Kompositum aus Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz und kardiovaskulärem Tod (–29%) sowie die Gesamtmortalität(–31%). Subgruppenanalysen zeigten, dass alle untersuchten Endpunkte unabhängig vom Diabetesstatus der Patienten erreicht wurden.
EMPEROR-Reduced erreicht primären und sekundäre Endpunkte
Spannendes wurde auch zu Empagliflozin präsentiert. In EMPEROR-Reduced wurde Empagliflozin bei Patienten mit HFrEF unabhängig von deren Diabetesstatus in der Therapie der Herzinsuffizienz hinsichtlich der drei Endpunkte Kompositum aus kardiovaskulärer Mortalität und Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz (primärer Endpunkt), Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz (erster sekundärer Endpunkt) und Stärke der Abnahme der glomerulären Filtrationsrate (zweiter sekundärer Endpunkt) untersucht.
Im primären Endpunkt wurde eine Reduktion um 25% erreicht, Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz wurden um 30% reduziert und auch der zweite sekundäre Endpunkt, nämlich die Abflachung des Verlustes an eGFR, wurde erreicht. Unerwünschte renale Ereignisse traten in der Empagliflozin-Gruppe signifikant seltener als in der Placebogruppe auf. Damit ist Empagliflozin nach Dapagliflozin der zweite SGLT2-Inhibitor, für den eine Risikoreduktion bei HFrEF unabhängig von einer etablierten Diabeteserkrankung demonstriert wurde. Darüber hinaus zeigte sich, dass es auch in der Subgruppe, die einen ARNI erhielt, zu einer signifikanten Verbesserung durch Empagliflozin kam.
Zwei weitere präsentierte Studien wiesen auf die vielfältigen günstigen Effekte des SGLT2-Inhibitors Empagliflozin hin, der unter anderem bei Patienten nach Myokardinfarkt entwässernd wirken dürfte und mehrere Marker von für den Zustand der Gefäße relevanten Parametern vorteilhaft beeinflusst.
Antikoagulation
Antikoagulanzien im Vergleich
Zahlreiche Daten wurden zum NOAK Apixaban präsentiert. So wurden in der Kohortenstudie NAXOS sowohl Vitamin-K-Antagonisten(VKA) als auch die NOAK Rivaroxaban und Dabigatran verglichen. Die Daten zu den mehr als 300000 Patienten wurden über die Datenbank der nationalen Gesundheitsversicherung, die Hospitalisierungsdatenbank sowie Standesamtdaten gewonnen. Schwere Blutungen wurden anhand der Einlieferungsdiagnosen der Krankenhäuser identifiziert und die Lokalisation der Blutung wurde erhoben. Als Referenz wurden Patienten herangezogen, die mit dem NOAK Apixaban behandelt wurden. Die Analysen nach Adjustierung ergaben unter Apixaban das geringste Risiko hinsichtlich aller untersuchten Blutungsereignisse mit signifikant geringerenEreigniswahrscheinlichkeiten im Vergleich zu VKA, Rivaroxaban und Dabigatran. Hinsichtlich intrakranieller Blutungen zeigte sich Dabigatran überlegen.
AUGUSTUS: Vorhofflimmern und PCI
Neue Auswertungen der Phase-IV-Studie AUGUSTUS untermauern die Überlegenheit des NOAK Apixaban im Vergleich zu einem VKA bei Patienten mit Vorhofflimmern, die sich einer perkutanen Koronarintervention unterziehen müssen. Eine Analyse von Storey R et al. untersuchte Unterschiede zwischen den verschiedenen in AUGUSTUS eingesetzten P2Y12-Inhibitoren und Einflüsse auf die Studienergebnisse. Sie zeigte, dass Apixaban im Kontext von AUGUSTUS unabhängig vom eingesetzten P2Y12-Inhibitor sicherer war als der VKA. Die Mehrheit der Patienten hatte Clopidogrel (n=4165), gefolgt von Ticagrelor (n=280) und Prasugrel (n=51) erhalten. Die duale Therapie erwies sich im Vergleich zur Dreifachtherapie als überlegen im Hinblick auf die Sicherheit, hinsichtlich einiger Outcomes jedoch als zumindest numerisch unterlegen. So zeigte die Kombination von Antikoagulation mit Ticagrelor und Aspirin das niedrigste Risiko von Stentthrombosen, aber das höchste Risiko schwerer Blutungen. Dies unterstützt die Empfehlungen, die NOAK gegenüber VKA den Vorzug geben und dazu raten, Aspirin nach einer PCI abhängig vom individuellen Risikoprofil des Patienten abzusetzen.
Thromboserezidive bei Krebspatienten
Analysen amerikanischer Versicherungsdatenbanken zeigen, dass Patienten mit onkologischen Erkrankungen unter Apixaban im Vergleich sowohl zu niedermolekularem Heparin als auch zu Warfarin ein niedrigeres Risiko rezidivierender Thrombosen haben. Insgesamt wurden 3393 Apixaban-, 6108 LMWH- und 4585 Warfarin-Patienten identifiziert. Das mittlere Follow-up lag in allen Kohorten zwischen 105 und 166 Tagen. In der Gesamtpopulation der Studie zeigte sich für Patienten, die mit Apixaban behandelt wurden, im Vergleich zu jenen, die niedermolekulares Heparin erhielten, ein geringeres Risiko sowohl hinsichtlich erneuter thromboembolischer Ereignisse als auch schwerer Blutungen. Im Vergleich zu Warfarin war für die Apixaban-Kohorte das VTE-Risiko niedriger und das Risiko schwerer Blutungen vergleichbar. Die Warfarin- und LMWH-Kohorten unterschieden sich weder im Hinblick auf das VTE-noch auf das Blutungsrisiko signifikant. Subgruppenanalysen, stratifiziert nach Metastasierung, onkologischer Therapie, Chemotherapie, Art der VTE und gastrointestinalen Tumoren zeigten, dass dieses Ergebnis auch innerhalb dieser Subgruppen mit unterschiedlichen Risiken weitgehend konsistent war.
LDL-Cholesterinsenkung
Inclisiran bei Statinintoleranz wirksam
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase-III-Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel von Patienten mit hohem kardiovaskuläremRisiko, die kein Statin einnehmen können, um fast 50% senkt. Dabei lagen die Nebenwirkungen auf Placeboniveau.
Die Resultate basieren auf Daten einer Subgruppenanalyse der Studien ORION 10 und 11. In die Studien wurden Patienten mit bestehender koronarer Herzkrankheit eingeschlossen, die unter maximal verträglicher Statindosis einen LDL-C-Spiegel von mehr als 70mg/dl aufwiesen und mit 300mg Inclisiran oder Placebo behandelt wurden. Für die Analyse wurden 252 Patienten (7,9% der gepoolten Studienpopulation) aus den beiden Studien ausgewertet, die wegen Statinintoleranz oder wegen Kontraindikationen keine Statine einnehmen konnten.
Die Placebo-adjustierte mittlere Reduktion des LDL-C am Tag 510 betrug 45,8%, was einer absoluten Reduktion um 68,0mg/dl (p<0,0001) entsprach. Damit konnte im Vergleich zu jenen Patienten aus ORION 10 und 11, die Statine einnahmen, eine noch etwas deutlichere absolute Reduktion erreicht werden. Die Verträglichkeit war gut. Insgesamt entwickelten 12 Patienten (4,7%) Myalgien, wobei 4,8% in der Inclisiran- und 4,7% in der Placebogruppe betroffen waren. Acht Patienten aus der Inclisiran- und drei Patienten aus der Placebogruppe brachen die Studie ab. Häufigste Nebenwirkung waren Reaktionen an der Einstichstelle, die mit Inclisiran häufiger auftraten, dabei allerdings meist leicht und transient waren.
ESC-Newsroom und Wiener Kongress Kardiologie
Ausführlichere Informationen und Daten zu den hier kurz besprochenen Studien und Themen sowie zusätzliche Artikel finden Sie in unserem ESC-Newsroom.
Wie bereits erwähnt, haben sich wieder einige Vortragende bereit erklärt, im Detail über ihre Arbeiten in den nächsten Ausgaben zu berichten.
Darüber hinaus werden diese und zahlreiche weitere aktuelle Daten und Themen vom ESC-Kongress in den Kontext für Klinik und niedergelassene Praxis auf dem Wiener Kongress Kardiologie eingeordnet, der vom 22. bis 24. Oktober in der Hofburg in Wien mit einem ausgearbeiteten Covid-Sicherheits-Konzept stattfindet.

Abb. 1: Spannendes in Bezug auf die Nierenprotektion von Herzinsuffizienzpatienten präsentiert
Bericht:
Reno Barth
Christian Fexa
Quelle:
ESC Congress 2020 – The Digital Experience, 29.8.–1.9.2020
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
Labormedizinische Fallstricke bei kardialen Markern
Bei Schädigung oder Stress des Herzmuskels werden kardiale Marker in den Blutkreislauf freigesetzt. Ihre labormedizinische Bestimmung spielt eine Schlüsselrolle in der Diagnostik, ...


