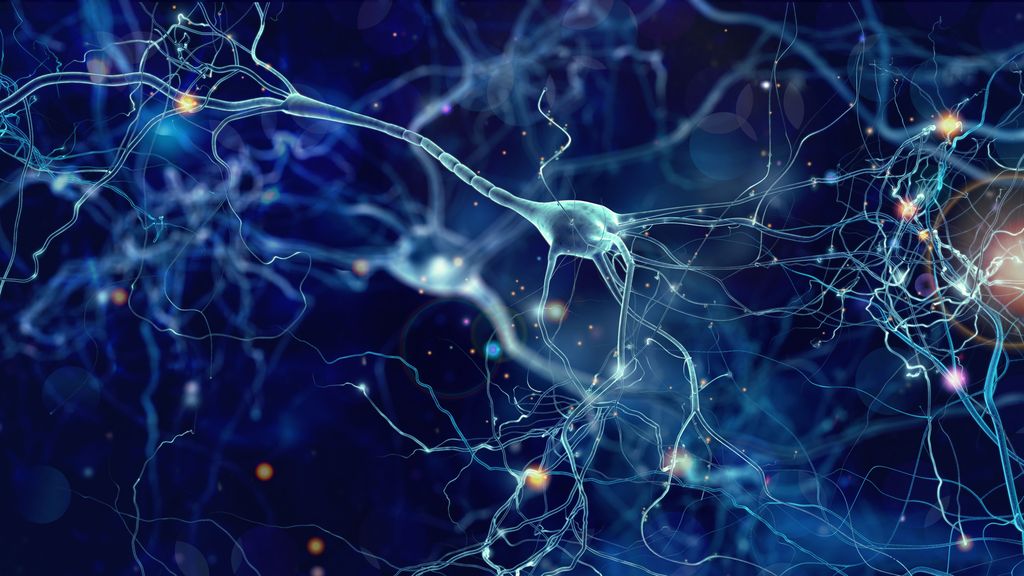
©
Getty Images/iStockphoto
Wenn die Beine nicht zur Ruhe kommen
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
01.11.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Beine zucken, wenn man sitzt oder liegt, man spürt ständig einen Bewegungsdrang, hat Missempfindungen in den Beinen und kann nicht mehr schlafen – ein Restless-Legs-Syndrom (RLS) kann die Lebensqualität enorm einschränken. Lässt sich keine Ursache finden und behandeln, steht die symptomatische Therapie im Vordergrund. Während der langfristigen Behandlung muss man insbesondere die medikamentös induzierte paradoxe Verschlechterung des RLS (Augmentation) unter dopaminerger Therapie im Blick haben. Prof. Dr. med. Johannes Mathis vom Inselspital in Bern erklärt, wie man bei der Pharmakotherapie vorgeht und welche Rolle der Schweregrad bei der Stellung der Therapieindikation spielt.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><strong>Herr Professor Mathis, in der aktuellen dritten Version der Internationalen Klassifikation der Schlafstörungen (ISC-3) wird im Vergleich zur vorherigen der Schweregrad erwähnt. Warum ist das wichtig?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Zunächst einmal: Die Diagnose basiert auf obligatorischen und fakultativen Kriterien (siehe Textkasten). Aber nicht jeder Patient, der diese Kriterien erfüllt, braucht eine Behandlung. Ein Krankheitswert wird dann angenommen, wenn der Patient an mindestens zwei bis drei Tagen pro Woche Beschwerden hat und diese ihn in seiner Lebensqualität beeinträchtigen. Der Schwergrad bestimmt also, ob man behandeln muss.</p> <p><strong>Wie findet man das heraus?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Am einfachsten ist, denPatienten zu fragen: «Denken Sie, dass Sie mit diesen Beschwerden leben können oder beeinflusst es Ihren Alltag so, dass wir eine Therapie erwägen sollten?» Für das Gespräch muss man sich viel Zeit nehmen. Die Medikamente können nämlich nicht unerhebliche Nebenwirkungen verursachen, und einige können die Symptome langfristig verschlimmern, was wir Augmentation nennen. Dem Patienten muss man diese Aspekte möglichst genau erklären. Wir haben 2003 eine Umfrage in Schweizer Apotheken gemacht und nur drei von zehn Patienten, die alle essenziel- len diagnostischen RLS-Kriterien erfüllten, hätten sich auch behandeln lassen wollen. Leider therapieren einige Kollegen ein RLS auch dann, wenn es (noch) gar nicht notwendig wäre, ohne sich über die potenziellen Nebenwirkungen im Klaren zu sein.</p> <p><strong>Wie würden Sie ein behandlungsbedürftiges RLS charakterisieren?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Der Patient spürt praktisch jeden Tag gegen Abend oder nachts, wenn er sitzt oder liegt, sehr unangenehme Sensationen in den Beinen oder seine Beine zucken. Der Betroffene muss ständig aufstehen, zum Beispiel alle paar Minuten beim Nachtessen. Das stört nicht nur ihn, sondern die ganze Familie wird verrückt. Verwandte und Freunde ziehen sich zurück, die Patienten sind einsam und viele leiden unter Schlafstörungen.</p> <p><strong>Wie starten Sie die Therapie?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Wichtig ist, zunächst sekundäre Ursachen für ein RLS – was neuerdings «co-morbides RLS» genannt wird – abzuklären und gegebenenfalls zu behandeln. Am häufigsten sind dies ein Eisenmangel, eine Polyneuropathie oder auch bestimmte Medikamente.</p> <p><strong>Ab welchem Eisenwert sollte man substituieren?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Eine Eisensubstitution wird bei einem Ferritin <50μg/l empfohlen, manche raten sogar schon bei <75μg/l oder <100μg/l dazu. Weil der Eisengehalt im Gehirn von RLS-Betroffenen schon bei normalen Serum-Eisenwerten geringer ist als bei Gesunden, ist es sehr schwierig zu wissen, welcher Grenzwert der richtige ist. Am meisten scheint die Eisensubstitution zu helfen, wenn der Eisenmangel akut auftrat. Eisen bessert nicht nur die Symptome, sondern die Dopamin-Agonisten scheinen auch besser zu wirken, und das Risiko für eine Augmentation scheint geringer zu sein. Man kann eine orale Eisentherapie probieren, aber gerade ältere Menschen nehmen das Eisen oft nicht so gut über den Darm auf, und sie profitieren mehr von Infusionen.</p> <p><strong>Wie behandeln Sie ein RLS durch Polyneuropathie?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Je nach Ursache, also zum Beispiel Vitamin B<sub>12</sub> substituieren, den Blutzucker gut einstellen oder eine Schilddrüsenunterfunktion behandeln. Bei jedem Zweiten finden wir allerdings keine Ursache für die Polyneuropathie – das ist ziemlich frustrierend und dann bleibt einem nur übrig, die Symptome zu behandeln.</p> <p><strong>Neuroleptika können ein RLS auslösen, auch Betablocker, Antidepressiva oder Kalzium-Antagonisten. Verschwindet das RLS, wenn man die Präparate absetzt?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Nicht immer vollständig, weil ein RLS immer zu einem Teil genetisch bedingt ist. Aber man kann erwarten, dass es wesentlich besser wird.</p> <p><strong>Zur symptomatischen Therapie stehen mehrere Wirkstoffgruppen zur Verfügung: dopaminerge Substanzen, Hypnotika, Antiepileptika, Antidepressiva und Opioide. Wie wählen Sie das Passende aus?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Das entscheide ich anhand des Schweregrades, der Komorbiditäten und der zu erwartenden Nebenwirkungen. Hat der Patient nur ein- bis zweimal pro Woche Beschwerden, verschreibe ich L-Dopa, nur in Reserve und maximal 2x 250mg pro Woche. L-Dopa sollte man aber auf keinen Fall als Dauertherapie einsetzen, weil das bei 80 Prozent der Patienten zu einer Augmentation führt. Dopamin-Agonisten eignen sich gut, wenn der Patient gleichzeitig unter Depressionen leidet, da diese Präparate auch leicht antidepressiv wirken. Leidet ein Patient aber unter kompulsivem Verhalten – also etwa übermässig viel Geld ausgeben, essen oder Sex haben –, rate ich von einem Dopamin-Agonisten ab, denn dieser kann als Nebenwirkung ein derartiges Verhalten auslösen oder verstärken.<br /> Die Alpha-Delta-Liganden Gabapentin oder Pregabalin kommen hauptsächlich infrage bei schmerzhafter Form des RLS, wenn der Patient zusätzlich eine Polyneuropathie hat. Weil Pregabalin auch angstlösend wirkt, eignet sich das Medikament bei zusätzlicher Angststörung. Genauso wie die Dopamin-Agonisten sollte man die Antiepileptika langsam aufdosieren, dann verträgt der Patient sie besser. Älteren Patienten gebe ich diese Substanzen aber nicht so gerne, weil diese das Risiko für Stürze erhöhen und die Gefahr einer Gewichtszunahme sollte beachtet werden. Codein-Präparate werden heute nur noch als zweite oder dritte Wahl verwendet. Als Reservemedikament oder in Kombination mit Dopamin-Präparaten kann es aber auch heute noch gute Dienste leisten. In sehr schweren Fällen kann eine Behandlung mit Opiaten inklusive Methadon erwogen werden, insbesondere bei schmerzhaften Formen des RLS.</p> <p><strong>Wie starten Sie die Therapie bei einem RLS?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Mit der kleinsten verfügbaren Dosis, welche bis zu der kleinsten nötigen Dosis aufdosiert wird. Gibt man hohe Dosen zu rasch, kann dies Übelkeit auslösen. Oft sprechen die Patienten zu Beginn relativ rasch auf die Behandlung an, aber leider kann eine Gewöhnung auftreten und der Effekt lässt wieder nach. In diesen Fällen braucht man viel Geduld und der Patient Vertrauen zum Arzt, bis man ein neues, wirksameres Mittel oder eventuell eine Medikamentenkombination gefunden hat. Das Risiko einer Augmentation ist besonders bei kurzwirksamen Dopamin-Präparaten erhöht.</p> <p><strong>Wie äussern sich die Augmentationen?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Die RLS-Symptome treten wieder auf oder verschlechtern sich rasch innert Wochen – es ist eine paradoxe Nebenwirkung aller dopaminerger Präparate. Bestand das Unruhegefühl in den Beinen früher erst am Abend im Bett, treten die Symptome wegen der Augmentation schon beim Nachtessen auf und im weiteren Verlauf schon beim Mittagessen. Zusätzlich breiten sich die Symptome von den Unterschenkeln nach proximal aus oder sogar bis in die Arme. Oft ändert sich auch der Charakter: Die Beschwerden sind jetzt schmerzhafter oder es treten mehr unwillkürliche Zuckungen auf.</p> <p><strong>Wie behandeln Sie die Augmentation?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Es ist oft schwierig, die Augmentation in den Griff zu bekommen. Entweder wird man es mit einem Dopamin- Agonisten mit längerer Wirkungsdauer wie dem Rotigotin-Pflaster versuchen oder mit Pregabalin. Meist muss man aber vorübergehend und überlappend ein Opiat dazugeben, um die Beschwerden erträglich zu gestalten. Wenn die Augmentation behoben ist, kann man das Opiat später eventuell wieder ausschleichen.</p> <p><strong>Warum muss man überlappend ein Opiat geben?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Ein Patient mit einer schweren Augmentation hat oft so starke Beschwerden, dass er oft kurz vor dem Selbstmord steht – solche Patienten benötigen dringend etwas, was unmittelbar hilft, wozu sich Opiate am besten eignen. Langfristig sollten Opiate aber wegen der Nebenwirkungen nur als letzte Option zur Basisbehandlung eingesetzt werden.</p> <p><strong>Was machen Sie bei einer Schwangeren mit RLS?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Das ist eine Herausforderung. Wir haben für alle üblicherweise eingesetzten Präparate nicht genügend Daten zur Sicherheit für das Ungeborene. Deshalb kann hier neben einer guten Schlafhygiene die orale Substitution eines Eisenmangels, allenfalls Magnesium versucht werden. Wirkt das nicht, kann man ein Benzodiazepin oder ein dopaminerges Präparat überlegen. Bei rund jeder dritten Schwangeren persistiert das RLS oder es tritt bei einer nächsten Schwangerschaft wieder auf. Es schadet sicherlich nichts, die Eisenreserven vor einer Schwangerschaft gut aufzufüllen.</p> <p><strong>Gibt es keine Therapien, die auf die Psyche wirken?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Leider steckt die Verhaltenstherapie noch in den Kinderschuhen – hier gibt es nur Einzelberichte. Entspannungstherapien scheinen nichts zu helfen und machen den Patienten noch nervöser. Eine Achtsamkeitstherapie empfinden viele Patienten als angenehm, auch Stretching am Abend kann wirken. Vielleicht könnte man lernen, mit dem Problem besser umzugehen – ähnlich wie bei chronischen Schmerzen.</p> <p><strong>Ist ein RLS heilbar?</strong><br /> <strong>J. Mathis:</strong> Zumindest das idiopathische RLS bleibt meist lebenslang bestehen. Trotzdem treten immer wieder Phasen einer vorübergehenden Remission ein, weshalb man bei fehlenden Beschwerden auch versuchen soll, die Medikamente zu reduzieren. Umgekehrt können schwere Verläufe mit Therapieresistenz auftreten, weshalb neben einer guten Zusammenarbeit von Hausarzt und Facharzt für die beste Therapie den Betroffenen auch die Unterstützung in Selbsthilfegruppen helfen kann – etwa www.restless-legs.ch.</p> <p><strong><em>Vielen Dank für das Gespräch!</em></strong></p> <h2>Diagnosekriterien des Restless-Legs-Syndroms (www.restless-legs.ch)</h2> <p>Obligatorische Symptome</p> <ul> <li>Bewegungsdrang der Extremitäten, oft assoziiert mit unangenehmen Gefühlsstörungen</li> <li>Bewegungsunruhe</li> <li>Verschlimmerung der Beschwerden in Ruhe und zumindest vorübergehende Besserung bei Bewegung</li> <li>Verschlechterung der Beschwerden am Abend und in der Nacht</li> <li>Die Beschwerden müssen ein erhebliches Ausmass mit Einschränkungen der Lebensqualität erreichen und können nicht durch eine andere Ursache erklärt werden.</li> </ul> <p>Fakultative Symptome</p> <ul> <li>Schlafstörungen und Tagesschläfrigkeit</li> <li>Periodische Bewegungen der Beine und Arme im Schlaf</li> <li>Unwillkürliche Bewegungen der Beine und Arme im Wachzustand und in Ruhe</li> <li>Normale Befunde bei der ärztlichen Untersuchung bei RLS-Formen ohne bekannte Ursachen (= idiopathische Form)</li> <li>Tendenz zu einer Verschlechterung im mittleren und höheren Lebensalter</li> <li>Positive Familienanamnese, entsprechend einer autosomal-dominanten Vererbung</li> </ul></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Menschen mit Demenz: Was beeinflusst deren Überleben nach Diagnosestellung?
Verschiedenste Faktoren beeinflussen die Überlebenszeit nach einer Demenzdiagnose. Das Wissen um Risikofaktoren zum Zeitpunkt der Diagnose einer Demenzerkrankung oder in deren Verlauf ...
Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?
Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...
Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung
Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...


