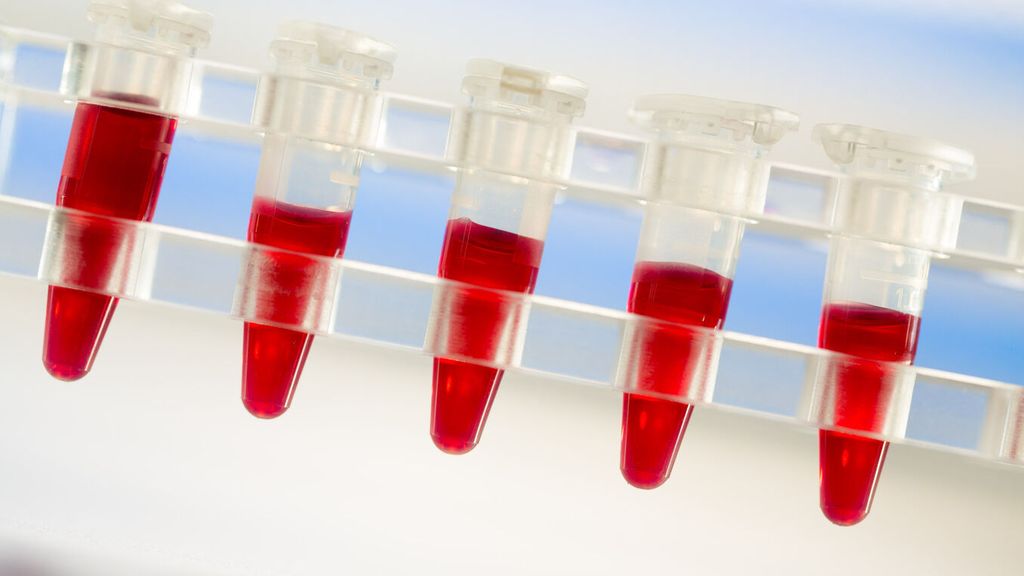„Selfies aus dem Krankenhaus“
Unsere Gesprächspartnerin:
Mag. Jutta Steinschaden
Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin
Projekt „ Mama/Papa hat Krebs “
Österreichische Krebshilfe Wien
E-Mail: steinschaden@krebshilfe-wien.at
Das Interview führte
Ingeborg Morawetz, MA
Im onkologischen Umfeld liegt der Fokus auf den Patient:innen. Dass bei erwachsenen Betroffenen oftmals auch Kinder die Auswirkungen einer Krebserkrankung zu spüren bekommen, rückt in den Hintergrund. Die Psychologin Mag. Jutta Steinschaden erklärt im Interview, wie Eltern Kinder in solchen Familiensituationen schützen und was Ärzt:innen erfolgreich dazu beitragen können.
Was verändert sich bei einer Krebsdiagnose, wenn die Betroffenen Kinder haben?
Jutta Steinschaden: Es verändert sich alles. Zu dem Sturz aus der Wirklichkeit, der mit einer solchen Diagnose einhergeht, kommt bei Eltern noch die Angst hinzu, dass sie nicht erleben werden, wie ihr Kind aufwächst.
Gerade bei Mamas passiert es außerdem sehr häufig, dass sie irrsinnige Schuldgefühle haben, dass sie die Kinder nicht mehr oder weniger gut als zuvor versorgen können. Während der Krebstherapie, also während der Zeit, in der eine Familie in jedem Fall belastet ist, haben Eltern auch Sorge, ihren Kindern mit den Veränderungen zu schaden, vor allem durch Verzichtserfahrungen oder Fremdbetreuung.
Objektiv gesehen sind die organisatorischen Aspekte für krebsbetroffene Eltern schwierig: Wer bringt die Kinder in den Kindergarten, kocht ihnen Essen und hält die Wohnung sauber? Bei längerfristigen Krebserkrankungen kommen auch finanzielle Sorgen auf.
Mein Tipp ist immer: Holt euch Hilfe – revanchieren könnt ihr euch später. Hilfe soll keine zusätzliche Belastung sein. In der akuten Situation muss man sich nicht mit den Helfenden auf eine Tasse Kaffee hinsetzen oder ihnen Blumen kaufen. Wenn die Krankheit überstanden ist, kann man zum Beispiel für alle, die geholfen haben, ein Sommerfest veranstalten.
Gibt es in Österreich besondere Unterstützung für Alleinerziehende mit Krebs?
J. Steinschaden: Es gibt zwar keine Hilfe spezifisch für Alleinerziehende, die an Krebs erkrankt sind, aber es gibt viele Hilfsangebote, die auch Alleinerziehende in Anspruch nehmen können. Die stammen meist von privat finanzierten Vereinen, die sich kurzfristig um Kinder kümmern, wenn Mama oder Papa plötzlich ins Krankenhaus muss. Auch die Caritas hat eine Familienhilfe. In Österreich wird aber die Kinderbetreuung in den Zeiten einer Krebserkrankung meist von Familienmitgliedern übernommen.
Wie können Eltern mit ihren Kindern über eine Krebsdiagnose sprechen?
J. Steinschaden: Ganz wichtig ist es, mit Kindern offen zu reden und ihnen zeitnahe zu sagen, dass die Krankheit des Elternteils eine Krebserkrankung ist und was und wie behandelt wird. Denn: Information schützt. Meistens gibt es eine Vorgeschichte, auf die sich Eltern beim ersten Gespräch beziehen können. Dem erkrankten Elternteil ist es vielleicht vorher schon nicht so gut gegangen, es war öfter bei Untersuchungen oder hatte konkrete Beschwerden.
Ein möglicher Gesprächsanfang ist: „Wir wollen heute darüber sprechen, was für eine Erkrankung bei Mama/Papa entdeckt wurde. Die Erkrankung heißt Krebs.“ Je nach Alter des Kindes kann man hinzufügen: „Das bedeutet, dass im Körper/bei einem Organ etwas gewachsen ist, was da nicht sein soll.“
Das Wort Krebs muss ausgesprochen werden – jede Krankheit hat einen Namen, und diese heißt eben Krebs. Wird das Wort Krebs zu Hause nicht verwendet, schnappen es die Kinder irgendwo anders auf. Das führt zu noch viel schlimmeren Fantasien, als wenn sie von vornherein Bescheid wissen.
Danach sollten Erklärungen dazu folgen, was für eine Behandlung geplant ist. Für Kinder ist es auch wichtig zu hören, dass die Ärzt:innen darauf achten, dass ihr Elternteil keine Schmerzen hat.
Gerade bei jüngeren Kindern muss man dazusagen, dass die Krankheit Krebs nichts mit dem Tier Krebs zu tun hat. Sonst denken Kinder bei Brustkrebs zum Beispiel, dass kleine Krebse ihre Mama in die Brust zwicken. Das ist kein schönes Bild. Und man muss auch betonen, dass Krebs nicht ansteckend ist.
Das Gespräch abschließen sollte man mit der Absicherung, dass das Kind alles fragen darf, was ihm dazu einfällt. Ist man selber unsicher, sagt man: „Wenn ich nicht gleich eine Antwort auf deine Fragen weiß, werde ich darüber nachdenken oder ich werde mich erkundigen und dir dann eine Antwort geben.“
Eltern müssen sich außerdem gut um sich selber kümmern, um erfolgreich mit ihren Kindern kommunizieren zu können, zum Beispiel auch, indem sie sich psychologische Unterstützung holen.
Sollte auch das Sterben angesprochen werden?
J. Steinschaden: Das Sterben würde ich mit Kindern prinzipiell immer ansprechen, da sie automatisch an den Tod denken, wenn sie das Wort „Krebs“ hören. Auch bei einer guten Prognose. Die Sätze, die ich dazu gerne empfehle, sind: „Ich habe eine Krebserkrankung. Man kann an Krebs sterben. Mein Plan ist es nicht. Die Ärzt:innen machen alles, damit es nicht passiert. Sollte sich das irgendwann ändern und die Ärzt:innen sagen mir, dass ich sterben werde, sage ich dir das. Und bis dahin musst du dir keine Sorgen machen.“
Man sollte den Tod auch deswegen nicht tabuisieren, weil Kinder glauben, dass das Thema noch viel schlimmer ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sich nicht einmal Erwachsene trauen, darüber zu reden.
Kindern sollte auch offen gesagt werden, wer nach einem Todesfall für sie zuständig ist, sonst malen sie sich Horrorszenarien aus, wie zum Beispiel Kinderheime.
Welche Informationen zu einer Krebserkrankung sind für Kinder besonders wichtig?
J. Steinschaden: Kindern muss erklärt werden, dass niemand Schuld an der Krebserkrankung hat. Sie sollen auch nicht glauben, dass sie auf die Eltern aufpassen müssen. Denn was ist, wenn die Erkrankung nicht geheilt wird? Oder wenn es zu einem Rezidiv kommt? Ein Kind denkt dann, dass es nicht gut genug aufgepasst hat.
Deswegen sollten auch die Krankheitstheorien der Kinder angesprochen und bewusst gefragt werden: „Warum glaubst du, dass die Mama/der Papa Krebs hat?“
Eine Fünfjährige in meiner Beratung dachte einmal, dass ihre Mutter Krebs hat, weil sie aus dem Kindergarten Scharlach mitgebracht hat. Die Mutter ist leider an ihrer Erkrankung gestorben. Hätten wir das Thema nicht mit dem Kind angesprochen, hätten daraus lebenslange Schuldgefühle entstehen können.
Eltern sollten Kindern auch nicht sagen, dass sie in der Zeit der Erkrankung besonders brav sein müssen. Einerseits machen Kinder das sowieso automatisch, sie sind in Krisenzeiten sehr angepasst und stellen ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund. Das ist auch ein Wechselspiel: Wenn es einem Elternteil schlecht geht, wollen die Kinder es nicht noch mehr belasten, und wenn es ihm gerade besser geht, wollen sie keine negativen Themen aufbringen.
Andererseits vermittelt die Idee des Bravseins ein Gefühl einer Kontrolle, die es nicht gibt. Das führt bei Kindern zu großem Stress, weil sie dann denken, dass sie die Erkrankung beeinflussen können.
Auch der beliebte Satz „Jetzt müssen wir positiv denken“ ist schwierig. Ich sage Kindern immer, dass wir sowieso alle immer lieb zueinander sein sollten, unabhängig von der Erkrankung.
Welche praktischen Aspekte sind für Kinder von Bedeutung?
J. Steinschaden: Kinder fühlen sich sicher, wenn sie wissen, wer für sie zuständig ist und wie die zeitlichen Rhythmen sind. Zum Beispiel hilft es ihnen, zu wissen, wann für die Eltern Untersuchungen vorgesehen sind, weil sie ihnen natürlich das steigende Stresslevel anmerken. Außerdem müssen sie darüber informiert sein, was sich in ihrem eigenen Alltag ändert: wer sie zum Sport bringt oder von der Schule abholt oder auch, zu welchen Veranstaltungen sie gehen können. Kinder müssen wissen, wie ihr eigenes Leben von der Erkrankung der Eltern eingeschränkt wird.
Je jünger die Kinder, umso wichtiger ist ein sicheres, für sie vorhersehbares System. Man kann zum Beispiel bei längeren Krankenhausaufenthalten Kalender basteln, auf denen die Kinder sehen, wann Mama oder Papa wieder nach Hause kommt. Oder einen Betreuungskalender mit Fotos aufhängen, damit sie selber nachschauen können, wer sich an welchem Tag um sie kümmert.
Wie sollten Ärzt:innen am besten mit den Kindern ihrer Patient:innen sprechen?
J. Steinschaden: Ich glaube, dass Kinder selten den Wunsch haben, selbst mit dem medizinischen Personal zu sprechen. Aber sie wollen gerne wissen, wer sich um die erkrankte Person kümmert und was diese Menschen genau mit ihr machen.
Wenn in einer Klinik Personal ins Zimmer kommt, während die Kinder zu Besuch sind, macht es Sinn, in kurzen Sätzen zu erklären, was gerade passiert: „Wir wechseln jetzt den Zugang“, zum Beispiel. Wenn Kinder Fragen stellen und sich direkt an Ärzt:innen wenden, können diese natürlich auch direkt darauf antworten.
Meiner Meinung nach ist es aber gar nicht notwendig, dass Kinder das medizinische Personal persönlich kennenlernen. Wichtig ist nur, dass sie sich davon überzeugen können, dass der betroffene Elternteil in guten Händen ist. Das geht auch gut mit Selfies aus dem Krankenhaus. Wenn Ärzt:innen die Zeit für ein Selfie mit Mama oder Papa finden, kann das schon einen großen Unterschied machen.
Welche Unterstützung können Eltern und Kinder bei einer Krebsdiagnose von ärztlicher Seite aus erwarten?
J. Steinschaden: Für Betroffene ist es ganz wichtig, dass Ärzt:innen sich bei der Diagnosestellung überhaupt erkundigen, ob sie Kinder haben. Viele erkrankte Eltern erzählen mir, dass dieses Thema gar nicht angesprochen wurde. Meine Bitte an Onkolog:innen wäre: Erkundigt euch nach der Familiensituation und nehmt eure Patient:innen auch als Eltern wahr.
Optimal ist es, wenn die Eltern sich bei ihren Ärzt:innen sicher fühlen. Eine gute Kommunikation zwischen den erwachsenen Betroffenen und ihren Ärzt:innen ist eine Grundlage für die Kommunikation mit Kindern. Dazu gehört auch, dass Ärzt:innen Eltern an Beratungsstellen verweisen können, die ihnen bei den weiteren Schritten und Gesprächen mit den Kindern helfen. Ärzt:innen können Eltern auch Broschüren oder passende Literatur empfehlen oder mitgeben.
Vor einiger Zeit habe ich eine Schulung mit dem Titel „Mama/Papa hat Krebs“ gehalten. Sie dauert eine Stunde und ist online verfügbar. Den Link dazu weiterzugeben, wäre auch eine schnelle und effiziente Unterstützung, die Ärzt:innen anbieten können:
Gibt es juristische Elemente, die in der Aufregung um eine Krebsdiagnose oft übersehen werden?
J. Steinschaden: Viele Eltern sind nicht verheiratet. Bei ihnen ist es am wichtigsten, dass die Obsorge und das Testament geregelt sind. Denn Kinder sind ja erbberechtigt, wenn es ein gemeinsames Vermögen gibt. Ihr Pflichtteil muss nach dem Tod bei einem Notar hinterlegt werden. So viel Geld hat der verbliebene Elternteil oft nicht. Da sollte man sich vor dem Tod juristisch beraten lassen.
Wie sehr sollten Kinder tatsächlich in Diagnose, Therapie und Nachsorge eingebunden werden?
J. Steinschaden: Auch wenn Eltern manchmal das Bedürfnis danach haben, müssen Kinder nicht bei den einzelnen Schritten einer Krebsdiagnose, -therapie und -nachsorge in einer Klinik dabei sein. Wenn man ihnen einen Einblick geben möchte, reicht es meist, ein kurzes Video zu machen oder Fotos zu zeigen.
Anders ist es zu Hause: Da können Kinder zum Beispiel zusehen, wenn ein Elternteil künstlich ernährt wird – aber natürlich nur, wenn man das, was das Kind sieht, ausreichend erklärt.
Kinder sollten aber auf keinen Fall aktiv in diese Prozesse eingebunden werden. Vor dem Thema „pflegende Kinder“ warne ich ausdrücklich. Pflege muss im Erwachsenenbereich bleiben.
Gibt es besondere Bedürfnisse, die Kinder nach der Krebsdiagnose eines Elternteils entwickeln?
J. Steinschaden: Kinder, aber vor allem auch Jugendliche haben manchmal nach der Krebsdiagnose eines Elternteils den Wunsch, sich selbst rundum durchchecken zu lassen. Das ist natürlich unrealistisch, da eine solche komplette Untersuchung nicht wirklich stattfinden kann und oft auch keine zufriedenstellenden Antworten bringt. Trotzdem sollte man den Jugendlichen entgegenkommen und ihnen in diesem Fall vorschlagen, dass sie mit Ärzt:innen darüber reden können, wie hoch das Risiko ist, dass sie selber an Krebs erkrankt sind.
Es ist auch wichtig, im Leben der Kinder krebsfreie Zonen einzurichten, in denen nicht über die Krebserkrankung gesprochen werden darf. Da bietet sich zum Beispiel das gemeinsame Abendessen an.
Kindergarten und Schule sollen natürlich über die Erkrankung informiert werden, einfach auch, um die Kinder zu schützen. Aber diese Institutionen sollen keine aktive Rolle haben. Lehrpersonal darf nicht ständig bei den Kindern nachfragen, wie es zu Hause läuft. Denn Kinder richten sich an diesen Orten auch ihre eigenen krebsfreien Zonen ein und wollen dort nicht immer an die Erkrankung des Elternteils erinnert werden.
Auf der anderen Seite finden es Kinder furchtbar, wenn eine Person, die ihnen wichtig ist, verstirbt und in der Schule niemand Beileid ausdrückt. Das sollte nicht passieren.
Wie kann ein Alltag in einer Familie aussehen, in der ein Elternteil an Krebs erkrankt ist?
J. Steinschaden: Es ist wichtig, den Alltag weiterhin zuzulassen und Spaß zu haben, auch wenn die Lage gerade wirklich nicht gut ist.
Geburtstage von jüngeren Kindern darf man zum Beispiel nicht überspringen. Man kann Geburtstage in kleinerem Rahmen oder ganz ruhig feiern. Aber wenn man sie auslässt, fühlen sich die Kinder doppelt gestraft. Daran sollte man sich auch halten, wenn ein Elternteil gerade verstorben ist.
Wenn es aus medizinischer Sicht vertretbar ist, sollten Ereignisse, die für das Kind wichtig sind, auch mit den Ärzt:innen angesprochen und in die zeitliche Planung der Therapie mit aufgenommen werden.
Ressourcen für Eltern mit Krebs
Das könnte Sie auch interessieren:
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen
Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...