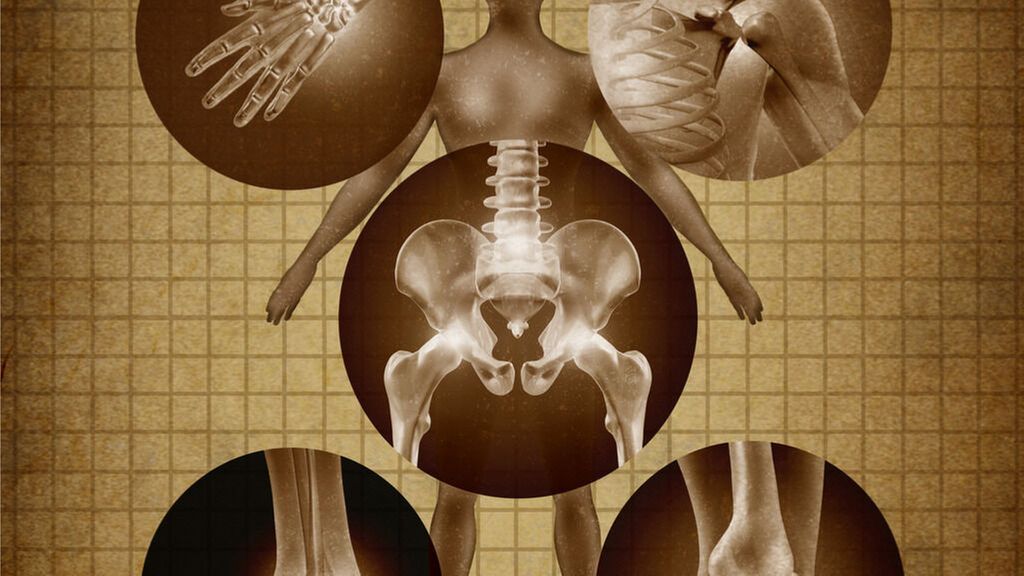
Altersunabhängiger Patellofemoralgelenkersatz
Leading Opinions
Autor:
Ass.-Prof. Geert Pagenstert
Orthopädie und Traumatologie, Universitätsspital Basel<br> E-Mail: Geert.pagenstert@unibas.ch
Autor:
Dr. med. Gyözö Lehoczky
Orthopädie und Traumatologie, Universitätsspital Basel<br> E-Mail: g.lehoczky@usb.ch
30
Min. Lesezeit
23.11.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Mit bestimmten Designs von isolierter patellofemoraler Arthroplastik ist eine zufriedenstellende Versorgung bei mehr als 80 % der Patienten möglich. Derzeit wird ein patellofemoraler Gelenkersatz insbesondere bei jüngeren Patienten implantiert, bei älteren Patienten wird meist die Totalendoprothese gewählt. Wird sich das in unseren Zeiten der immer älter werdenden Menschen verändern? Laut unseren Daten und Frühergebnissen zwei Jahre nach patellofemoralem Gelenkersatz gibt es keinen signifikanten Unterschied der klinischen Outcomes zwischen den verschiedenen Altersgruppen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Die isolierte patellofemorale Arthrose</h2> <p>Die arthrotische Veränderung des Patellofemoralgelenks ist eine häufige Pathologie mit einer Inzidenz von 79 % bei über 65-Jährigen – jedoch ist sie meist nur ein unsymptomatischer Nebenbefund. Ein Knieschmerz aufgrund einer isolierten Patellofemoralarthrose tritt in circa 10–24 % der Fälle auf. Laut einer multizentrischen Studie von Dejour and Allain (2004) findet sich bei einem Drittel der Patienten mit symptomatischer patellofemoraler Arthrose in der Vorgeschichte ein Luxationsereignis der Patella, bei 9 % eine Patellafraktur, bei 8 % eine chronische Arthritis und bei 78 % finden sich radiologische Zeichen einer Trochleadysplasie. Eine 3- bis 8-mal erhöhte Prävalenz wurde bei Patienten mit patellofemoralem Malalignment oder patellärer Instabilität beschrieben.</p> <h2>Behandlungsmöglichkeiten</h2> <p>Die Behandlung besteht primär aus konservativen Therapiemassnahmen: Gewichtsabnahme, muskuläre Stabilisierung/ Detonisierung und Mobilisation der Patella unter physiotherapeutischer Anleitung. Zudem können oral entzündungshemmende Medikamente oder eventuell intraartikuläre Viskosupplementation eingesetzt werden. Auf diese Weise bessern sich bei den meisten der Patienten die Beschwerden. Nur bei einer Minderheit der Betroffenen ist ein operatives Vorgehen aufgrund von persistierender Beschwerdesymptomatik nötig. Die Möglichkeiten sind das arthroskopische patellofemorale Débridement, die laterale Facettektomie oder als Ultima Ratio der Gelenkersatz (isoliert patellofemoral oder total).<br /> Der isolierte patellofemorale Gelenkersatz stellt eine weniger invasive Alternative zur Knietotalendoprothese dar. Er geht mit verringertem Blutverlust und kürzerer Hospitalisationsdauer einher. Insbesondere für ältere Patienten stellt dies bezüglich möglicher Komplikationen ein wichtiges Kriterium dar.</p> <h2>Der patellofemorale Gelenkersatz</h2> <p>Der erste patellofemorale Gelenkersatz wurde von McKeever 1955 beschrieben. Seitdem sind viele verschiedene Designs auf dem Markt erschienen. Aufgrund zu Beginn oft unbefriedigender Ergebnisse wurde der Einbau eines patellofemoralen Gelenkersatzes für lange Zeit kontrovers diskutiert.<br /> Die ersten Modelle waren die Onlay- Prothesen: Diese ersetzen die gesamte Trochleaoberfläche. Für die Richards- Prothese (Smith and Nephew) und die Avon-Prothese (Stryker) sind 10-JahresÜberlebensraten von 73–84 % und eine Zufriedenheit von 77–90 % dokumentiert. Bei anderen Prothesen – z.B. LCS (Depuy), Femoro-Patella Vialla (Wright Medical) oder Lubinus-Prothese (Link) – sind weniger befriedigende Ergebnisse beschrieben.<br /> Bei den neuesten Modellen, den Inlay- Prothesen (z.B. HemiCAP-Wave-Prothese, Arthrosurface), zeigt sich ähnlich wie bei den Onlay-Prothesen eine Zufriedenheitsrate von über 80 % . Hier wird nur die Trochleagrube ersetzt, die Prothese bettet sich übergangslos mit dem Trochlearandknorpel in den subchondralen Knochen ein. Damit werden die native Anatomie der Trochlea und die Kniekinematik rekonstruiert. Ein Patellarückflächenersatz ist mit diesem Prothesendesign weniger oft nötig. Darüber hinaus ist im Vergleich zu Onlay- Prothesen weniger Progression der tibiofemoralen Degeneration beschrieben worden, welche einen häufigen Grund für die Konversion in eine Totalprothese darstellt.</p> <h2>Operatives Resultat bei älteren Patienten</h2> <p>Van Jonbergen (2010) hat die Onlay- Prothese (Richards Typ II) untersucht. In dieser Studie wurden die Langzeitresultate von 185 Patienten (durchschnittlich 13,3 Jahre) analysiert. Es wurden keine Unterschiede in den Outcomes zwischen den Patientengruppen der unter oder über 50-Jährigen gefunden. Bei den neueren Prothesentypen, vor allem bei den Inlay- Prothesen, steht die Frage noch aus, ob sie auch bei älteren Patienten gleich gut anwendbar sind.</p> <h2>Material und Methoden</h2> <p>Wir haben eine retrospektive, monozentrische Fallserienstudie mit 22 Patienten durchgeführt, denen zwischen 2012 und 2015 vom gleichen Chirurgen eine patellofemorale Inlay-Prothese HemiCAP® Wave (Arthrosurface, Franklin, MA, USA) implantiert wurde. Das durchschnittliche Patientenalter war 48,3 Jahre (31–82 Jahre). Zwei Altersgruppen wurden verglichen: die Patienten unter (n=14) und diejenigen über 50 Jahre (n=8).<br /> Prä- und postoperativ wurden standardisierte klinisch-radiologische Untersuchungen durchgeführt (Röntgen des Knies in drei Ebenen), Aktenforschung betrieben sowie Fragebögen mit klinischen Scores ausgehändigt bzw. telefonisch abgefragt. Radiologisch wurden die arthrotischen Veränderungen von allen drei Kompartimenten (medial, lateral, patellofemoral) nach Kellgren- Lawrence eingestuft (gemäss Arthrosegrad von 0–4) und die Patellahöhe nach dem Caton-Deschamps- Index ermittelt. Aus den Akten wurden begleitende operative Verfahren, Komplikationen, postoperative Bluttransfusionen und eventuell benötigte stationäre Rehabilitation erhoben.<br /> Die klinischen Scores waren der WOMAC- Score (Bewertung der Symptome, Steifheit, Schmerzen, Funktion und Alltagsaktivitäten; maximale Punktzahl bei absoluter Beschwerdefreiheit: 100 Punkte), der Lysholm-Score (Bewertung von Schmerzen, Blockierung, Instabilität, Schwellung und Hinken; bei Abwesenheit maximal 100 Punkte) und der VAS-Score für Schmerzen (Maximum an Schmerzen: 10 Punkte).</p> <p>Zunächst wurden prä- und 2 Jahre postoperativ die klinischen und radiologischen Ergebnisse verglichen und der Delta-Wert bestimmt. Um den Delta-Wert zu erhalten, wurde der präoperative Wert vom postoperativen Wert abgezogen. Anschliessend wurde der Delta-Wert zwischen den beiden Altersgruppen untersucht. Eine statistische Analyse der Daten wurde mit Wilcoxon Signed-Rank Test und dem Pearson’s Chi Square Test (JMP<sup>®</sup> 13.0.0., SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) gemacht.</p> <h2>Resultate</h2> <p>Von 22 Patienten waren 16 Patienten mit 18 implantierten Prothesen für das Follow-up erreichbar und wurden inkludiert, davon waren 7 über 50 Jahre alt. 8 Patienten erhielten gleichzeitig einen retropatellären Rückflächenersatz, 4 Patienten erhielten einen kombinierten Eingriff mit Sanierung der patellofemoralen Instabilität. Das durchschnittliche Follow-up war 22,8 Monate (18–30 Monate).<br /> 2 Patienten hatten beidseitige Operationen. Eine Patientin (46 Jahre alt) wurde aufgrund einer Konversion in eine Totalknieprothese 11 Monate postoperativ exkludiert. 4 Patienten wurden reoperiert: 2 mit Arthrolyse, 2 andere mit sekundärem patellärem Rückflächenersatz. Bei einem Patienten wurde das Inlay- Design während des Follow-ups auf Onlay gewechselt.<br /> Bei 18 Prothesen berichteten 88,9 % der Patienten über ein zufriedenstellendes oder sehr zufriedenstellendes Ergebnis. In den klinischen Scores wurde eine signifikante Verbesserung gefunden: Der Lysholm- Score zeigte einen Anstieg von durchschnittlich 50,6 ± 22,9 auf postoperativ 76,4 ± 16,7 (p=0,013, Abb. 1). Der WOMAC-Score stieg von 49,2 ± 19,2 auf 76,3 ± 19,1 (p<0,001). Der VAS-Score wurde von 5,9 ± 2,4 auf 2,3 ± 2 signifikant verbessert (p<0,001).<br /> Es wurde keine signifikante Progression der radiologischen Arthrosezeichen erörtert. Jedoch zeigte der prä- und postoperative Kellgren-Lawrence-Score eine leichte, nicht signifikante Steigerungstendenz im medialen Gelenkspalt von 1,3 ± 0,5 präoperativ auf 1,5 ± 0,8 2 Jahre postoperativ (p=0,44) und im lateralen Gelenkspalt von 0,85 ± 0,8 auf 1,1 ± 0,8 (p=0,46). Es wurde keine signifikante Veränderung der Patellahöhe gefunden. Während des Follow-ups benötigte kein Patient eine Bluttransfusion oder stationäre Rehabilitation wegen eines protrahierten Verlaufs.</p> <p>Wir fanden keinen Unterschied zwischen den beiden Altersgruppen. Keiner der untersuchten Parameter zeigte eine Korrelation. Illustriert sind die Verbesserungen des klinischen Scores bei Lysholmund VAS-Score (p=0,054 bzw. p=0,7469, Abb. 2 und 3).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1704_Weblinks_lo_ortho_1704__s53_abb1-3.jpg" alt="" width="2150" height="1648" /></p> <h2>Diskussion</h2> <p>Bei unseren Patienten zeigte der patellofemorale Gelenkersatz auch bei älteren Patienten ähnlich gute Ergebnisse wie bei den jüngeren Patienten. Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit den in der Literatur beschriebenen. Aufgrund der kleinen Patientengruppe und der kürzeren Followup- Zeit muss dieses Resultat noch anhand einer grösseren Patientenzahl und einer längeren Follow-up-Zeit bestätigt werden.<br /> Unsere Wahl bei isolierter patellofemoraler Arthrose und bei sonst aktiven Patienten ist weiterhin der isolierte Gelenkersatz. Unsere älteste Patientin war 82 Jahre alt, mit sehr gutem postoperativem Ergebnis.<br /> Ein Patellofemoralgelenkersatz hat gegenüber der totalen Knieprothese den Vorteil, dass das nicht betroffene tibiofemorale Gelenkkompartiment (und damit die Menisken und Kreuzbänder) erhalten werden können und die physiologische Kniekinematik erhalten bleibt. Das Sparen von Knochenmaterial ist bei der älteren Patientengruppe ein weiterer wichtiger Punkt.<br /> Eine prospektive randomisierte Studie (Warwick Trial, Evidenzlevel I–II), die den Patellofemoralgelenkersatz mit dem Totalgelenkersatz vergleicht, steht noch aus, die Resultate sind noch nicht verfügbar.<br /> Die Unzufriedenheit und die Revisionsrate nach isolierter patellofemoraler Prothese korrelieren mit den arthrotischen Veränderungen tibiofemoraler Gelenkteile. Klar ist, dass die Indikation einer patellofemoralen Prothese streng gestellt und auf die Sanierung isolierter patellofemoraler Beschwerden beschränkt bleiben muss.<br /> In unserem 2-Jahres-Follow-up haben wir eine Tendenz zur Verschlechterung der tibiofemoralen Arthrose im Sinne eines erhöhten Kellgren-Lawrence-Scores gefunden. Dies war jedoch nicht signifikant. Aufgrund der kleinen Patientenzahl können wir darüber noch keine sichere Aussage treffen. Für eine weitere Abklärung dieses Effektes wären ein längeres Follow-up und mehr Probanden mit Kontrollgruppe sinnvoll.</p> <h2>Take-Home-Message</h2> <p>In unserer Fallserie konnte die patellofemorale Arthroplastik isolierte patellofemorale Beschwerden erfolgreich vermindern. Auch bei älteren, aktiven Patienten zeigen sich gute Frühergebnisse. Wegen der verringerten Morbidität, des geringeren Blutverlusts sowie der schnelleren und leichteren Rehabilitationsphase, verglichen mit totalem Kniegelenkersatz, würden wir diese operative Versorgung nach strenger Indikationsstellung empfehlen.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei den Verfassern</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Wachstumslenkende Eingriffe an der unteren Extremität
Minimalinvasive wachstumslenkende Eingriffe als Alternative zu komplexen Osteotomien oder aufwendigen Verlängerungsoperationen gehören zum Standardinstrumentarium des Kinderorthopäden. ...
Weichteilverletzungen der kindlichen Hand
Weichteilverletzungen der kindlichen Hand reichen von oberflächlichen Hautlazerationen bis hin zu tiefgreifenden Schädigungen auch funktioneller Einheiten oder neurovaskulärer Strukturen ...
Scheibenmeniskus bei Kindern und Jugendlichen
Der Scheibenmeniskus ist eine angeborene anatomische Fehlbildung, die meist den lateralen Meniskus betrifft und häufig asymptomatisch bleibt. In einigen Fällen können sich jedoch ...


