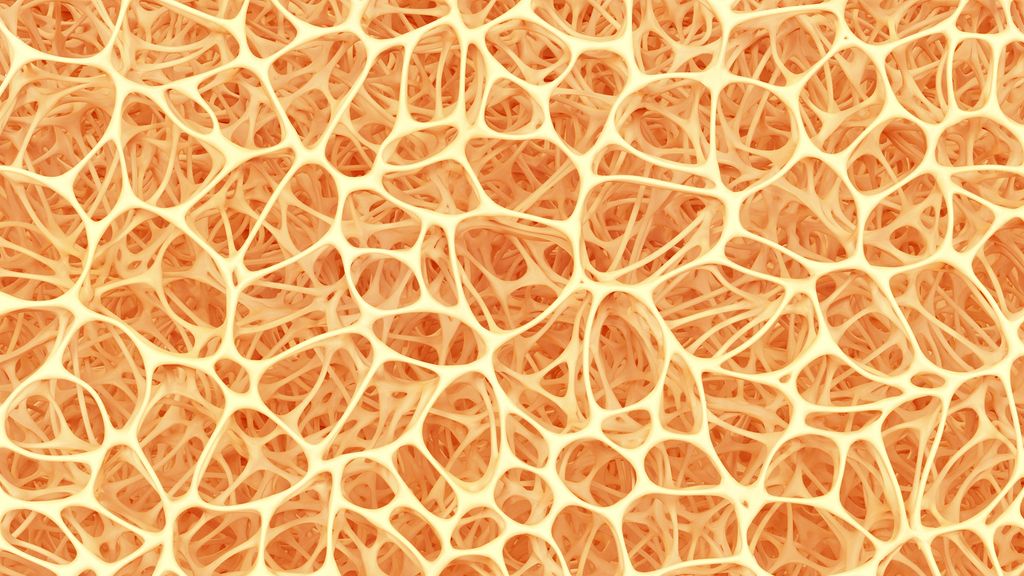
©
Getty Images/iStockphoto
Der lange Kopf der Bizepssehne als Ursache für den vorderen Schulterschmerz
Jatros
Autor:
Prim. Ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Fialka
AUVA-Unfallkrankenhaus Meidling
Autor:
Dr. Sandra Bösmüller
E-Mail: sandra.boesmueller@auva.at
30
Min. Lesezeit
15.09.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der vordere Schulterschmerz ist ein häufiges Symptom, das zur Vorstellung an einer unfallchirurgischen oder orthopädischen Abteilung führt. Dieser Artikel soll eine Übersicht über die zahlreichen Ursachen der Bizepssehnenpathologie geben, um eine bessere Differenzierung und damit auch Behandlung zu ermöglichen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Wir wissen derzeit bei Weitem noch nicht alles über die Funktion und Pathologie der langen Bizepssehne (LBS).</li> <li>Der vordere Schulterschmerz, welcher durch eine LBS-Pathologie ausgelöst wird, kann in jedem Lebensalter auftreten.</li> <li>Die Ursachen dafür können äußerst vielfältig sein und sind in Abhängigkeit ihrer Genese differenziert zu therapieren.</li> <li>Die konservative Therapie ist Mittel der Wahl.</li> <li>Operativ erzielen sowohl die Tenodese als auch die Tenotomie gute funktionelle Ergebnisse. Es empfiehlt sich, auf Begleitverletzungen (RM-Rupturen, Impingement, SSC-Rupturen) zu achten.</li> <li>Die Tenotomie sollte bei Teilrupturen der LBS, einer therapieresistenten Tenosynovitis, bei Instabilität oder bei Patienten über 60 Jahren bevorzugt werden.</li> <li>Die Tenodese ist eine ausgezeichnete Therapie bei jungen und aktiven Patienten.</li> </ul> </div> <p>Der Bizepsmuskel ist nicht nur ein zweigelenkiger, sondern auch ein zweiköpfiger Muskel. Der kurze Kopf entspringt am Processus coracoideus, der lange am Tuberculum supraglenoidale der Scapula im Glenohumeralgelenk und zieht über den Sulcus intertubercularis nach extraartikulär, wo beide Köpfe in den Muskelbauch übergehen und über den Lacertus fibrosus an der Unterarmfaszie sowie an der Tuberositas radii inserieren. Die lange Bizepssehne (LBS) wird beim Austritt aus dem Glenohumeralgelenk durch eine Weichteilschlinge, den sogenannten Bizeps-Pulley (Abb. 1), stabilisiert. Dieser wird durch das coracohumerale Ligament (CHL), das superiore glenohumerale Ligament (SGHL) sowie durch Teile der Sub­scapularissehne (SSC) und der Supraspinatussehne (SSP) gebildet.<br /> Die Blutversorgung der LBS erfolgt über die A. circumflexa humeri anterior, welche die Sehne von distal erreicht. Die Innervation erfolgt über ein komplexes Netzwerk an Neurofilamenten, ausgehend vom Nervus musculocutaneus. Die Hauptfunktion des Bizepsmuskels besteht in der Ellbogenflexion sowie in der Unterarmsupination. Biomechanisch betrachtet hat die LBS im Glenohumeralgelenk weitere Funktionen: Sie agiert als vorderer Schulterstabilisator sowie als Humeruskopfdepressor, jedoch nur dann, wenn die Depressorfunktion der Rotatorenmanschette im Sinne einer Ruptur nicht mehr gegeben ist.<br /> Pathophysiologisch liegen dem LBS-Schmerz drei Hauptursachen zugrunde: Inflammation bzw. Degeneration, Instabilität oder Rupturen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite19_1.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Tendinitis, Peritendinitis und Tendinose</h2> <p>Unter dem Aspekt der Inflammation werden zwei Gruppen differenziert betrachtet: die Tendinitis sowie die Peritendinitis.<br /> Die isolierte Tendinitis ist selten (5 % Inzidenz) und zumeist bei jungen Patienten mit Überlastungssyndrom anzutreffen. Sie ist eine Domäne der konservativen Therapie mittels Sportkarenz, entzündungshemmender Medikation (NSAR) sowie gezielter Physiotherapie (Scapulafixatoren- und Depressorentraining). Falls die konservative Therapie nicht zur Beschwerdefreiheit führt, kann dem Patienten auch die operative Therapie (Tenodese) angeboten werden. Für den Rest der Tendinitiden gilt, dass sie gehäuft mit anderen Schulterpathologien wie zum Beispiel Impingement oder Rotatorenman­schetten(RM)-Läsionen auftreten. Hier ist in erster Linie die Hauptpathologie zu behandeln. Je nach Zustand der LBS kann diese entweder tenotomiert oder mittels Tenodese versorgt werden.<br /> Die Peritendinitis entspricht einer Tenosynovitis der LBS. Es zeigen sich klinisch eine deutliche Druckdolenz bei Palpation, eine Schmerzzunahme bei Überkopfaktivitäten und eine Wanderung des Schmerzpunktes bei Außenrotation. Weiters liegt ein positives „biceps tension sign“ vor. Die Behandlung der Peritendinitis ist ebenfalls konservativ und besteht aus Sportkarenz, kühlen Umschlägen sowie Physiotherapie (Scapulafixatoren- und Depressorentraining).<br /> Bei der Tendinose (Abb. 2) handelt es sich um eine Sehnendegeneration. Sie präsentiert sich mit ähnlicher Symptomatik wie die Tendinitis, allerdings geben Patienten hier auch Ruheschmerzen an. Die Behandlung unterscheidet sich von den o.g. Therapien: Entzündungshemmende Medikation und kalte Umschläge sind nicht zielführend. Es werden Dehnungsübungen des Bizeps, exzentrisches Muskeltraining, RM-Training sowie die graduelle Steigerung des Krafttrainings empfohlen. Stellt sich konservativ kein Behandlungserfolg ein, ist zumeist die Tenotomie Methode der Wahl.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite19_2.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Instabilität</h2> <p>Die LBS-Instabilität entsteht durch einen Verlust der stabilisierenden Weichteile, wobei Habermeyer<sup>1</sup> in 90 % eine Assoziation mit Verletzungen des Bizeps-Pulleys angibt und Lafosse<sup>2</sup> bei 200 untersuchten RM-Rupturen in 45 % eine vordere oder hintere Instabilität beschreibt. Eine Klassifikation der Bizeps-Pulley-Rupturen wurde von Habermeyer 2004 publiziert.<sup>1</sup> Bei jungen Patienten mit isolierter Bizeps-Pulley-Ruptur kann dieser unter Umständen auch rekonstruiert und so die Instabilität behoben werden. Ist die Sehne selbst bereits von degenerativen Veränderungen betroffen oder steht eine RM-Ruptur im Vordergrund, sollte die Tenodese oder Tenotomie angedacht werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite19_3.jpg" alt="" width="382" height="355" /></p> <h2>Rupturen</h2> <p>Bei der LBS-Ruptur handelt es sich meist um einen degenerativen Prozess. Klinisch beschreibt der Patient einen in den Muskelbauch ausstrahlenden Schmerz, vorderen Schulterschmerz, repetitives Schnappen, Schmerz bei Überkopfaktivität, Nachtschmerz sowie eine plötzliche Schmerzfreiheit nach der Sehnenruptur. Weiters klagen die Patienten gelegentlich über eine neu aufgetretene Schwellung im Bereich des distalen Oberarms, welche dem abgesunkenen Muskelbauch des Bizeps entspricht und lediglich ein kosmetisches Problem darstellt. Die Funktion des Bizeps bleibt durch den Ursprung des kurzen Kopfes der Bizepssehne am Processus coracoideus weitgehend erhalten. Darüber ist der Patient aufzuklären und eine symptomatische Therapie einzuleiten. In einer geringeren Zahl der Fälle kann die Ruptur auch durch ein hochenergetisches Trauma bzw. eine kraftvolle Dezeleration des Unterarmes verursacht werden. Im Prinzip ist auch hier die symptomatische Behandlung ausreichend, auf Wunsch der doch meist jungen Patientenklientel kann eine Tenodese durchgeführt werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite20.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>SLAP-Läsion</h2> <p>Als Sonderform der LBS-Pathologien ist die SLAP-Läsion („superior labrum anterior to posterior“) anzuführen. Hierbei handelt es sich um eine Verletzung des Bizepssehnenankers am superioren Labrum von ca. 10 bis 2 Uhr (Abb. 3). Diese Verletzung kann einerseits traumatisch durch einen Sturz auf den abduzierten und flektierten Arm oder häufiger durch repetitive Mikrotraumata im Rahmen von Überkopfsportarten entstehen. Klinisch äußert sie sich durch ein Schnappen, ein Instabilitätsgefühl sowie einen Kraftverlust. Als aussagekräftigster klinischer Test eignet sich der O’Brien-Test, der jedoch nur hinweisgebend auf eine SLAP-Läsion ist, wenn er als einziger Test positiv ist. Diagnostisch sollte nach der obligaten Röntgenuntersuchung eine Arthro-Magnetresonanztomografie (Arthro-MRT) mit intraartikulärer Kontrastmittelapplikation durchgeführt werden, um die Pathologie am Bizepssehnenanker sowie am Labrum besser darstellen zu können (Abb. 4). <br /> Es lassen sich seit der Erstbeschreibung der Verletzung durch James Andrews 1985 bei Wurfsportlern mehrere Typen der SLAP-Läsion differenzieren.<sup>3</sup> Steven Snyder<sup>4</sup> gab der SLAP-Läsion 1990 ihren Namen und beschrieb in seiner Publikation erstmalig 4 Typen: Die Typ-I-Verletzung entspricht einer Aufrauung am Bizepssehnenanker und tritt mit einer Inzidenz von ca. 11 % auf. Die Typ-II-Verletzung ist mit 55 % Inzidenz der häufigste Typ und entspricht einem Riss des superioren Labrums bzw. des Bizepssehnenankers am superioren Glenoid. Bei der Typ-III-Verletzung (Inzidenz 33 % ) handelt es sich um einen Korbhenkelriss des superioren Labrums, wobei das verbleibende Labrum sowie der Bizepssehnenanker noch am Glenoid anhaften. Mit 15 % Inzidenz deutlich seltener ist die Typ-IV-Verletzung mit einem Korbhenkelriss des superioren Labrums mit einem zusätzlichen Riss in die LBS.<br /> Maffet et al<sup>5</sup> erweiterten 1995 die SLAP-Läsionen um weitere 3 Typen, die an dieser Stelle nicht eigens angeführt werden, um den Rahmen des Artikels nicht zu sprengen. Diese hochgradigen SLAP-Läsionen sind selten und bedürfen einer individuellen Therapie.<br /> Von der Typ-II-Läsion sind Normvarianten des superioren bzw. anterioren Labrums zu differenzieren. Es handelt sich hierbei um den sogenannten Buford-Komplex (Inzidenz 1,5–5 % ), welcher ein verdicktes mittleres glenohumerales Band bezeichnet, das bis zur Basis des Bizepssehnenankers zieht. Als sublabrales Foramen (Inzidenz 12 % ) wird eine Aussparung des anterioren Labrums von 1 bis 3 Uhr bezeichnet, welches nicht mit einer SLAP-Läsion verwechselt werden darf. Diese Normvarianten führen bei operativer Refixation zu Bewegungseinschränkungen vor allem in der Außenrotation.<br /> Die Therapie der SLAP-Läsionen erfolgt in Abhängigkeit von ihrem Typ: Die Typ-I-Verletzung wird konservativ behandelt, die Typ-II-Verletzung kann mittels Refixation des Bizepssehnenankers, Tenodese oder Tenotomie versorgt werden, bei der Typ-III-Verletzung ist die Resektion des Korbhenkels Therapie der Wahl und bei der Typ-IV-Verletzung die Tenodese.<br /> Bezüglich der operativen Therapie der Typ-II-Verletzung herrscht international kein Konsensus. Wir bevorzugen bei jungen und aktiven Patienten die anatomische Refixation des Bizepssehnenankers mittels Nahtankern (Abb. 5). Eine aktive Außenrotation sollte bis 8 Wochen postoperativ vermieden werden, die volle Sportfähigkeit erlangt der Patient 6 Monate nach Operation. Auffallend bei dieser Technik ist die relativ lange Schmerzperiode (bis zu 6 Monate postoperativ) bei guter Funktion. Alternativ zur Refixation kann eine Tenodese, also die extraanatomische Verankerung der Bizepssehne am Sulcus intertubercularis, durchgeführt werden (Abb. 6). Der Vorteil liegt in der schnelleren Schmerzfreiheit bei guter Funktion, wobei auch hier eine volle Sportfähigkeit erst nach 6 Monaten gegeben ist.<br /> Die am einfachsten durchzuführende Technik ist die Tenotomie. Sie führt zu einer raschen Schmerzfreiheit und erlaubt die sofortige freie Beweglichkeit bis zur Schmerzgrenze. Die Patienten zeigen nur ein minimales Kraftdefizit in Ellbogenflexion und Supination des Unterarmes; störend ist in manchen Fällen die Popeye-Deformität, wenn der Muskelbauch des Bizeps nach distal rutscht. Bei älteren Patienten mit niedrigerem Leistungsniveau sowie bei eventuell vorliegenden Begleitpathologien (RM-Rupturen, Impingement etc.) ist die Tenotomie Methode der Wahl. In jedem Fall ist es wichtig, mit dem Patienten die Vor- und Nachteile der jeweiligen Technik zu besprechen.</p> <h2>Sonderfälle</h2> <p>Zu guter Letzt müssen noch einige Sonderfälle, die für den vorderen Schulterschmerz ursächlich sein könnten, angesprochen werden. Eine glenohumerale Laxizität mit Hypermobilität des Schultergelenks kann dazu führen, dass sich der Bizepsmuskel beim Versuch, den Kopf in der Pfanne zu stabilisieren, überanstrengt. Eine Entzündung der vorderen Gelenkskapsel mit Synovitis kann durch die Nahebeziehung zur LBS ebenso einen vorderen Schulterschmerz erzeugen. Die Funktion der LBS kann schließlich auch durch eine skapuläre Dyskinesie beeinträchtigt sein.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Habermeyer P et al: J Shoulder Elbow Surg 2004; 13(1): 5-12 <strong>2</strong> Lafosse L et al: Arthroscopy 2007; 23(1): 73-80 <strong>3</strong> Andrews J et al: Am J Sports Med 1985; 13(5): 337-41 <strong>4</strong> Snyder SJ et al: Arthroscopy 1990; 6(4): 274-9 <strong>5</strong> Maffet MW et al: Am J Sports Med 1995; 23(1): 93-8</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Wachstumslenkende Eingriffe an der unteren Extremität
Minimalinvasive wachstumslenkende Eingriffe als Alternative zu komplexen Osteotomien oder aufwendigen Verlängerungsoperationen gehören zum Standardinstrumentarium des Kinderorthopäden. ...
Weichteilverletzungen der kindlichen Hand
Weichteilverletzungen der kindlichen Hand reichen von oberflächlichen Hautlazerationen bis hin zu tiefgreifenden Schädigungen auch funktioneller Einheiten oder neurovaskulärer Strukturen ...
Scheibenmeniskus bei Kindern und Jugendlichen
Der Scheibenmeniskus ist eine angeborene anatomische Fehlbildung, die meist den lateralen Meniskus betrifft und häufig asymptomatisch bleibt. In einigen Fällen können sich jedoch ...


