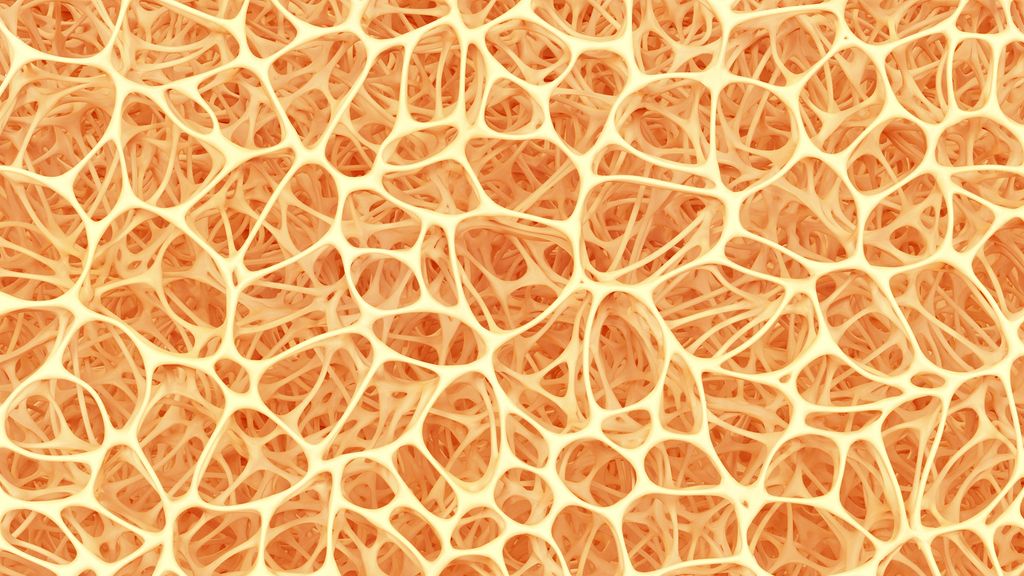
©
Getty Images/iStockphoto
Österreichische Leitlinie Kreuzschmerzen
Jatros
Autor:
Dr. Friedrich Hartl
Sprecher der Bundesfachgruppe PMR<br> Facharzt für physikalische Medizin und<br> allgemeine Rehabilitation, Wien<br> E-Mail: office@dr-hartl.at<br>
30
Min. Lesezeit
30.03.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die österreichische Leitlinie „Update der evidenz- und konsensusbasierten österreichischen Leitlinien für das Management akuter und chronischer unspezifischer Kreuzschmerzen 2011“<sup>1</sup> entstand unter Mitarbeit von Experten des BMG sowie zahlreichen wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Die getroffenen Aussagen basieren auf einer sorgfältigen Literaturrecherche und Expertenempfehlungen. Hohe Praxisrelevanz und „Augenmaß“ kennzeichnen diese zur Erschließung und Vermittlung von Wissen in diesem Bereich gut geeignete Leitlinie.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <strong>Diagnostische Empfehlungen der Leitlinie:</strong> <ul style="list-style-type: none;"> <li>- Differenzierung nach Dauer der Symptomatik (Tab. 1)</li> <li>- Ausschluss spezifischer Kreuzschmerzformen, wenn zumindest eine „red flag“ vorliegt (Tab. 2)</li> <li>- Bildgebung und Labor nur, wenn Anamnese oder klinische Befunderhebung Hinweise auf das Vorliegen spezifischer Ursachen geben, oder bei Fortbestehen der Beschwerden 4–6 Wochen nach deren Beginn Therapie des akuten unspezifischen Kreuzschmerzes:</li> <li>- Aktivität beibehalten, medikamentöse Behandlung, 70 % Spontanremission innerhalb von 6 Wochen</li> <li>- First Line: NSAR, Second Line: Muskelrelaxanzien, Opioide; weiters Manualtherapie, physikalische Kombinationstherapie</li> <li>- Der Chronifizierungsprozess durch psychosoziale und somatische Faktoren sollte durch rechtzeitige Behandlung hintangehalten werden (Warnhinweise siehe Tab. 3).</li> </ul> <strong>Therapie des chronischen unspezifischen Kreuzschmerzes:</strong> <ul style="list-style-type: none;"> <li>- NSAR: cave Sicherheitsprobleme (KI, KHK und Schlaganfallsrisiko, Gastrointestinaltrakt, Leber, Niere, Blutungsrisiko)</li> <li>- Opioidanalgetika Second Line, Antidepressiva als Koanalgetika, Muskelrelaxanzien (cave Abhängigkeitspotenzial), Capsaicin (Spezialform: Munari-Packung), Antikonvulsiva beim neuropathischen Schmerz, facettengelenksnahe und epidurale Infiltrationen als Probetherapie, physikalische Kombinationstherapie, psychologische Behandlung und Psychotherapie</li> <li>- Weitere Maßnahmen: Radiofrequenztherapie, Spinal-Cord-Stimulation, Akupunktur</li> </ul> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s27_tab1.jpg" alt="" width="1419" height="549" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s27_tab2.jpg" alt="" width="686" height="1715" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s27_tab3.jpg" alt="" width="1417" height="1180" /></p> </div> <h2>Nutzen und Grenzen von Leitlinien</h2> <p>Leitlinien können helfen, Wissen zu erschließen und Wissen zu vermitteln. Als alleinige Grundlage zur Anwendung im konkreten Fall eines Patienten greifen sie zu kurz bzw. sind sie sogar fallweise gefährlich. Leitlinien werden unter Abstraktion großer Teile der Wirklichkeit modellhaft erstellt, um eine breite Anwendbarkeit zu gewährleisten. Diese ausgeblendeten Teile der Wirklichkeit und vom Modell nicht erfassten Bereiche sind aber maßgeblich für den Therapieerfolg. Nimmt man dem Arzt die Möglichkeit, situativ zu entscheiden, und bindet man ihn an die Festlegungen von Leitlinien, bedeutet dies ein erhöhtes Risiko von Fehlentscheidungen. So zeigt eine österreichische Multicenterstudie zur ambulant erworbenen Pneumonie, dass nach Leitlinie behandelte Patienten ein deutlich höheres Mortalitätsrisiko aufweisen als solche, bei denen der behandelnde Pulmologe situativ entscheidet.<sup>2</sup> Auch in den USA änderten die Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)/Joint Commission die Vorgehensweise bei Pneumoniebehandlung, nachdem bekannt geworden war, dass nach Leitlinie behandelte Pneumoniepatienten öfter sterben als solche, bei denen die Ärzte nach eigenem Ermessen entscheiden.<sup>3</sup><br /> Die Beschränkung bei der Leitlinienerstellung auf ausschließlich externe Evidenz und hier auf die Einschränkung, nur Evidenz der Klassen I und IIa heranzuziehen, führt zum Ausblenden großer Teile der medizinischen Wirklichkeit, insbesondere der individuellen Expertise des behandelnden Arztes und der klinischen Bedürfnisse des Patienten. Diese beiden Entitäten sind aber zentrale Forderungen der evidenzbasierten Medizin. Häufig erfolgen das Design von Studien und die Erstellung von Literaturübersichten interessengeleitet. Nach meinem Dafürhalten ist die österreichische Leitlinie für das Management akuter und chronischer unspezifischer Kreuzschmerzen diesbezüglich wesentlich realitätsorientierter und – da auch Expertenmeinung in die Erstellung eingeflossen ist – breit anwendbar.<br /><br /> Die vorliegende Leitlinie sieht sich als Orientierungshilfe. Es wird betont, dass ein Abweichen vom empfohlenen Vorgehen in bestimmten Fällen nicht nur sinnvoll, sondern sogar angezeigt sein wird.</p> <h2>Vorgehen bei der Erstellung der Leitlinie</h2> <p>Unter dem Vorsitz von Prim. em. Univ.- Prof. Dr. Martin Friedrich, Center of Excellence for Orthopaedic Pain Management Speising (CEOPS), waren in der Arbeitsgruppe tätig: Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit, der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (ÖGPP), der Österreichischen Röntgengesellschaft (ÖRG), der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM), der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG), der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (ÖGO), der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN), der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation (ÖGR), der Österreichischen Gesellschaft für Neurochirurgie (ÖGNC) und der Österreichischen Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation (ÖGPMR) sowie Vertreter der Physiotherapeuten und Ergotherapeuten.<br /><br /> Als Grundlage dienten europäische Leitlinien und Instrumente zur Leitlinienbewertung. Wissenschaftliche Daten des Evidenzgrades Ia bis IIa und Empfehlungsgrad a und b wurden einbezogen. Bei manchen Empfehlungen wurde auf unzureichende und/oder widersprüchliche Evidenzlage hingewiesen, weiters wurde Expertenmeinung eingeholt.</p> <h2>Einteilung</h2> <p>Der Begriff Kreuzschmerz („low back pain“) wird definiert als Schmerz im Bereich zwischen den 12. Rippen und den unteren Glutealfalten, mit oder ohne Ausstrahlung ins Bein. Er wird differenziert in akut, subakut, chronisch, akut rezidivierend und chronisch rezidivierend (Tab. 1). Zunächst wird der Ausschluss spezifischer Kreuzschmerzformen empfohlen, wobei die in Tabelle 2 angeführten klinischen Alarmsymptome zu beachten sind.<br /> Degenerative Wirbelsäulenveränderungen werden nur insofern als spezifische Kreuzschmerzform bezeichnet, als ihr klinisches Bild eng mit dem morphologischen Substrat korreliert und dessen Nachweis therapeutische Implikationen nach sich zieht, vor allem Anterolisthese und Modic-Läsion. Ist durch Anamnese und klinische Befunderhebung kein Hinweis auf eine spezifische Ursache gegeben, sollen Bildgebung und Labor erst bei Fortbestehen der Beschwerden nach 4 bis 6 Wochen zum Einsatz kommen.</p> <h2>Therapie des akuten unspezifischen Kreuzschmerzes</h2> <p>Neben der medikamentösen Therapie ist beim akuten Kreuzschmerz die Aufklärung der Patienten über den Verlauf der Erkrankung eine der wichtigsten Maßnahmen. Insbesondere soll darauf hingewiesen werden, dass zu 70 % eine Spontanremission innerhalb von 6 Wochen zu erwarten ist und die gewohnten Alltagsaktivitäten einschließlich der Arbeit beibehalten werden sollen. Bettruhe soll vermieden werden.<br /> Als Pharmakotherapie kommen in erster Linie NSAR zur Anwendung (wobei als Behandlungsdauer maximal 2 Wochen empfohlen wird), Opioide und Muskelrelaxanzien erst in zweiter Linie. Naturgemäß (fehlende Möglichkeit der Verblindung) gibt es für physikalische Therapiemodalitäten (therapeutischer Ultraschall, Elektrotherapie, Packung, Massage, Bewegungstherapie) in dem herangezogenen Evidenzgrad nur wenige Studien, was aber nicht die Unwirksamkeit dieser Maßnahmen bedeutet. Empfohlen wird auch Manualtherapie, die eine Effektgröße ähnlich der von NSAR hat.<br /> Der Chronifizierungsprozess wird durch spezielle psychosoziale Faktoren begünstigt (Tab. 3). Darauf zu achten ist, wenn subakuter Kreuzschmerz eingetreten ist. Somatische Faktoren müssen neu evaluiert werden, um spezifische Ursachen auszuschließen. MR kann indiziert sein.</p> <h2>Therapie des chronischen unspezifischen Kreuzschmerzes</h2> <p>Mit der Zielsetzung, Chronifizierung und Aktivitätseinschränkung hintanzuhalten, soll multidisziplinär vorgegangen werden, d.h., eine Einzelintervention wie eine ausschließlich medikamentöse Behandlung ist nicht ausreichend. Neben der Pharmakotherapie (NSAR, Opioidanalgetika, Antidepressiva und Capsaicin) wird die facettengelenksnahe und epidurale Infiltration als Probebehandlung empfohlen, obwohl noch nicht ausreichend viele Arbeiten innerhalb der betrachteten Evidenz vorliegen. Bei positivem Ansprechen auf die Infiltration liegt ein spezifischer Kreuzschmerz vor und die Behandlung soll fortgesetzt werden.<br /> Empfohlen wird die Kombinationstherapie mit physikalischen Modalitäten, aber nicht als Einzelmaßnahme: „Zur Behandlung des subakuten, chronisch rezidivierenden und chronischen Kreuzschmerzes sind Bewegungstherapie, medizinische Trainingstherapie, Rückenschule, Funktions-, Arbeitsplatztraining und Arbeitsplatzadaptierung und Massage indiziert. Auch die Kombination von – nicht aber die Anwendung der einzelnen – Modalitäten (Elektro- und Thermotherapie/Hydrotherapie/ Massage/Traktionen/Ultraschall) gilt als wirksam.“<sup>1, 4, 5</sup><br /> Empfohlen werden weiters TENS, Bewegungstherapie, medizinische Trainingstherapie, Rückenschule, Funktionsund Arbeitsplatztraining, Arbeitsplatzadaptierung sowie die Auswahl der Therapie nach klinischem Bild, Verfassung und körperlicher Belastung des Patienten. Dies gilt auch für den subakuten und chronisch rezidivierenden Kreuzschmerz. Weitere Empfehlungen betreffen die psychologische Behandlung und Psychotherapie, insbesondere bewältigungsorientierte und präventive Ansätze, lerntheoretisch- kognitiv orientierte Behandlung und Verhaltenstherapie bis hin zu multimodalen Schmerzbewältigungsprogrammen inklusive psychologischer Interventionen.<br /><br /> Weitere Maßnahmen sind Radiofrequenztherapie, Spinal-Cord-Stimulation (hier wird keine definitive Empfehlung abgegeben) und Akupunktur.<br /><br /> Bezüglich der operativen Therapie ist beim chronischen unspezifischen Kreuzschmerz keine Indikation gegeben. Sie ist spezifischen Ursachen vorbehalten. Spezifische Veränderungen, wie Metastasen, Tumoren, Bandscheibenvorfall und Modic- Läsionen, sind nicht Gegenstand dieser Leitlinie.<br /><br /> Ergänzend zur Leitlinie können in Bezug auf physikalische Kombinationsbehandlung evidenzbasierte Empfehlungen inklusive der dahinterstehenden Literatur auf www.orientierungshilfe-pmr.at eingesehen werden. Hier finden Sie geordnet nach ICD-10-Diagnosen in unterschiedlicher Granularität Empfehlungen zum Einsatz physikalischer Therapiemodalitäten, wobei die jeweilige Modalität (Art der physikalischen Therapie) mit der aktuellen Literatur und deren Empfehlungen hinterlegt ist.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Friedrich M et al: Update der evidenz- und konsensusbasierten österreichischen Leitlinien für das Management von unspezifischen Kreuzschmerzen 2011; www.aekwien. at/aekmedia/UpdateLeitlinienKreuzschmerz_2011_0212. pdf <strong>2</strong> Wenisch C: Pneumonia in Austria – clinical data and outcome in hospitalised adults. Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe „Giftiger Dienstag“, 22. Mai 2012, Wien <strong>3</strong> Wachter RM et al: Public reporting of antibiotic timing in patients with pneumonia: lessons from a flawed performance measure. Ann Intern Med 2008; 149(1): 29-32 <strong>4</strong> Pieber K et al: Combination treatment of physical modalities in the treatment of musculoskeletal pain syndromes. Eur J Transl Myol 2010, 1 (4): 157-65 <strong>5</strong> Torstensen TA et al: Efficiency and costs of medical exercise therapy, conventional physiotherapy, and self-exercise in patients with chronic low back pain. Spine 1976; 23(23): 2016-24</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Wachstumslenkende Eingriffe an der unteren Extremität
Minimalinvasive wachstumslenkende Eingriffe als Alternative zu komplexen Osteotomien oder aufwendigen Verlängerungsoperationen gehören zum Standardinstrumentarium des Kinderorthopäden. ...
Weichteilverletzungen der kindlichen Hand
Weichteilverletzungen der kindlichen Hand reichen von oberflächlichen Hautlazerationen bis hin zu tiefgreifenden Schädigungen auch funktioneller Einheiten oder neurovaskulärer Strukturen ...
Scheibenmeniskus bei Kindern und Jugendlichen
Der Scheibenmeniskus ist eine angeborene anatomische Fehlbildung, die meist den lateralen Meniskus betrifft und häufig asymptomatisch bleibt. In einigen Fällen können sich jedoch ...


