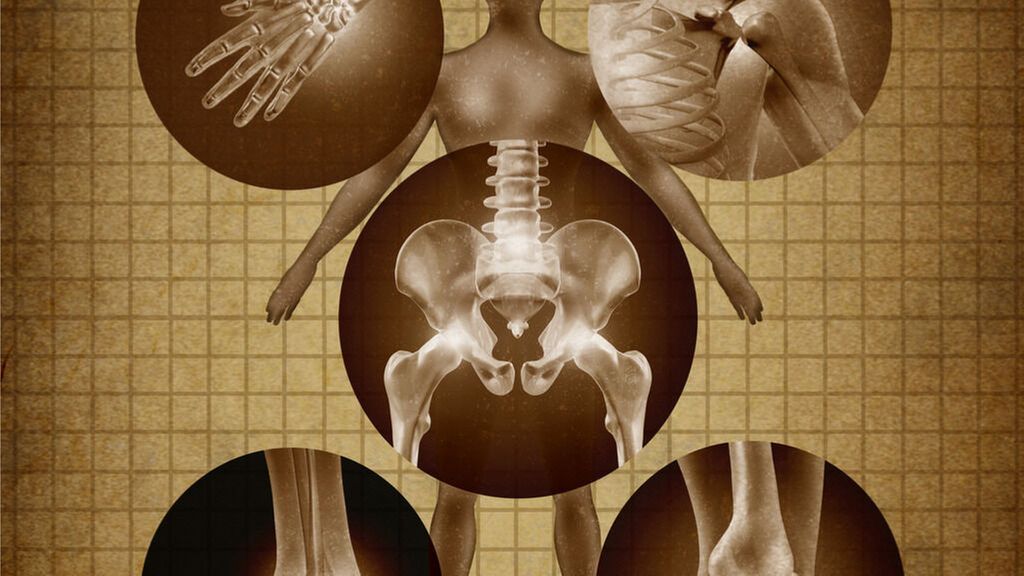
Patientenspezifische Instrumentation in der Kniegelenksendoprothetik
Jatros
Autor:
Dr. David Ullmann
Abteilung für Orthopädie, Klinikum Wels-Grieskirchen<br>E-Mail: david.ullmann@klinikum-wegr.at
30
Min. Lesezeit
12.07.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Unbestritten ist die Endoprothetik des Kniegelenks ein zentrales Themengebiet der modernen orthopädischen Chirurgie. Eine relativ neue Innovation ist die Fertigung patientenspezifischer Operationsinstrumente, mit dem Ziel, die Ergebnisse in Hinsicht auf Operationsdauer, intraoperativen Blutverlust und postoperative Funktionsparameter zu verbessern.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>An erster Stelle gilt es, die individuelle dreidimensionale Anatomie des Patienten zu vermessen. Je nach Hersteller wird hierzu eine Computer- oder eine Magnetresonanztomografie benötigt. Die gewonnenen Daten werden dem Hersteller übermittelt, welcher dann das patientenspezifische Instrumentarium, seltener eine angepasste Endoprothese liefert.</p> <h2>Vorteile</h2> <p>Von diesem Vorgehen erhofft man sich durch die Verlagerung der Planungsphase in den präoperativen Zeitraum zunächst eine wesentliche Verkürzung der Operationszeit. Im optimalen Fall entfällt die intraoperative Vermessung der Patientenanatomie, was auch die zur Operation nötige Zahl an Instrumenten deutlich verringert. Mit einer Reduktion der Operationsdauer sollten schließlich auch der Blutverlust sowie das intraoperative Infektionsrisiko minimiert werden können.<br />Große Erwartungen bestanden anfangs auch in Hinblick auf eine Verbesserung der Ergebnisse des Gelenksalignments in der Frontalebene, der Platzierung der Prothesenkomponenten und der Weichteilbalance. <br />Ein weiterer Vorteil sollte eine Verflachung der Lernkurve der Operationstechnik sein, da weniger operative Zwischenschritte nötig sind und intraoperative Entscheidungen in die Planungsphase verlagert werden.</p> <h2>Werden die Erwartungen erfüllt?</h2> <p>Die Erfahrung zeigt, dass die erhoffte intraoperative Zeitersparnis oft nicht erreicht werden kann. Besonders dann, wenn die intraoperativen Verhältnisse einen Umstieg auf ein konventionelles Instrumentarium nötig machen, ist ein hohes Maß an chirurgischer Erfahrung gefordert – dann entfällt auch der beschriebene Vorteil der flachen Lernkurve. Dies ist insofern problematisch, als ein Umstieg auf ein konventionelles Instrumentarium öfter beobachtet wurde als vermutet.<sup>1</sup><br />Die Literaturrecherche liefert weiters ein uneinheitliches Bild hinsichtlich der Verringerung des intraoperativen Blutverlustes. Hier lässt sich bei den vorgestellten Methoden kein eindeutiger Vorteil erkennen, ebenso wenig eine Ersparnis der intra- und postoperativ benötigten Blutkonserven.<sup>2</sup><br />Ein großer Kritikpunkt ist, wie zuvor bereits erwähnt, die aufwendige Vorbereitungsphase mit der Gewinnung der Patientendaten. Hier müssen die eingangs beschriebenen Vorteile gegen gewichtige Nachteile aufgewogen werden. Eine Schnittbildgebung ist in der Regel teuer und nicht überall einfach verfügbar. Handelt es sich um eine Computertomografie, nimmt man zudem im Vergleich zum konventionellen Röntgen bei der Standardendoprothetik eine deutlich höhere Strahlenbelastung in Kauf. Diese entfällt zwar bei der Magnetresonanztomografie, hier zeigen sich aber hinsichtlich der Datenqualität zur dreidimensionalen Knochenrekonstruktion große Nachteile. Darüber hinaus steigt hier der Kostenfaktor noch einmal um ein Vielfaches.<br />Eines der wichtigsten Kriterien, um den Erfolg einer endoprothetischen Versorgung beurteilen zu können, ist das Gelenksalignment in der Frontalebene. Dementsprechend hoch ist die Anzahl der Arbeiten, die sich in der Auswertung auf diesen Parameter konzentrieren. Bis dato konnte hier bei keinem System ein Vorteil gegenüber konventionellen Endoprothesen beobachtet werden.<br />Generell zeigen sich bei der Auswertung der vorliegenden Literatur im Detail Probleme bei der Vergleichbarkeit der Studien aufgrund kleiner Fallzahlen, verschiedener Hersteller sowie unterschiedlicher Messmethoden. Ungeklärt bleibt etwa, ob Vorteile hinsichtlich der Rotation der Komponenten bestehen. Zudem liegen besonders wenige Untersuchungen zu funktionellen Ergebnissen und zur Patientenzufriedenheit vor.<br />Auch wir können mit unserer Erfahrung alle diese Beobachtungen bestätigen. Wir haben an unserer Klinik im Rahmen einer Studie an 29 Patienten zwei Systeme verschiedener Hersteller getestet und prospektiv im Vergleich mit einer Kontrollgruppe in Hinsicht auf Operationsdauer, intraoperativen Blutverlust und Alignment in der Frontalebene ausgewertet. Zusätzlich haben wir etablierte Scores zur Bestimmung der Funktion und des Schmerzlevels erhoben. Über einen Nachbehandlungszeitraum von mittlerweile 7 Jahren konnten wir bei keinem der erwähnten Parameter einen Vorteil in der Gruppe der Patienten feststellen, die mit patientenspezifischen Systemen versorgt wurden.</p> <h2>Fazit</h2> <p>Die Knieendoprothetik der aktuellen Generation zeichnet sich durch ein geringes Maß an perioperativen Komplikationen aus. Da patientenspezifische Techniken am zugrunde liegenden Prinzip der Operationstechniken wenig ändern, ist eine Reduktion der Komplikationsrate nicht zu erwarten, was in vielen Einzelarbeiten und Metaanalysen<sup>3</sup> auch gezeigt werden konnte. Zur Beurteilung der Nützlichkeit dieser Innovation muss der Fokus also auch auf die wirtschaftlichen Aspekte gelegt werden. Hier zeigt sich, dass das erhoffte Einsparungspotenzial nicht erreicht wird,<sup>4</sup> oftmals sogar eine Verteuerung des Behandlungsprozesses festgestellt werden kann.<br />Angesichts dieser Erkenntnisse ergibt sich für uns keine Empfehlung, patientenspezifische Techniken im Routinebetrieb einzusetzen. Natürlich verbleiben denkbare Anwendungsszenarien, beispielsweise wenn eine intramedulläre Ausrichtung bei posttraumatischen Femurdeformitäten nicht möglich ist.<sup>5</sup> Spannend und offen bleibt natürlich, ob diese Einschätzung im Zuge von Langzeitbeobachtungen noch revidiert werden muss.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Stronach BM et al.: Patient-specific total knee arthroplasty required frequent surgeon-directed changes. Clin Orthop Relat Res 2013; 471(1): 169-74 <strong>2</strong> Chareancholvanic K et al.: A prospective randomised controlled study of patient-specific cutting guides compared with conventional instrumentation in total knee replacement. Bone Joint J 2013; 95-B(3): 354-9 <strong>3</strong> Sassoon AA et al.: Systematic review of patient-specific instrumentation in total knee arthroplasty: new but not improved. Clin Orthop Relat Res 2015; 473(1): 151-8 <strong>4</strong> Nunley RM et al.: Are patient-specific cutting blocks cost-effective for total knee arthroplasty? Clin Orthop Relat Res 2012; 470(3): 889-94 <strong>5</strong> Mattei L et al.: Patient specific instrumentation in total knee arthroplasty: a state of the art. Ann Transl Med 2016; 4(7): 126</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Wachstumslenkende Eingriffe an der unteren Extremität
Minimalinvasive wachstumslenkende Eingriffe als Alternative zu komplexen Osteotomien oder aufwendigen Verlängerungsoperationen gehören zum Standardinstrumentarium des Kinderorthopäden. ...
Weichteilverletzungen der kindlichen Hand
Weichteilverletzungen der kindlichen Hand reichen von oberflächlichen Hautlazerationen bis hin zu tiefgreifenden Schädigungen auch funktioneller Einheiten oder neurovaskulärer Strukturen ...
Scheibenmeniskus bei Kindern und Jugendlichen
Der Scheibenmeniskus ist eine angeborene anatomische Fehlbildung, die meist den lateralen Meniskus betrifft und häufig asymptomatisch bleibt. In einigen Fällen können sich jedoch ...


