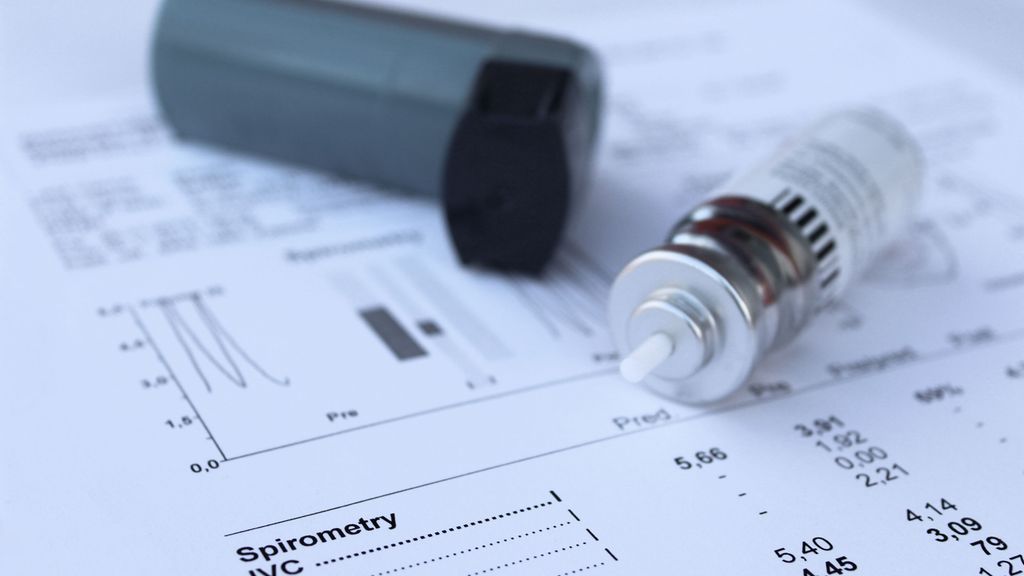
©
Getty Images/iStockphoto
Der Pleuraerguss – Ursachen und Diagnostik
Leading Opinions
Autor:
Dr. med. Michael Huber, MBA
Facharzt Innere Medizin (FMH), Pneumologie (FMH), Somnologie (SGSSC), Allergologie (D) Kaderarzt Pneumologie<br/> GZO Spital Wetzikon<br/> Spitalstrasse 66<br/> 8620 Wetzikon<br/> E-Mail: michael.huber@gzo.ch
30
Min. Lesezeit
16.05.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der Pleuraerguss ist eine pathologisch vermehrte Ansammlung von Flüssigkeit im Pleuraraum, welcher sich einseitig oder beidseitig manifestieren kann. Die Inzidenz ist hoch und beträgt ca. 400/100 000. Die möglichen Ursachen eines Pleuraergusses sind mannigfaltig. Sowohl Allgemeinmediziner und Internisten als auch viele Spezialisten sind mit dieser Krankheitsmanifestation regelhaft konfrontiert. Deshalb lohnt es sich, sich mit dieser Thematik genauer zu beschäftigen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Ein Pleuraerguss kann infolge verschiedenster Erkrankungen auftreten. Die häufigsten Ursachen sind Herzinsuffizienz (ca. 1/3 aller Fälle), ein parapneumonisches Geschehen, maligne Erkrankungen oder eine Lungenembolie.</li> <li>Eine diagnostische Pleurapunktion ist regelhaft durchzuführen. Die Verwendung der Sonografie bei der Punktion ist Standard.</li> <li>Routineanalysen aus dem Pleurapunktat umfassen Gesamteiweiss, LDH, Zellverteilung, pH, Grampräparate, Bakterienkulturen sowie die zytopathologische Beurteilung.</li> <li>Kann nach wiederholter Punktion die Ätiologie des Pleuraergusses nicht geklärt werden, soll eine Pleurabiopsie mittels Thorakoskopie angestrebt werden.</li> </ul> </div> <h2>Physiologie</h2> <p>Der Pleuraraum wird begrenzt durch zwei Membranen: die Pleura parietalis, die die Thoraxwand und das Zwerchfell auskleidet, und die Pleura visceralis, die die Lunge umgibt. Die viszerale Pleura unterstützt die Formgebung der Lunge und hilft, dass die Lunge sich nicht zu sehr ausdehnt. Ausserdem trägt sie dazu bei, dass es zu keiner raschen «Überdehnung» in den peripheren Alveolen kommt. Dadurch soll ein leichtes Einreissen der Alveolen in der Lungenperipherie mit Ausbildung eines Pneumothorax vermieden werden. Jede Pleuramembran besteht aus einer einlagigen Schicht von Mesothelzellen auf einer Bindegewebsschicht aus Kollagen und Elastin. Die Mesothelzellen haben vielfältige Funktionen. Sie können fibrinolytische und prokoagulatorische, aber auch neutrophile und chemotaktische Substanzen sezernieren. Die Pleuramembran ist durchlässig für Flüssigkeit und Proteine. Die physiologische Pleuraflüssigkeitsmenge beträgt ca. 18 ml pro Lungenseite. Sie ermöglicht das Gleiten der Lungenoberfläche gegenüber der Thoraxinnenwand während der Inund Exspiration. Der physiologische Druck im Pleuraspalt in Atemmittellage, gemessen auf mittlerer Thoraxhöhe, ist negativ und beträgt −5 cm H<sub>2</sub>O. Die Pleuraflüssigkeit ist leicht alkalisch und hat im Vergleich zum Serum einen deutlich geringeren Eiweissgehalt: Das physiologische Pleura-/Serumprotein-Verhältnis beträgt 0,15. Es besteht ein kontinuierlicher, langsamer Austausch von Pleuraflüssigkeit. Pro Tag werden ca. 12 ml Pleuraflüssigkeit über die Pleuramembran, überwiegend über das parietale Pleurablatt, filtriert und über die Lymphbahnen der parietalen Pleura, welche Mikrovilli mit Mikroporen besitzen, wieder rückresorbiert (Abb. 1). Das gesunde Lymphsystem kann seine Rückresorptionsfähigkeit bis auf das 20-Fache steigern. Somit kommt es bei intaktem Lymphdrainagesystem erst dann zu einem klinisch manifesten Pleuraerguss, wenn die tägliche Filtrationsmenge 240 ml (20 x 12 ml) pro Tag überschreitet.<sup>1</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Innere_1902_Weblinks_a2-abb1.jpg" alt="" width="684" height="886" /></p> <h2>Pathophysiologie des Pleuraergusses</h2> <p><strong>• Intakte Pleuramembran: Transsudatbildung</strong><br /> Die Filtrationsrate kann erhöht sein durch einen erhöhten Filtrationsdruck im Rahmen einer Herzinsuffienz oder aufgrund einer verminderten onkotischen Druckdifferenz bei Hypoproteinämie (z. B. beim nephrotischen Syndrom).</p> <p><strong>• Gestörte Pleuramembran: Exsudat</strong><br /> Kommt es z. B. durch eine Entzündung oder einen Tumor zu einer signifikanten Störung der Barrierefunktion und somit zu einer gesteigerten Permeabilität der Pleura, kann eiweissreiche Flüssigkeit aus dem Lungeninterstitium in den Pleuraraum übertreten.</p> <p><strong>• Verschiebung von Flüssigkeit aus anderen Körperkompartimenten in den Pleuraraum:</strong><br /> Es kann z. B. Aszitesflüssigkeit aus dem Bauchraum durch die physiologisch präformierten Zwerchfellöffnungen oder via Mikroporen des Zwerchfelles in den Pleuraraum übertreten.</p> <p><strong>• Verminderte Rückresorptionsfähigkeit der Lymphbahnen:</strong><br /> Ist die Rückresorptionsfähigkeit der Lymphgefässe der parietalen Pleura bedingt durch eine Lymphabflussstörung gestört, wie z. B. bei Lymphomen oder beim Yellow-Nail-Syndrom, kann sich ebenfalls ein Pleuraerguss ausbilden (Tab. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Innere_1902_Weblinks_a2-tab1.jpg" alt="" width="358" height="839" /></p> <h2>Diagnostik des Pleuraergusses</h2> <p><strong>Anamnese und klinisches Bild</strong><br /> Die Anamnese einschliesslich Berufs-, Reise- und Medikamentenanamnese kann bereits wertvolle Hinweise auf die Genese eines Pleuraergusses geben. So ist beispielsweise bei einem Patienten mit ausgeprägtem Nikotinabusus, vorangegangener Asbestexposition, thorakalen Schmerzen und hämorrhagischem Erguss in erster Linie an eine Pleurakarzinose bei Bronchialkarzinom oder Mesotheliom zu denken. Klinisch präsentiert sich der Patient mit Pleuraerguss oft mit Atemnot, thorakalem Druckgefühl und pleuritischen Schmerzen. Selten beklagt er auch in die Flanke ausstrahlende Schmerzen. Die Schmerzen können atemabhängig oder konstant sein. Häufig wird die klinische Beschwerdesymptomatik dominiert von der zugrunde liegenden Erkrankung.</p> <p><strong>Bildgebung</strong><br /> Im konventionellen Thoraxröntgenbild lässt sich ein Pleuraerguss ab einer Menge von ca. 75 ml im seitlichen Strahlengang bzw. ab ca. 175 ml im posteroanterioren Strahlengang detektieren. Deutlich sensitiver und spezifischer ist die Sonografie. Kleine Randwinkelergüsse können bereits ab einer Menge von 30–50 ml diagnostiziert werden. Aufgrund ihrer hohen Sensitivität und Spezifität, der weit verbreiteten Verfügbarkeit, der niedrigen Kosten und der fehlenden Strahlenbelastung ist die Sonografie die Untersuchungsmethode der ersten Wahl. Die Computertomografie ist ebenfalls eine sehr sensitive und spezifische Untersuchungsmethode. Die Durchführung der Thorax-CT mit Kontrastmittel ist im Abklärungsalgorithmus jedoch nachgeordnet. In der Regel sollte eine CT erst dann veranlasst werden, wenn mittels Sonografie und Probepunktion ein Transsudat bereits ausgeschlossen worden ist.</p> <p><strong>Pleurapunktion</strong><br /> Es wird empfohlen, jeden Pleuraerguss mittels Probepunktion weiter abzuklären. Ausgenommen davon sind Patienten mit dem klassischen klinischen Bild einer dekompensierten Herzinsuffizienz mit meist rechtsseitigem oder bilateralem Pleuraerguss, sofern es keinen Hinweis (Fieber, CRP-Erhöhung, thorakale Schmerzen) auf eine andere mögliche Genese gibt.<sup>2</sup> Die wichtigsten möglichen Komplikationen einer diagnostischen Pleurapunktion sind der Pneumothorax und das Auftreten von Blutungen. Wesentliche Parameter, die die Komplikationsrate beeinflussen, sind erstens die konsequente Verwendung der Sonografie zur exakten Lokalisation der Punktionsstelle und zweitens die Erfahrung des Untersuchers in der Technik der Pleurapunktion.<sup>2</sup> Als Richtwerte, um eine Pleurapunktion mit vertretbarem Risiko durchführen zu können, gelten ein Thrombozytenwert von mindestens 50 000 G/l und ein INR < 1,5.<sup>3</sup> Eine bestehende Monotherapie mit einem Thrombozytenaggregationshemmer (z. B. Acetylsalicylsäure oder Clopidrogel) stellt keine Kontraindikation für eine diagnostische oder therapeutische Pleurapunktion dar.<sup>4</sup> Besteht eine doppelte Thrombozytenaggregationshemmung, ist mit einem erhöhten Blutungsrisiko zu rechnen. Die Entscheidung, trotz doppelter Plättchenaggregationshemmung eine Pleurapunktion durchzuführen, ist unter Abwägen des Nutzen-Risiko-Verhältnisses individuell zu treffen. Die Punktion sollte dann auf jeden Fall von einem sehr erfahrenen Untersucher durchgeführt werden. Die Verwendung der Sonografie ist obligat. Nicht nur das B-Bild, sondern auch der Farbdoppler zur Detektion möglicher aberrierender interkostaler Gefässe soll verwendet werden. Am besten erfolgt die Punktion unter sonografischer Sicht (Real-Time-Modus).</p> <p><strong>Ätiologie des Pleuraergusses</strong><br /> Die erste Beurteilung des Pleurapunktats erfolgt anhand des Geruchs, der Farbe und des Aussehens (Abb. 2). Ein stark trübes Punktat, das nach faulen Eiern riecht, ist hoch verdächtig auf einen durch anaerobe Bakterien bedingten parapneumonischen Erguss. Ein klares gelbes Punktat, welches nach Urin riecht, lässt in erster Linie an einen Urinothorax denken.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Innere_1902_Weblinks_a2-abb2.jpg" alt="" width="683" height="424" /></p> <p>Light-Kriterien: das Konzept Transsudat – Exsudat<br /> Um die Ätiologie grob einordnen zu können, hat sich seit knapp einem halben Jahrhundert die Unterteilung des Pleuraergusses in Transsudat oder Exsudat bewährt. Dazu müssen im Pleurapunktat und im Serum der Protein- und der LDH-Gehalt bestimmt und die Messwerte des Pleurapunktats ins Verhältnis zu den Messwerten im Serum gesetzt werden (Tab. 2). Ein Transsudat kann kardial (z. B. Herzinsuffizienz), durch eine Leberzirrhose, eine Hypoproteinämie, ein nephrotisches Syndrom oder selten durch einen Urinothorax bedingt sein. Zusätzlich zur LDH- und Proteinbestimmung sollten im Pleuraerguss routinemässig die Zellverteilung (polymorphkernig – lymphozytär – eosinophil) und der pH-Wert (mittels Blutgasanalysator) bestimmt werden und eine zytologische sowie mikrobiologische Untersuchung (Grampräparat und Bakterienkultur) erfolgen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Innere_1902_Weblinks_a2-tab2.jpg" alt="" width="682" height="246" /></p> <p>Zellverteilung<br /> Ein Pleurapunktat mit einem Lymphozytengehalt von mehr als 50 % findet man häufig bei der tuberkulösen Pleuritis, aber auch bei malignen Erkrankungen, Kollagenosen oder Rheuma. Eine starke Neutrophilie weist meist auf ein parapneumonisches Geschehen hin. Aber auch der durch eine Lungenembolie bedingte Pleuraerguss ist oft neutrophil. Eine Vermehrung der eosinophilen Zellen (> 10 %) ist oft unspezifisch, kann jedoch auf einen rheumatisch oder einen medikamentös induzierten Pleuraerguss hinweisen (Hypersensitivitätsreaktion). Medikamente, bei welchen ein Pleuraerguss als seltene unerwünschte Arzneimittelnebenwirkung beschrieben wurde, sind u. a.: Hydralazin, Infliximab, Nitrofurantoin, TNF-alpha-Inhibitoren, IL2-Inhibitoren, Dasatinib, Phenytoin, Dantrolen (siehe auch: www.pneumotox.com).</p> <p>Bestimmung des pH-Wertes<br /> Die Bestimmung des pH ist relevant bei der Frage nach einem parapneumonischen Erguss/Pleuraempyem. pH-Werte ≤ 7,2 weisen auf einen komplizierenden parapneumonischen Erguss oder ein Pleuraempyem hin. Somit hilft der pH bei der Entscheidung hinsichtlich des weiteren therapeutischen Procederes: Abpunktieren des Pleuraergusses, Einlegen einer Thoraxdrainage oder VATS (Video-assistierte Thorakoskopie) bei Verdacht auf ein Pleuraempyem.</p> <p>Pathologie Das Pleurapunktat soll immer auch pathologisch untersucht werden. Der Pathologe erhält minimal 50 ml, besser 500– 1000 ml Flüssigkeit zur Analyse.<br /> Besteht bei negativer Pleurazytologie (keine malignen Zellen) klinisch weiterhin der Verdacht auf ein malignes pleurales Geschehen, macht eine zweite Punktion zu einem späteren Zeitpunkt Sinn, da sich dadurch die Sensitivität der Pleurazytologie steigern lässt. Die Wahrscheinlichkeit, eine Pleurakarzinose mithilfe einer Pleurazytologie aus dem Erguss zu diagnostizieren, ist auch von der zugrunde liegenden Erkrankung abhängig. So finden sich bei einer Pleurakarzinose bei Adenokarzinom der Lunge in ca. 70 % der Fälle maligne Zellen im Pleuraerguss, während beim Mesotheliom nur in 10–20 % maligne Zellen gefunden werden, sodass hier oft eine Thorakoskopie zur definitiven Diagnostik erforderlich ist.<sup>9, 10</sup></p> <p>Erweiterte Diagnostik des Pleurapunktates<br /> In Abhängigkeit von der Anamnese, der makroskopischen Beurteilung des Punktats und der klinischen Konstellation können weitere Analysen hilfreich sein. Bei Tuberkuloseverdacht sollten säurefeste Stäbchen gesucht, eine PCR für Tbc und Kulturen für Mykobakterien gemacht sowie die Adenosin-Deaminase (ADA) bestimmt werden. Ein lymphozytärer, exsudativer Pleuraerguss mit erhöhter ADA (> 40 U/l) ist bei entsprechender Vortestwahrscheinlichkeit (Anamnese, Herkunft) mit hoher Wahrscheinlichkeit tuberkulöser Natur.<br /> Ein Glukosewert < 2,2 mmol/l und/oder ein pH-Wert ≤ 7,2 und/oder ein positives Grampräparat sprechen für das Vorliegen eines komplizierenden parapneumonischen Pleuraergusses oder eines Pleuraempyems.<br /> Wenn die Amylase-Werte im Pleurapunktat höher sind als der Serumamylasewert, deutet dies auf eine pankreatogene Ursache des Pleuraergusses hin (z. B. Pankreatitis, Pankreaskarzinom, Pankreaspseudozysten, Ösophagusruptur).<br /> Hat der Pleuraerguss ein «café au lait»-farbiges Aussehen und sind die Triglyzeride erhöht (> 1,24 mmol/l) und Chylomikronen im Pleuraerguss nachweisbar, spricht dies für einen Chylothorax. Ist das Cholesterin erhöht (> 5,18 mmol/l) und sind Cholesterinkristalle nachweisbar, weist dies auf einen Pseudochylothorax hin.<br /> Ein Urinothorax ist anzunehmen, wenn das Kreatinin im Pleuraerguss höher ist als im Serum (kann beim Urinothorax bis auf das 100-Fache des Serumwertes erhöht sein).<sup>5</sup> Falls der Hämatokrit im Pleurapunktat > 50 % des Bluthämatokrits beträgt, handelt es sich um einen Hämatothorax.<br /> Neben diesen im klinischen Alltag gut etablierten Parametern kann noch eine Vielzahl weiterer Analysen aus dem Pleurapunktat durchgeführt werden, wie z. B. NT-proBNP bei Herzinsuffizienz, antinukleäre Faktoren, Komplement C3, C4, Rheumafaktor bei Erkrankungen aus dem rheumatischen, autoimmunen Formenkreis oder CEA, CA 15-3, Cyfra 21-1, Mesothelin und VEGF («vascular endothelial growth factor») bei Tumorerkrankungen.<br /> Bei der Anwendung des Transsudat-Exsudat- Konzeptes nach Light können auch Fehlklassifikationen vorkommen. Der durch Herzinsuffizienz verursachte Pleuraerguss kann sich anstatt als Transsudat auch als Exsudat präsentieren, insbesondere nach vorausgegangener diuretischer Therapie. Bei dieser Konstellation kann die Bestimmung von NT-proBNP im Pleuraerguss hilfreich sein.<sup>2, 6, 7</sup> Ein erhöhter NT-proBNP-Wert im Pleuraerguss (> 1500 pg/ml) hat eine sehr gute Sensitivität und Spezifität für das Vorliegen einer Herzinsuffizienz. In der Regel wird man jedoch auf diese Zusatzinformation (auch aus Kostengründen) verzichten können. Erhöhte Tumormarker im Pleuraerguss können einen Hinweis auf die Genese des Ergusses geben.8<sup>, 9</sup> Allerdings sind bislang die Sensitivität und Spezifität dieser Werte nicht ausreichend hoch, um dem Patienten beispielsweise eine erforderliche Pleurabiopsie ersparen zu können. Daher haben diese Parameter bislang keinen Eingang in den klinischen Alltag gefunden.</p> <p><strong>Merke:</strong><br /> Wurde auch nach wiederholter diagnostischer Pleurapunktion keine Ursache gefunden, so ist in der Regel eine Pleurabiopsie mittels Thorakoskopie (medizinisch oder chirurgisch) anzustreben. Nur in seltenen Einzelfällen kann 4–6 Wochen abgewartet werden, da auch eine Spontanremission eines Pleuraergusses auftreten kann. Diese Entscheidung soll im klinischen Kontext individuell und interdisziplinär getroffen werden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Feller Kopman D, Light R: Pleural Disease. N Engl J Med 2018; 378: 740-751 <strong>2</strong> Hooper C et al.: Investigation of a unilateral pleural effusion in adults. Thorax 2010; 65(Suppl 2): ii4eii17. <strong>3</strong> Havelock T et al.: Pleural procedures and thoracic ultrasound: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax 2010; 65(Suppl 2): ii61-76. <strong>4</strong> Dammert P: Safety of ultrasound-guided small-bore chest tube insertion in patients on clopidogrel. J Bronchology Interv Pulmonol 2013; 20: 16-20 <strong>5</strong> Toubes ME: Urinothorax: a systematic review. J Thorac Dis 2017; 9: 1209-1218 <strong>6</strong> Janda S et al.: Diagnostic accuracy of pleural fluid NT-pro-BNP for pleural effusions of cardiac origin: a systematic review and meta-analysis. BMC Pulmonary Medicine 2010; 10: 58 <strong>7</strong> Zhi-Jun Han et al.: Diagnostic accuracy of natriuretic peptides for heart failure in patients with pleural effusion: a systematic review and updated meta-analysis. PLoS One 2015; 10: e0134376 <strong>8</strong> Fafliora E et al.: Systematic review and meta-analysis of vascular endothelial growth factor as a biomarker for malignant pleural effusions. Physiol Rep 2016; 4: pii: e12978 <strong>9</strong> Froudarakis ME et al.: Pleural effusion in lung cancer: more questions than answers. Respiration 2012; 83: 367-376 <strong>10</strong> Light R. Pleural Effusion. N Engl J Med, 2002; 346: 1971-1977</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Chronische Atemwegserkrankungen in einem sich verändernden Klima
Die global steigenden Temperaturen und zunehmenden Hitzewellen haben einen negativen Einfluss auf die Luftqualität, vor allem in Städten. Die Atemwege und die Lunge als Eintrittspforten ...
Pathobiologie und Genetik der pulmonalen Hypertonie
Für die 7. Weltkonferenz für pulmonale Hypertonie (World Symposium on Pulmonary Hypertension; WSPH) 2024 beschäftigten sich zwei Task-Forces aus 17 internationalen Experten allein mit ...


