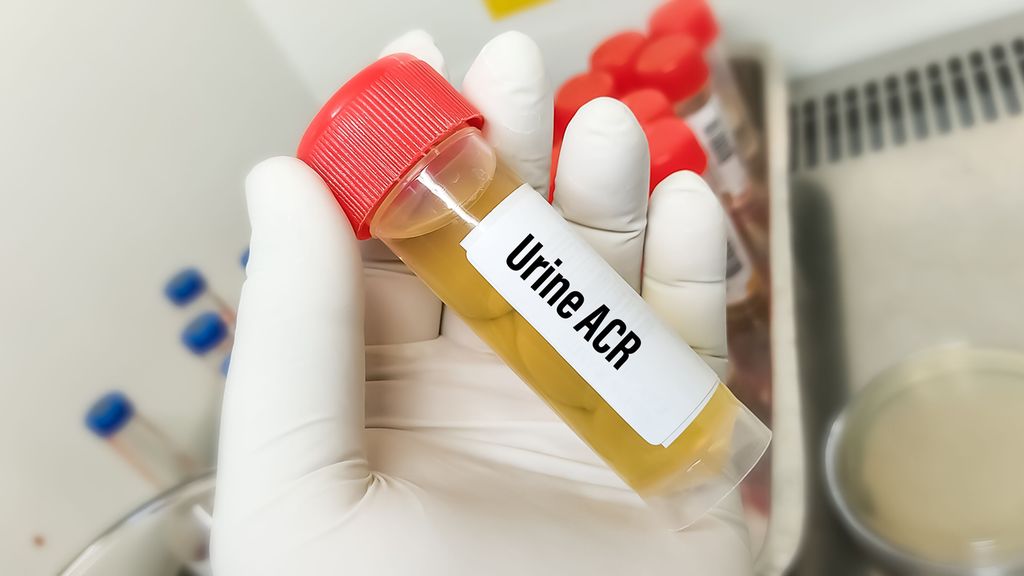
Diabetes und Niere
Bericht:
Regina Scharf, MPH
Redaktorin
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die Mikroalbuminurie ist der erste Hinweis auf eine diabetische Nephropathie und sollte frühzeitig erkannt werden. Die Quantität gibt zusammen mit der glomerulären Filtrationsrate Auskunft über die Nierenschädigung und die Prognose und beeinflusst die Auswahl an antidiabetischen Therapien.
Mit der weltweiten Zunahme des Diabetes mellitus (DM) nimmt auch die Häufigkeit von diabetischen Nephropathien zu. «Prozentual gesehen ist der Anteil aber gleich geblieben», sagte Prof. Dr. med. Peter Wiesli, Chefarzt Innere Medizin am Kantonsspital Frauenfeld am Diabetes Update Refresher. Im schlimmsten Fall führt der Diabetes bei den Betroffenen zu einer terminalen Nierenerkrankung («end stage renal disease», ESRD) und zur Dialysepflicht. Bei dieser Konstellation ist das Sterberisiko im Vergleich zu Gesunden um das 100-Fache erhöht und die 1-Jahres-Mortalität beträgt 27%.
Die diabetische Nephropathie äussert sich klinisch durch eine Mikroalbuminurie (MAU) und im weiteren Verlauf durch das Auftreten einer arteriellen Hypertonie und einen Kreatininanstieg. Da die Diagnose eines DM Typ 2 oft mit mehrjähriger Verspätung erfolgt, empfehlen die Guidelines, die Betroffenen bei der Diagnosestellung auf eine MAU zu screenen.1 Bei einem negativen Testergebnis sollte die Untersuchung jährlich wiederholt werden. Für Patienten mit einem DM Typ 1 wird das Albumin-Screening generell nach einer Krankheitsdauer von 5 Jahren empfohlen. Bei Erwachsenen mit einem «late onset autoimmune diabetes» (LADA) und Personen mit zusätzlichen Risikofaktoren sollte das Screening schon früher durchgeführt werden. Die MAU gilt als bestätigt, wenn innerhalb von 6 Monaten mindestens 2 von 3 Urinproben positiv sind.
Anstelle des aufwendigen 24-Std.-Sammelurins wird zur Quantifizierung der Albuminurie die Albumin-Kreatinin-Ratio (ACR) herangezogen. Die Albuminausscheidung ist normal bei einer ACR <3mg/mmol, eine ACR von 3–30mg/mmol weist auf eine Mikroalbuminurie und eine ACR >30mg/mmol auf eine Makroalbuminurie hin. Um mithilfe der KDIGO-CKD-Klassifikation das Stadium der chronischen Nierenerkrankung (CKD) und die zu erwartende Krankheitsprogression einzuschätzen, muss zusätzlich die glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) geschätzt werden.2 Am häufigsten wird dazu die CKD-EPI-Formel eingesetzt.
Eingeschränkte Therapieoptionen bei schwerer Niereninsuffizienz
Die Nierenfunktion hat einen grossen Einfluss auf die Wahl und Dosierung der Antidiabetika. Bei einer eGFR zwischen 30 und 45ml/min/1,73m2 (KDIGO-Stadium G3b) beträgt die max. Metformindosis 2x 500mg/d, bei einer eGFR <30ml/min/1,73m2 (G4) muss die Einnahme gestoppt werden. «Wichtig ist, daran zu denken, dass Metformin ein häufiger Bestandteil von Kombinationspräparaten ist», sagte der Spezialist. Ab dem KDIGO-Stadium G4 wird die antidiabetische Therapie übersichtlich. Weiterhin eingesetzt werden können DPP-4-Inhibitoren (DPP-4-I), GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA) und Insulin. In spezifischen Situationen ist eine Therapie mit Repaglinid und Pioglitazon möglich. Bei Letzterem ist wegen schwerer unerwünschter Wirkungen wie u.a. Flüssigkeitsretention Vorsicht geboten.
«DPP-4-I sind beliebte und immer noch häufig eingesetzte Antidiabetika», so der Endokrinologe. Sie führen zu einer effektiven Blutzuckersenkung, verursachen keine Hypoglykämien und sind auch sonst nebenwirkungsarm. Der fehlende Zusatznutzen im Vergleich zu den SGLT2-I und GLP-1-RA hat jedoch zu einem Rückgang bei den Neuverordnungen geführt. Die Dosis der DPP-4-I muss mit Ausnahme von Linagliptin bei Patienten mit einer CKD angepasst werden.
Die antidiabetische Wirkung der SGLT2-I basiert auf der Ausscheidung von Glukose über die Nieren. Dieser Mechanismus funktioniert bis zu einer eGFR von 45ml/min/1,73m2. Unterhalb dieses Wertes haben die SGLT2-I keine blutzuckersenkende Wirkung, die kardio- und nephroprotektiven Effekte bleiben aber erhalten.
Eine Besonderheit der GLP-1-RA ist, dass sie täglich oder wöchentlich subkutan verabreicht werden. Seit einiger Zeit ist mit Semaglutid auch ein oraler GLP-1-RA verfügbar. Die Substanzen zeigen ebenfalls einen kardio- und nephroprotektiven Effekt. Die Nephroprotektion ist allerdings geringer ausgeprägt als bei den SGLT2-I.
«Die SGLT2-I und GLP-1-RA sind heute nach Metformin die primär empfohlenen Medikamente zur Diabetestherapie», sagte Wiesli. Bei einer stark eingeschränkten Nierenfunktion (eGFR <30ml/min/1,73 m2) sollte den GLP-1-RA der Vorzug vor DPP-4-I gegeben werden. Eine mögliche Therapieoption bei DM und schwerer CKD ist auch die Behandlung mit Insulin. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass der Insulinbedarf bei einer Niereninsuffizienz reduziert ist. «Um bei diesen Patienten Hypoglykämien zu vermeiden, sollte das HbA1c-Ziel etwas höher gewählt werden», lautete der Tipp des Spezialisten.
Quelle:
FomF Diabetes Update Refresher, 4. bis 6. November 2021, Zürich
Literatur:
1 Gross JL et al.: Diabetic nephropathy: diagnosis, prevention, and treatment. Diabetes Care; 2005; 28: 164-76 2Stevens PE, Levin A: Evaluation and management of chronic kidney disease: synopsis of the kidney disease: improving global outcomes 2012 clinical practice guideline. Ann Inter Med 2013; 158: 825-30
Das könnte Sie auch interessieren:
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...
Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil
Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...


