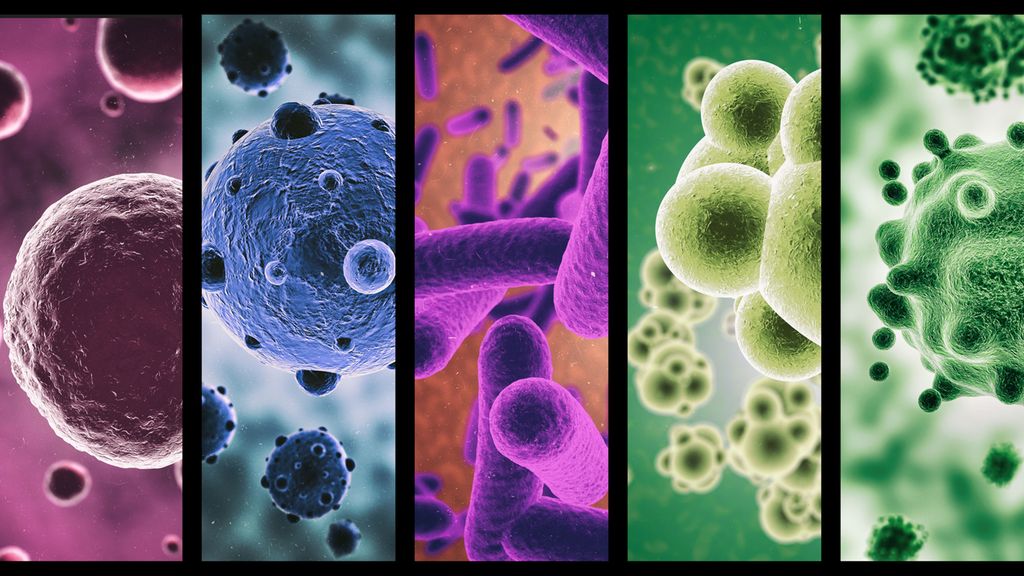
©
Getty Images/iStockphoto
Antibiotikum ja oder nein?
Jatros
30
Min. Lesezeit
12.06.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In einer Pro/Contra-Sitzung wurden drei Situationen diskutiert, bei denen der Einsatz von Antibiotika nicht ganz unumstritten ist. An den Vorträgen und Diskussionsbemerkungen erwies sich der Unterschied zwischen Leitlinien und der täglichen klinischen Praxis.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Positive Harnkultur</h2> <p><strong>Pro</strong><br /> „Zunächst muss natürlich eine Indikation für die Durchführung einer Harnkultur vorliegen“, begann OÄ Dr. Sabine Mair, Universitätsklinik für Innere Medizin II, MedUni Innsbruck, ihr Plädoyer. Wichtig ist, dass Symptome vorliegen, die sich mit einem Harnwegsinfekt (HWI) vereinbaren lassen (z.B. Dysurie, Algurie, Pollakisurie, imperativer Harndrang). Aber auch rezidivierende HWI oder fehlende Besserung auf antibiotische Behandlung können Kulturindikationen sein.</p> <p>Wenn Symptome vorliegen, die zum HWI passen bzw. ihm zugeordnet werden können, und wenn die Harnkultur positiv ist, so liegt per definitionem ein symptomatischer HWI vor, und der Patient sollte antibiotisch behandelt werden.</p> <p>Schwieriger wird die Situation bei asymptomatischer Bakteriurie. Hier gab es bisher zwei Indikationen zur Therapie: die Schwangerschaft und den geplanten Eingriff an der Prostata. Für Letzteren gilt die Behandlungsindikation nach wie vor. Die Indikation Schwangerschaft wurde hingegen durch neuere Daten eher infrage gestellt. Im Gegensatz zu Österreich wird in manchen Ländern (Deutschland, Niederlande) in der Schwangerschaft kein Harnscreening mehr empfohlen.</p> <p><strong>Contra</strong><br />„Der HWI ist die zweithäufigste Infektionskrankheit und macht ca. 1 % aller Hausarztbesuche aus – bei hoher Dunkelziffer. Wollten wir alle diese Patienten antibiotisch behandeln, wäre das eine extrem hohe Antibiotikalast“, argumentierte Dr. Matthias Vossen, Klinische Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin, Med- Uni Wien. Damit steigt auch die Gefahr von Resistenzentwicklung.</p> <p>Neben der asymptomatischen Bakteriurie, bei der ohnehin zumeist keine Therapieindikation besteht, plädiert Vossen auch gegen die Behandlung des unkomplizierten, symptomatischen HWI. Dieser ist in der Regel selbstlimitierend. Und es gibt Daten, die zeigen, dass ein Großteil der HWI auch unter rein analgetischer Therapie abheilt. Zudem scheint auch der Harntrakt nicht – wie früher angenommen – steril zu sein, sondern ein eigenes Mikrobiom zu besitzen. Das würde auch erklären, warum die HWI-Rezidivrate nach antibiotischer Therapie höher ist als ohne. Jede antibiotische Therapie stört das lokale Mikrobiom und reduziert seine Diversität.</p> <h2>Streptokokken in Hals und Ohr</h2> <p><strong>Pro</strong><br /> „Die Erreger der akuten Otitis media, kurz AOM, sind zwar meist Viren, aber zum Teil auch Bakterien, und hier spielen Streptokokken – vor allem Pneumokokken und Streptococcus pyogenes – eine gewisse Rolle“, erläuterte Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Volker Strenger, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, MedUni Graz.</p> <p>Wichtig ist die exakte Diagnose – nicht jedes gerötete Trommelfell bedeutet eine AOM. Ebenso bedeutet nicht jedes Stippchen im Hals gleich eine Streptokokkenangina. Wenn allerdings im Ohr oder im Hals tatsächlich eine Streptokokkeninfektion vorliegt, können Antibiotika die Symptome mildern, den Verlauf und auch die Ansteckungsfähigkeit verkürzen und Komplikationen verhindern.</p> <p>Bei einer eindeutigen AOM sollte eine antibiotische Therapie dann sofort begonnen werden, wenn die Kinder systemisch schwer krank sind (hohes Fieber, schlechter AZ), und immer bei Kindern unter sechs Monaten.</p> <p>Bei Angina tonsillaris gibt es Zeichen, die für eine virale Genese sprechen. Dies sind Schnupfen, Konjunktivitis, Diarrhö, generalisierte Lymphadenopathie und Splenomegalie. Ein typisches Scharlachexanthem spricht für eine bakterielle Genese, darf aber nicht mit einem unspezifischen Virusexanthem verwechselt werden.</p> <p>Studien zeigen, dass eine Leukozytose und ein erhöhtes CRP auch bei viralen Infektionen vorhanden sein können. Eventuell hilfreich ist ein Streptokokken- Schnelltest aus dem Rachenabstrich.</p> <p>Entscheidet man sich für eine antibiotische Therapie, sollte mit einem schmal wirksamen Antibiotikum behandelt werden, z.B. mit Amoxicillin bei der AOM oder Penicillin bei der Streptokokkenangina.</p> <p><strong>Contra</strong><br />„Ich schreibe kein Antibiotikum auf, wenn ich es nicht wirklich brauche“, betonte der in Wien niedergelassene Kinderarzt Dr. Stefan Thalhammer. „Streptokokkeninfekte in Ohr und Hals sind eigentlich in der Praxis selten geworden“, so der Kinderarzt weiter.</p> <p>Die einzige Methode, um in der Praxis herauszufinden, ob eine Streptokokkeninfektion (im Rachen) vorliegt, ist der Abstrich, der allerdings zwei Nachteile aufweist: 30 % sind falsch negativ, andererseits sind 30 % der Bevölkerung mit Streptokokken kolonisiert, ohne krank zu sein. „Damit beträgt die Trefferquote nur noch 40 % , da ist es besser, zu würfeln“, so Thalhammer pointiert.</p> <p>Eine sinnvolle Methode für die Indikationsstellung ist die Abnahme eines Blutbilds mit CRP – wenn sich hier Hinweise auf eine bakterielle Infektion finden, ist die Verschreibung eines Antibiotikums gerechtfertigt. Das kann z.B. Penicillin V oder Cefaclor sein.<br /> „Amoxicillin würde ich bei einem Racheninfekt eher nicht verwenden, u.a. deshalb, weil es von Kindern oft nicht gut vertragen wird“, so Thalhammer abschließend.</p> <h2>Abszedierende Hautinfektionen</h2> <p><strong>Pro</strong><br /> „Tatsächlich waren die bisherigen Empfehlungen bezüglich einer antimikrobiellen Therapie von Hautabszessen negativ“, räumte Dr. Maria Kitchen-Hosp, Universitätsklinik für Dermatologie, MedUni Innsbruck, ein. Allerdings gibt es sehr wohl Indikationen für Antibiotika, wie z.B. große Abszesse (>5cm), multiple Abszesse, ausgedehntes Begleiterysipel, schwierige Drainage, Systembeteiligung, Immunsuppression, hohes oder sehr geringes Alter, hohes Risiko für Endokarditis oder für Übertragung von S. aureus.</p> <p>Außerdem gibt es zwei neue randomisierte, placebokontrollierte Studien,<sup>1, 2</sup> die im Gegensatz zu älteren Arbeiten nun sehr wohl einen Nutzen für Antibiotika auch bei kleinen Abszessen und Patienten ohne Risikofaktoren zeigen.</p> <p>Hier wurden mittels Cotrimoxazol bzw. in einer Studie auch mittels Clindamycin signifikant höhere Heilungsraten erzielt als mit Placebo. Allerdings war der Anteil von MRSA in den Studienpopulationen über 40 % . Natürlich wurde bei allen Patienten auch eine Inzision mit Drainage durchgeführt. Neuere Guidelines empfehlen daher, den Einsatz von Antibiotika (bevorzugt Cotrimoxazol oder Clindamycin) zusätzlich zum chirurgischen Vorgehen auch bei kleineren Abszessen zu erwägen.</p> <p><strong>Contra</strong><br /> „Therapiestandard beim Abszess sind Drainage und möglichst radikales Débridement“, sagte Prim. Univ.-Doz. Dr. Rupert Koller, Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Wilhelminenspital, Wien. „Man muss auch in Antibiotikastudien genauer schauen, was da im Hintergrund chirurgisch gemacht wurde, denn auch für Abszessbehandlungen gibt es Standards, die nicht immer eingehalten werden“, so Koller.</p> <p>Nach dem Eingriff muss eine adäquate Lokaltherapie erfolgen, u.a. mit silberhaltigen Wundauflagen. Alternativ hat sich in diesem Kontext auch die Negativdrucktherapie bewährt.</p> <p>In einer rezenten mexikanischen Studie,<sup>3</sup> in der das chirurgische Vorgehen sehr genau beschrieben wurde, fand sich kein Unterschied zwischen Antibiotikum und Placebo nach Abszessdébridement.</p> <p>„Zu den von der Vorrednerin erwähnten Studien ist zu sagen, dass die MRSARaten in den USA sehr viel höher sind als bei uns, und die Studien zeigten, dass vor allem Patienten mit MRSA-Infektionen profitierten“, kommentierte Koller. „Außerdem hatten diese Studien kein standardisiertes Vorgehen, aber eine lange Liste von Ausschlusskriterien. Meiner Meinung nach benötigen unkomplizierte, ausreichend drainierte und lokal adäquat versorgte Abszesse bei Kindern und Erwachsenen kein Antibiotikum“, so der Chirurg abschließend.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: „Brauche ich altersabhängig ein Antibiotikum bei …“, Pro/
Contra 2 des 12. ÖIK, 13. April 2018, Saalfelden
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Talan DA et al.: N Engl J Med 2016; 374(9): 823-32 <strong>2</strong> Daum RS et al.: N Engl J Med 2017; 376(26): 2545-55 <strong>3</strong> López J et al.: Surg Infect (Larchmt) 2018; 19(3): 345-51</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Zytomegalievirus: an die Risiken der Reaktivierung denken!
Infektionen mit dem Zytomegalievirus (CMV) verlaufen bei Gesunden zumeist asymptomatisch, führen jedoch zur Persistenz des Virus im Organismus. Problematisch kann CMV werden, wenn es ...
Medikamenteninteraktionen: hochrelevant im klinischen Alltag
Bei gleichzeitiger Einnahme mehrerer Medikamente ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese einander beeinflussen. Diese Wechselwirkungen können zum kompletten Wirkungsverlust oder auch ...
Update EACS-Guidelines
Im schottischen Glasgow fand im November 2024 bereits zum 31. Mal die Conference on HIV Drug Therapy, kurz HIV Glasgow, statt. Eines der Highlights der Konferenz war die Vorstellung der ...


