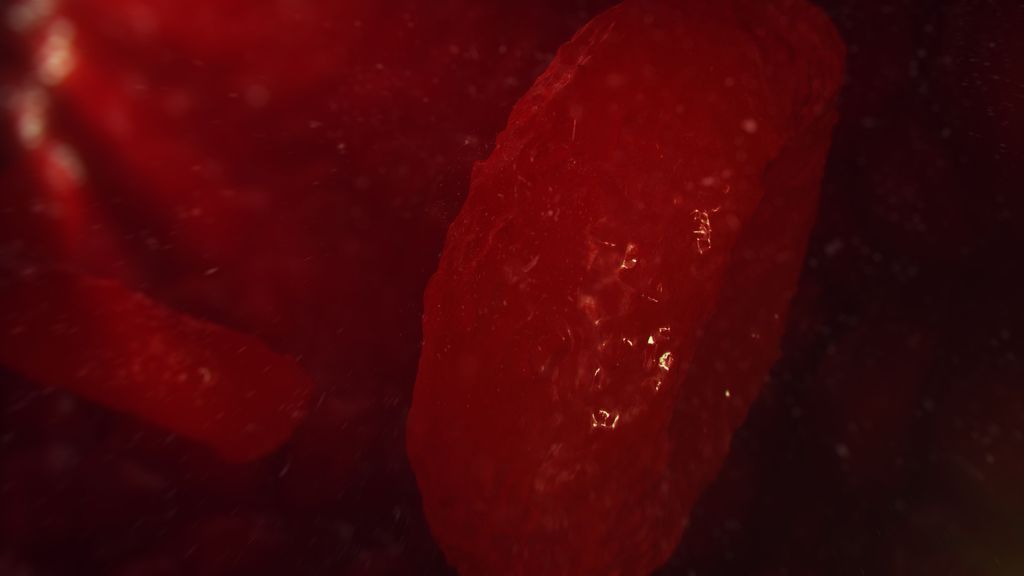
©
Getty Images/iStockphoto
Individualisiertes Vorgehen bei erhaltener Linksventrikelfunktion
Jatros
Autor:
Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Diana Bonderman
Innere Medizin II, Abteilung für Kardiologie<br> Medizinische Universität Wien<br> E-Mail: diana.bonderman@meduniwien.ac.at
Autor:
Dr. Christina Binder
30
Min. Lesezeit
09.11.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Das rechte Herz und der kleine Kreislauf sind auch bei primär linksventrikulären Pathologien ein wichtiger prognostischer Faktor sowie ein möglicher therapeutischer Ansatzpunkt. Das Zusammenspiel beider Kreislaufsysteme sollte daher bei jedem Patienten mit Herzinsuffizienz berücksichtigt werden.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Rechtsventrikelfunktion ist bei Patienten mit Linksherzinsuffizienz ein wichtiger prognostischer Parameter.</li> <li>Die Pathogenese der Linksherzerkrankung sollte genau evaluiert werden, damit seltenere Ursachen wie kardiale Amyloidosen nicht übersehen werden.</li> <li>Ausreichende diuretische Therapie und Gewichtsreduktion sind vielversprechende Therapieansätze bei Patienten mit HFpEF.</li> <li>Es besteht ein Mangel an etablierten medikamentösen Therapien für Linksherzerkrankungen mit konsekutiver pulmonaler Hypertension.</li> <li>Die Patienten sollten an spezialisierte Zentren überwiesen werden, an denen individualisierte Therapien angeboten werden.</li> </ul> </div> <p>Die Herzinsuffizienz mit normaler Linksventrikelfunktion (HFpEF) ist eine häufige Erkrankung, sie betrifft ca. 50 % aller Patienten mit Herzinsuffizienz. Die Prävalenz der HFpEF steigt mit der Zunahme von Risikofaktoren wie fortgeschrittenem Alter, Bluthochdruck, Diabetes mellitus und Adipositas. Frauen scheinen deutlich häufiger von dieser Erkrankung betroffen zu sein als Männer. Die Diagnose einer HFpEF kann bei Patienten gestellt werden, die sich mit Zeichen und Symptomen einer Herzinsuffizienz (Dyspnoe, Beinödeme, verminderte Leistungsfähigkeit) sowie normaler systolischer Funktion und erhöhten NT-proBNP(„brain natriuretic peptide“)-Werten präsentieren. Obwohl die Linksventrikelfunktion bei all diesen Patienten erhalten bleibt, kann es bei einigen Patienten zu einer Abnahme der rechtsventrikulären Pumpfunktion kommen. Letztere ist jedoch für die Prognose dieser Patienten essenziell. Eine prospektive Studie, die 320 HFpEF-Patienten untersucht hatte, konnte zeigen, dass tatsächlich mehr als die Hälfte (55,3 % ) an Rechtsherzversagen starben.<sup>1</sup></p> <h2>Pathophysiologie</h2> <p>Pathophysiologisch kommt es bei der HFpEF durch multifaktorielle Trigger zu einem fibrotischen Umbau und in der Folge zur Versteifung des linken Ventrikels. Dies hat einen Anstieg des linksventrikulären enddiastolischen Druckes (LVEDP) zur Folge, der sich retrograd bis in die Lungenstrombahn fortsetzt und dort zu einer Erhöhung der Druckwerte führt. Bei 10–13 % aller Betroffenen kommt es zusätzlich zu dieser Erhöhung des LVEDP auch zu einer Pulmonalgefäßerkrankung, die eine Erhöhung des pulmonalen Gefäßwiderstandes zur Folge hat, wodurch sich die rechtsventrikuläre Nachlast weiter erhöht.<sup>2</sup> Rezente Daten weisen darauf hin, dass die rechtsventrikuläre Dysfunktion, die bei einigen HFpEF-Patienten beobachtet werden kann, wahrscheinlich eine Folge einerseits einer gestörten Kontraktilität, andererseits der erhöhten rechtsventrikulären Nachlast ist.<sup>3</sup></p> <h2>Individualisiertes Vorgehen</h2> <p>Während eine Vielzahl von pulmonal vasodilatierenden Substanzen für die Behandlung von präkapillären Formen der pulmonalen Hypertension zugelassen sind und gute therapeutische Erfolge für diese Patienten zeitigen, so gleicht die Studienlage medikamentöser Therapien für die postkapilläre pulmonale Hypertension eher einem Trümmerfeld. Studien zur Wirksamkeit von Vasodilatatoren bei Linksherzerkrankungen konnten nicht nur keine positiven Ergebnisse verzeichnen, sondern mussten bereits in mehreren Fällen aufgrund von Sicherheitsbedenken frühzeitig abgebrochen werden (Tab. 1). Dieser Mangel an Möglichkeiten zur Therapie postkapillärer Formen der pulmonalen Hypertension erfordert daher ein individualisiertes Vorgehen, das folgende Überlegungen miteinbeziehen sollte.</p> <p><strong>Überzeugt von der Diagnose?</strong><br /> Bevor eine Therapieentscheidung fällt, sollte die Ursache für die Herzinsuffizienz gründlich evaluiert und gegebenenfalls reevaluiert werden. Andere Formen der Herzinsuffizienz mit postkapillärer pulmonaler Hypertension sollten in Betracht gezogen werden, da diese fallweise einen gänzlich anderen therapeutischen Zugang erfordern. Eine rezente Studie aus 2016 konnte mittels kardialer Magnetresonanztomografie und Ganzkörperknochenszintigrafie zeigen, dass die Prävalenz von kardialen Amyloidosen unter HFpEF-Patienten mit 10–14 % deutlich höher ist als angenommen. So könnte es sich bei einigen dieser Patienten mit diagnostizierter HFpEF eventuell um frühe Formen oder bisher unentdeckte Fälle von kardialen Amyloidosen handeln.<sup>4</sup></p> <p><strong>Überwässerung?</strong><br /> Eine ausreichende Diurese ist bei Patienten mit HFpEF ein essenzieller therapeutischer Ansatz. Nicht selten präsentieren sich diese Patienten jedoch mit einer zusätzlichen Nierenfunktionsstörung. Oftmals wird daher bei diesen Patienten die diuretische Therapie aus Sorge vor einem Anstieg der Nierenretentionsparameter reduziert oder sogar abgesetzt. Allerdings kann eine Hypervolämie stauungsbedingt ebenfalls zu einer Einschränkung der Nierenfunktion führen.<sup>5</sup> Untersuchungen haben gezeigt, dass euvoläme Patienten mit HFpEF eine bessere Prognose haben als hypervoläme Patienten, sogar dann, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist (Abb. 2).<sup>6</sup> Daher sollte gerade bei diesen Patienten der Fokus vor allem auf einer ausreichenden Entwässerung liegen.</p> <p><strong>Übergewicht?</strong><br /> Ein weiterer Ansatzpunkt zur Therapie von Patienten mit HFpEF ist die Behandlung von Komorbiditäten. Dazu zählen einerseits eine angemessene antihypertensive Therapie und eine adäquate Blutzuckereinstellung, andererseits die konsequente Gewichtsreduktion. Es ist naheliegend, dass adipöse Patienten symptomatischer sind als normalgewichtige, allerdings konnte gezeigt werden, dass eine Phänotypisierung nach „übergewichtiger“ versus „nicht übergewichtige“ HFpEF auch eine eindeutige Unterscheidung bezüglich anderer Surrogatparameter zulässt. So haben übergewichtige HFpEF-Patienten im Vergleich zu normalgewichtigen Patienten mit HFpEF und auch im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen signifikant höhere Plasmavolumina, größere rechte Ventrikel und erhöhte linksventrikuläre Füllungsdrücke.<sup>7, 8</sup> Sowohl diätetische Maßnahmen als auch körperliches Training verbessern signifikant die Leistungsfähigkeit dieser Patienten. Eine Kombination beider Therapieansätze wirkt additiv auf eine Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme.<sup>9</sup> Allerdings konnte gezeigt werden, dass auch normalgewichtige Patienten mit HFpEF von körperlichem Training durch verbesserte Leistungsfähigkeit und höhere Lebensqualität profitieren.<sup>10</sup></p> <p><strong>Überproportionale PH?</strong><br /> Bei chronischer Druckbelastung in der Lungenstrombahn kann es durch Remodelingprozesse zu Veränderungen der präkapillären Pulmonalgefäße kommen, die sich zusätzlich zur postkapillären pulmonalen Hypertension durch eine Linksherzerkrankung als präkapilläre Komponente einer kombinierten pulmonalen Hypertension manifestieren.<sup>11</sup> Da für präkapilläre Formen der pulmonalen Hypertension gut etablierte Therapien zur Verfügung stehen, scheint es naheliegend, dass diese Patienten von ähnlichen Therapiestrategien profitieren könnten. Diese medikamentösen Therapien werden derzeit bei Patienten mit Linksherzerkrankungen und konsekutiver pulmonaler Hypertension getestet. Vielversprechende Sicherheitsdaten gibt es derzeit für Therapien, die zu einer balancierten prä- und postkapillären Vasodilatation führen, wie Riociguat (Handelsname Adempas<sup>®</sup>), das derzeit für die Therapie der pulmonalarteriellen Hypertonie (PAH) und der chronischen thromboembolischen pulmonalen Hypertension (CTEPH) zugelassen ist. Auch Macitentan, das als Antagonist am Endothelinrezeptor einem Pulmonalgefäßumbau entgegenwirkt, scheint bei diesen Patienten sicher zu sein. Derzeit werden beide Substanzen in dieser Indikation getestet, allerdings ist ein Wirksamkeitsnachweis noch ausständig.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1704_Weblinks_kardio_1704_s28_abb1+2.jpg" alt="" width="2150" height="875" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Kardio_1704_Weblinks_kardio_1704_s29_tab1.jpg" alt="" width="2151" height="1808" /></p> <h2>Keine Empfehlungen durch Leitlinien</h2> <p>Aufgrund der Studienlage gibt es laut den aktuellen europäischen Leitlinien derzeit bei HFpEF mit konsekutiver postkapillärer pulmonaler Hypertension keine Empfehlungen für den Einsatz von pulmonalen Vasodilatatoren. Da auch sonst keine spezifischen medikamentösen Therapien zur Verfügung stehen, sollte gemeinsam mit Patienten eine alternative Therapiestrategie angestrebt werden. An der Medizinischen Universität Wien werden derzeit solche Behandlungspläne im Rahmen von klinischen Studien und individualisierten patientenorientierten Programmen angeboten. Zusätzlich zu engmaschigen ambulanten Kontrollen werden diesen Patienten medikamentöse Therapien in einem universitären Setting zur Verfügung gestellt. Derzeit bleibt dies zusätzlich zu einer umfassenden internistischen Basisbetreuung die einzige gezielte und individualisierte Therapie für Patienten mit HFpEF.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Aschauer S et al.: Modes of death in patients with heart failure and preserved ejection fraction. Int J Cardiol 2017; 228: 422-6. Epub 2016/11/22. <strong>2</strong> Tedford RJ et al.: Pulmonary capillary wedge pressure augments right ventricular pulsatile loading. Circulation 2012; 125: 289-97. Epub 2011/12/02 <strong>3</strong> Melenovsky V et al.: Right heart dysfunction in heart failure with preserved ejection fraction. Eur Heart J 2014; 35: 3452-62. Epub 2014/05/31 <strong>4</strong> Bennani Smires Y et al.: Pilot study for left ventricular imaging phenotype of patients over 65 years old with heart failure and preserved ejection fraction: the high prevalence of amyloid cardiomyopathy. Int J Cardiovasc Imaging 2016; 32: 1403-13. Epub 2016/10/19 <strong>5</strong> Damman K et al.: Renal impairment, worsening renal function, and outcome in patients with heart failure: an updated meta-analysis. Eur Heart J 2014; 35: 455-69. Epub 2013/10/30 <strong>6</strong> Koell B et al.: Fluid status and outcome in patients with heart failure and preserved ejection fraction. I Int J Cardiol 2017; 230: 476-81. Epub 2017/01/08 <strong>7</strong> Obokata M et al.: Evidence supporting the existence of a distinct obese phenotype of heart failure with preserved ejection fraction. Circulation 2017. Epub 2017/04/07 <strong>8</strong> Dalos D et al.: Functional status, pulmonary artery pressure, and clinical outcomes in heart failure with preserved ejection fraction. J Am Coll Cardiol 2016; 68: 189-99. Epub 2016/07/09 <strong>9</strong> Kitzman DW et al.: Effect of caloric restriction or aerobic exercise training on peak oxygen consumption and quality of life in obese older patients with heart failure with preserved ejection fraction: a randomized clinical trial. JAMA 2016; 315: 36-46. Epub 2016/01/10 <strong>10</strong> Edelmann F et al.: Exercise training improves exercise capacity and diastolic function in patients with heart failure with preserved ejection fraction: results of the Ex-DHF (Exercise training in Diastolic Heart Failure) pilot study. J Am Coll Cardiol 2011; 58: 1780-91. Epub 2011/10/15 <strong>11</strong> Gerges C et al.: Diastolic pulmonary vascular pressure gradient: a predictor of prognosis in ”out-of-proportion“ pulmonary hypertension. Chest 2013; 143: 758- 66. Epub 2013/04/13</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


