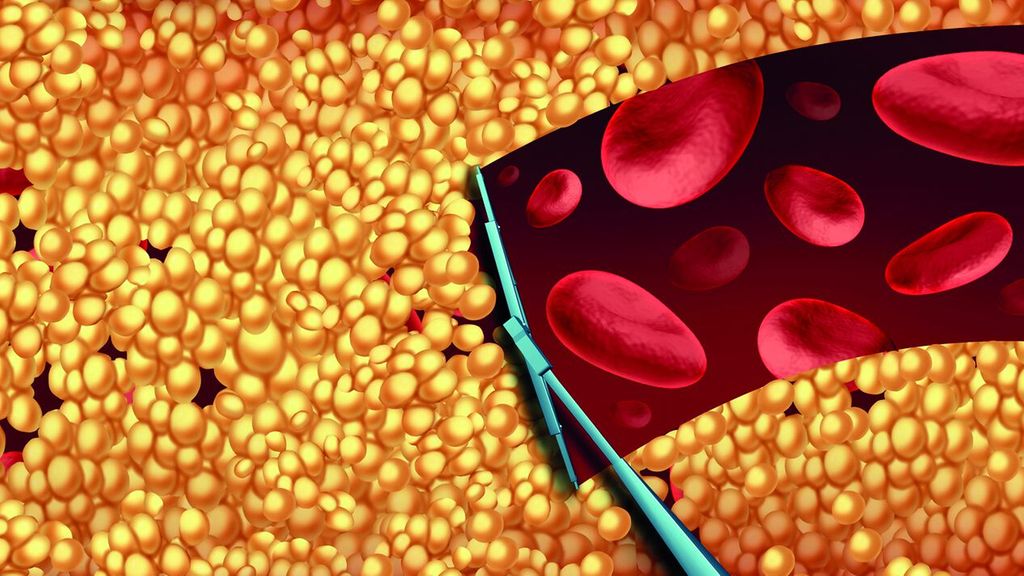
©
Getty Images/iStockphoto
NOAKs bei Niereninsuffizienz
Jatros
Autor:
Prim. Univ.-Prof. Dr. Sibylle Kietaibl, MBA
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin,<br> Evangelisches Krankenhaus Wien<br> und Sigmund Freud Privatuniversität Wien<br> E-Mail: s.kietaibl@ekhwien.at
30
Min. Lesezeit
27.02.2020
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In Österreich leben etwa 235 000 Menschen mit einer Medikamentenverordnung für nicht Vitamin-K-abhängige orale Antikoagulanzien (NOAKs). Mit zunehmendem Alter steigt nicht nur die Inzidenz einer Indikation für NOAKs, des Vorhofflimmerns, sondern auch das Risiko für eine Niereninsuffizienz. So wirksam und sicher NOAKs grundsätzlich sind, bei Niereninsuffizienz führt die Akkumulation der Blutverdünnungsmedikamente zu Blutungen. Wie können wir diesem Nieren-NOAK-Risiko begegnen?</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Nicht Vitamin-K-abhängige orale Antikoagulanzien (NOAKs) sind wirksam und sicher bei der Behandlung von Vorhofflimmern, Koronarsyndrom und Thromboembolie; NOAKs steigern den Patientenkomfort im Vergleich zu Vitamin-K-Antagonisten.</li> <li>Da NOAKs zu 25–80 % renal eliminiert werden, akkumulieren sie bei Niereninsuffizienz, wodurch das Blutungsrisiko steigt.</li> <li>Daher ist ein regelmäßiger Drug-Check mittels Überprüfung der glomerulären Filtrationsrate (GFR) unter laufender NOAK-Verordnung erforderlich, zusätzlich bei Erkrankungen, Operationen und Unfällen.</li> <li>GFR-Werte von 15, 30 und 50 ml/min sind bei Niereninsuffizienz für das Absetzen von NOAKs vor Operationen bzw. für das Antidotieren (Idarucizumab, Andexanet alfa) relevant.</li> <li>Der perioperative Behandlungspfad ist einfach: NOAK absetzen (je nach GFR und anstehendem Eingriff; kein „bridging“ mit niedermolekularen Heparinen) – dann operieren – dann Thromboseprophylaxe – dann Wiederansetzen des NOAK.</li> </ul> </div> <h2>Nicht Vitamin-K-abhängige orale Antikoagulation – NOAK</h2> <p>Die Entwicklung der nicht Vitamin-Kabhängigen oralen Antikoagulation (NOAK) kann als Fortschritt in der Patientenbehandlung bewertet werden: NOAKs sind wirksam, nicht nur in den Zulassungsstudien, sondern auch in den Real-World-Daten und Registersammlungen. Darüber hinaus sind NOAKs sicherer als die herkömmlichen Vitamin-K-Antagonisten (VKA), denn die Evidenz zeigt auch geringere spontane Blutungen. Ein weiterer Motor für die Verwendung der NOAKs sind natürlich auch der Patientenkomfort sowie die postulierte Verbesserung der Lebensqualität. Während früher regelmäßige Gerinnungskontrollen mittels International Normalized Ratio (INR) bei der Behandlung mit VKA erforderlich waren, so sind diese Patientenwege bei den NOAKs in der Regel nicht nötig. Das therapeutische Fenster der NOAKs ist breiter, die Interaktionen mit Medikamenten sind wesentlich seltener und der Einfluss von Nahrungsmitteln ist vernachlässigbar. NOAKs sind auch sicherer als VKA bezüglich perioperativer Blutungen. Mit der Entwicklung NOAK-spezifischer Antidote steigern NOAKVerordnungen die Patientensicherheit auch in der Akutmedizin und Traumatologie.<br /> Ob und wann ein Patient auf ein NOAK eingestellt wird, obliegt dem betreuenden Internisten bzw. Allgemeinmediziner. Unterstützung bei der Entscheidung liefern Expertenempfehlungen. Derzeit leben in Österreich etwa 235 000 Menschen mit einer Medikamentenverordnung für ein NOAK.</p> <h2>Niereninsuffizienz</h2> <p>Zu den häufigsten Ursachen der Niereninsuffizienz zählen Bluthochdruck und Diabetes mellitus, aber auch die Einnahme von nierenschädigenden Medikamenten, wie nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), trägt zur Nierenschädigung bei. Die Korrektur dieser modifizierbaren Risikofaktoren und die Vermeidung präzipitierender Faktoren mit Anpassung der Lebensgewohnheiten sind volkswirtschaftlich und gesundheitspolitisch relevant und sollten stets angestrebt werden. Mit zunehmendem Alter steigt nicht nur das Auftreten einer Indikation für NOAKs, das Vorhofflimmern, sondern auch das Risiko für eine Niereninsuffizienz.<br /> Zu den häufigsten Folgen der Niereninsuffizienz zählen Bluthochdruck, (Lungen-) Ödem, Anämie, Elektrolyt- und Herzrhythmusstörungen und die Akkumulation von renal eliminierten Medikamenten. Dazu gehören die NOAKs, deren renale Elimination in absteigender Reihe folgendermaßen verläuft: Dabigatran >Edoxaban >Rivaroxaban >Apixaban. Die Leistung der Niere wird an der glomerulären Filtrationsrate (GFR) gemessen, abhängig von Alter, Geschlecht und Körpergröße. Die Berechnung der Kreatinin-Clearance kann nach verschiedenen Formeln erfolgen (Cockcroft-Gault, Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration [CKD-EPI], Modification of Diet in Renal Disease [MDRD]). Fällt der GFR-Wert unter 15 ml/min, kann die Niere ihre Funktion nicht mehr erfüllen.<br /> Dialysepflichtigkeit ist eine Kontraindikation für alle NOAKs. Unter 15 ml/min GFR sind die Faktor-Xa-inhibierenden NOAKs Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban kontraindiziert, unter 30 ml/min GFR das Thrombin-inhibierende NOAK Dabigatran. Bei GFR-Leistungen zwischen diesen Grenzwerten und 80 ml/min ist mit verzögerter NOAK-Elimination und erhöhtem Blutungsrisiko zu rechnen. Wie können wir diesem Nieren-NOAK-Risiko begegnen? Am ehesten mit einem wachsamen Blick auf die Nierenfunktion und therapeutischen Konsequenzen bei zunehmender Insuffizienz.</p> <h2>Drug-Check</h2> <p>Der wachsame Blick auf die Nierenfunktion unter NOAK-Therapie bedeutet in der klinischen Praxis die regelmäßige Kontrolle der GFR. Modifiziert nach der Empfehlung der European Heart Rhythm Association (EHRA) sollen GFR-Kontrollen zu Beginn der NOAK-Verordnung und danach alle 12 Monate erfolgen. Beim 1. Follow-up nach einem Monat sollen diese Kontrollintervalle individuell angepasst werden. Der Drug- Check soll intensiviert werden auf ein Intervall von 6 Monaten bei über 75-Jährigen bzw. bei Gebrechlichkeit. Unter 60 ml/min GFR soll der Zeitabstand zur nächsten Kontrolle verkürzt werden nach der Formel GFR /10 (in Monaten). Zu beachten im Alter: Sarkopenie kann den Abfall der GFR maskieren. Das Hinzuziehen eines Nephrologen wird bei einer GFR Drug-Monitoring im Sinne der Kontrolle der biologischen Wirkung der NOAK mittels Gerinnungsanalysen sind nicht routinemäßig nötig. Aber bei manifesten Blutungen oder bei imminentem Blutungsrisiko werden neben der GFR sensitive Gerinnungsanalysen durchgeführt. Qualitative Aussagen über eine Restwirkung der Faktor-Xa-inhibierenden NOAKs können mit der Anti-Xa-Aktivität getroffen werden, über die Restwirkung des Thrombin-inhibierenden Dabigatrans mit der Thrombinzeit. Für quantitative Aussagen soll die Anti-Xa-Aktivität auf das jeweilige NOAK kalibriert bzw. die dilutierte Thrombinzeit gemessen werden.</p> <h2>NOAK und Niere perioperativ</h2> <p>Bei kleinen Eingriffen ohne relevantes Blutungsrisiko mit der Möglichkeit der lokalen Blutstillung werden OPs im Talspiegel durchgeführt, also 12–24 h nach der letzten Einnahme. Bei Eingriffen mit niedrigem oder hohem Blutungsrisiko hingegen ist ein präoperatives Absetzen die therapeutische Konsequenz je nach GFR: Bei einer GFR >80 ml/min werden alle NOAKs mind. 24 h vor der OP (bei niedrigem Blutungsrisiko) oder mind. 48 h davor (bei hohem Blutungsrisiko) abgesetzt. Dieses Intervall verlängert sich für Rivaroxaban, Apixaban und Edoxaban bei niedrigem Blutungsrisiko und einer GFR von 15–30 ml/min auf ≥36 h. Für Dabigatran steigen die Karenzzeiten steiler an: Bei einer GFR von 50–79 ml/min soll Dabigatran mind. 36 h vor der OP (bei niedrigem Blutungsrisiko) oder mind. 72 h davor (bei hohem Blutungsrisiko) abgesetzt werden, bei einer GFR von 30–49 ml/min mind. 48 h (bei niedrigem Blutungsrisiko) oder mind. 96 h vor der OP (bei hohem Blutungsrisiko).<br /> Eine präoperative Überbrückung mit niedermolekularen Heparinen (LMWH), z. B. Enoxaparin, soll laut aktuellen Empfehlungen bei NOAKs nicht erfolgen, weil dadurch nur das Blutungsrisiko potenziert wird. Der perioperative Behandlungspfad ist also einfach: NOAK absetzen (je nach GFR und anstehendem Eingriff) – dann operieren – dann Thromboseprophylaxe (je nach Eingriff und patientenabhängigem Risiko) – dann nach definitivem Blutungsstopp Wiederansetzen des NOAK.</p> <h2>Antidotieren der NOAK</h2> <p>Das Antidotieren der NOAKs mit dem spezifischen Antidot hat einen hohen Stellenwert bei lebens- und organbedrohlichen Blutungen. Für das prompte und nachhaltige Reversieren der Wirkung von Dabigatran ist seit 2015 Idarucizumab zugelassen. Die Initialdosis beträgt 2 x 2,5 g als Bolusinfusion (im Abstand von max. 15 Minuten). Für das Reversieren der Wirkung von Xa-inhibierenden NOAKs ist seit 2019 Andexanet alfa zugelassen. Dosierungsempfehlung bei Einnahme von Rivaroxaban vor ≥7 h und von Apixaban: 400 mg Bolus plus 480 mg infundiert über 2 h. Diese Dosierungen verdoppeln sich bei unklarem Einnahmezeitpunkt. Die Kosten für Andexanet alfa sind hoch und es steht derzeit in Österreich noch nicht zur Verfügung. Gegenwärtig werden Xa-inhibierenden NOAKs mit Prothrombinkomplexkonzentrat (PPSB) in ihrer Wirkung abgeschwächt. Auch bei schwerwiegender Blutung durch VKA soll mit PPSB plus Vitamin K reversiert werden (starke Empfehlung 1B). PPSB birgt jedoch stets das Risiko für venöse Thromboembolien, weil es die Thrombingeneration steigert. Im Gegensatz dazu hat Idarucizumab keine eigenständige prothrombotische Wirkung und die Rate an Thromboembolien ist geringer als bei anderen pharmakologischen Reversierungsstrategien. Die Zielsteuerungsgruppe Gesundheit hat im klinischen Pfad zur Behandlung hüftnaher Frakturen bei zuvor oral antikoagulierten Patientinnen und Patienten empfohlen, Idarucizumab dann einzusetzen, wenn der Knochenbruch unter Dabigatran bei einer Niereninsuffizienz mit einer GFR unter 50 ml/min passiert ist. Mit Gabe des Antidots kann die operative Korrektur innerhalb des kritischen Zeitfensters von 48 h erfolgen. Dieses Limit gilt als Ergebnisqualitätskennzahl, weil bei Verzögerungen Morbidität und Mortalität deutlich ansteigen. Der klinische Pfad sieht auch vor, nach der OP und vor dem Wiederansetzen des NOAK die aktuelle Nierenfunktion zu berücksichtigen. Wenn durch die interkurrente Verletzung und OP die GFR unter 15–30 ml/min abgefallen ist, dann sollte eine Reevaluierung der Indikation und der Dosis erfolgen.</p> <h2>Patientenorientierung</h2> <p>In der modernen Medizin ist der nächste Schritt nach der NOAK-Indikationsstellung die Patientenaufklärung. Wenn Ärzte über NOAK, Behandlungsalternativen und Risiken informieren, dann können die Patienten im Sinne der partizipativen Medizin die Behandlung mitgestalten – so kann das geeignete NOAK gefunden werden. Es müssen auch Verhaltensregeln vereinbart werden, etwa die Vermeidung von NSAR bei eingeschränkter Nierenfunktion oder Gebrechlichkeit. Abgesehen vom direkten Arzt-Patient-Gespräch händigen Spitalsambulanzen immer öfter NOAK-Informationsblätter an Patienten aus; nicht nur um den Informationstransfer zu unterstützen, sondern auch zur medikolegalen Sicherheit der Behandler. Informationsblätter haben sich auch in der perioperativen Medizin etabliert, um die Einhaltung der korrekten Karenzzeiten der oralen Antikoagulation zu erleichtern (z. B. https://www.ekhwien.at/fileadmin/content/pdf_downloads/Praeanaesthesie/Informationen_fuer_PatientInnen_ mit_Blutverduennung.pdf).</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei der Verfasserin</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


