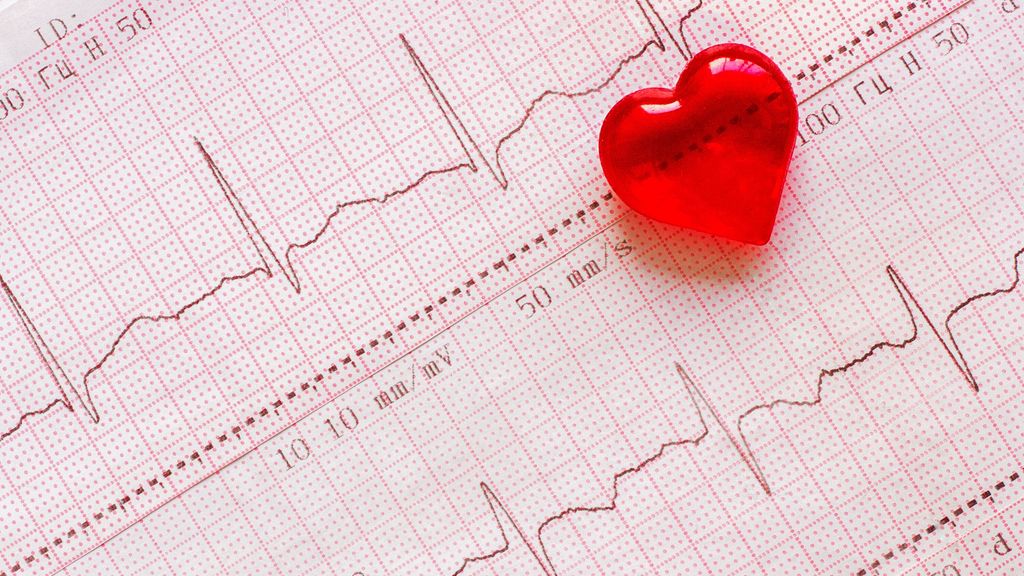
©
Getty Images/iStockphoto
„Projekt Herzinsuffizienz“ des Landes Oberösterreich und der OÖGKK
Jatros
Autor:
OA Dr. Christian Ebner
2. Interne Abteilung mit Kardiologie, Angiologie und Interner Intensivstation<br/> Ordensklinikum Elisabethinen, Linz<br/> E-Mail: christian.ebner@ordensklinikum.at
30
Min. Lesezeit
28.02.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Herzinsuffizienz (HI) ist eine ernste und oft rasch progredient verlaufende Erkrankung. Die Obsorge für Risikopatienten in einem „Disease Management Program“ kann deren Morbidität und Mortalität günstig beeinflussen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Patienten mit Herzinsuffizienz haben nach Hospitalisierung wegen kardialer Dekompensation vor allem in der Frühphase nach Entlassung ein deutlich erhöhtes Mortalitätsrisiko.</li> <li>Die Rehospitalisierungsrate kann in den ersten 6 Monaten bis zu 50 % betragen.</li> <li>Die Betreuung von Risikopatienten in einem „Disease Management Program“ nach einer Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz reduziert ihre Morbidität und Mortalität.</li> </ul> </div> <p>Bis zu 2 % der Erwachsenen in den westlichen Industrieländern haben eine Herzinsuffizienz, wobei die Zahlen mit steigendem Lebensalter deutlich zunehmen: Es sind bis zu 10 % der über 70-Jährigen davon betroffen. Eines der Hauptprobleme sind die immer wiederkehrenden Hospitalisierungen wegen kardialer Dekompensation und somit ist „Herzinsuffizienz“ die häufigste Spitalsentlassungsdiagnose von Patienten nach dem 65. Lebensjahr. Das Risiko zu sterben ist in der Frühphase nach der Krankenhausentlassung am höchsten, aber auch die Rehospitalisierungsrate ist hoch, sie beträgt bis zu 50 % innerhalb der ersten 6 Monate. Diese Ergebnisse rechtfertigen eine verstärkte Überwachung vor allem von Risikopatienten, die wegen einer Herzinsuffizienz rezidivierend hospitalisiert wurden.<br />Die Behandlung der Herzinsuffizienz ist teuer; zwei Drittel der Ausgaben werden für Spitalskosten aufgewendet und so tragen wiederholte Krankenhausaufenthalte stark zur enormen gesamtwirtschaftlichen Belastung durch diese Erkrankung bei.</p> <h2>Disease-Management-Programme</h2> <p>Spezielle Programme („Disease Management Programs“; DMP) die auf die Obsorge für diese Patientengruppe nach Entlassung wegen dekompensierter Herzinsuffizienz abzielen, haben gezeigt, dass eine Reduktion der Zahl der stationären Wiederaufnahmen und der Sterblichkeit sowie eine Verbesserung der Kosteneffektivität möglich sind. Basierend auf dieser Evidenz weisr die Europäische Kardiologische Gesellschaft (ESC) seit 2012 in ihren Empfehlungen darauf hin, dass die Schaffung von multidisziplinären Versorgungsprogrammen zu empfehlen ist (Empfehlungsklasse I, Evidenzgrad A).<br />Als Charakteristikum eines solchen Programms wird vor allem die Multidisziplinarität – also das Zusammenarbeiten verschiedener Fachgruppen (z. B. Kardiologen, praktische Ärzte, Pflegepersonal etc.) angeführt, wobei eine kompetente Ausbildung in Hinblick auf die Erkrankung Herzinsuffizienz Voraussetzung sein sollte. Um solch ein Konzept nachhaltig im System zu verankern, wird größter Wert darauf gelegt, weitgehend auf bestehende Strukturen aufzubauen. Eine nahtlose Vernetzung und transparente Kommunikation dieses Versorgungsumfeldes – also eine Betreuung im Team – ermöglichen eine noch individuellere und zielgenauere Behandlung. Ziel dieser strukturierten Betreuung ist, dass die Patienten rasch optimal versorgt werden können und damit nicht nur die Lebensqualität und der Krankheitsverlauf dieser chronisch Kranken positiv beeinflusst werden, sondern auch der kostenintensive intramurale Bereich entlastet wird.</p> <h2>Noch kein österreichweites DMP</h2> <p>Bis dato gibt es kein einheitliches österreichweites Disease-Management-Programm, vor allem, da die Umsetzung nur mit finanzieller Hilfe des jeweiligen Bundeslandes möglich ist. In der Vergangenheit gab es in Oberösterreich bereits mehrere Anläufe auf lokaler Ebene, ein Programm zu installieren. Dies waren z. B. ein Telemonitoring-Projekt („Elicard“), welches ich im Elisabethinen-Krankenhaus Linz leiten durfte, oder ein Ableger des Salzburger „KardioMobil“-Projekts, welches durch das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz betreut wurde. Beide Programme wurden durch die jeweiligen Krankenhausträger finanziert und mussten wegen des zunehmenden Spardrucks wieder eingestellt werden.</p> <h2>Herzinsuffizienz-Projekt Oberösterreich</h2> <p>Basierend auf diesen Gegebenheiten konnte ich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Ärzten von Schwerpunkt-Kardiologien (Elisabethinen Linz, Barmherzige Schwestern Linz, Kepler Universitätsklinikum Linz, LKH Rohrbach), dem niedergelassenen Bereich sowie spezialisiertem Fachpflegepersonal und Vertretern der mobilen Hilfsdienste initiieren, mit dem Ziel, ein Herzinsuffizienz- Projekt für das Land Oberösterreich zu installieren. Ziel ist die nachhaltige Betreuung von symptomatischen Hochrisikopatienten, also jenen, die wegen dekompensierter Herzinsuffizienz hospitalisiert worden sind. Dem gingen intensive Schulungen der teilnehmenden Ärzte wie auch des Fachpflegepersonals der teilnehmenden mobilen Hilfsdienste in Hinblick auf Herzinsuffizienz voran. Wir durften dann am 1. 1. 2017 in ausgewählten Projektregionen (Linz-Stadt, Linz-Land, Urfahr- Umgebung und Bezirk Rohrbach) ein Projekt starten, wobei die Kosten zu jeweils 50 % die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK) und das Land Oberösterreich tragen.<br />Der Einschluss eines Patienten, der wegen dekompensierter Herzinsuffizienz stationär aufgenommen worden war, erfolgte nach dessen Entlassung über den teilnehmenden Arzt für Allgemeinmedizin oder Internisten (bei Einschluss ≥ NYHA II), wobei teilweise bereits im Entlassungsbrief des Krankenhauses auf die Sinnhaftigkeit hingewiesen wurde („Der Patient ist für das Pilotprojekt ‚Integrierte Versorgung für Patienten mit Herzinsuffizienz‘ des Landes Oberösterreich und der OÖGKK geeignet und wir empfehlen den Einschluss durch den betreuenden Hausarzt/Internisten“). Eine mehrstündige Patientenschulung unter Miteinbeziehung einer Herzinsuffizienz- Pflegeperson mit dem Ziel, die Awareness und Compliance zu verbessern, war vor Einschluss unbedingt erwünscht und wurde in den am Projekt teilnehmenden Krankenhäusern regelmäßig angeboten. Zusätzlich bekam der Patient eine Informationsbroschüre über Herzinsuffizienz, die uns von der Pensionsversicherung zur Verfügung gestellt wurde.</p> <p> <img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Kardio_1901_Weblinks_abb1.jpg" alt="" width="1000" height="467" /></p> <h2>Herzinsuffizienz-Tagebuch zentrales Dokument</h2> <p>Als zentrales Dokument ist das Führen eines Herzinsuffizienz-Tagebuchs (tägliche Erhebung von Blutdruck, Puls, Gewicht, evtl. Eintragung von Befindlichkeit, Übersicht über die aktuelle Medikation) durch den Patienten verpflichtend (Abb. 1). Es ist Basis des Selbstmanagements und gibt dem betreuenden Arzt einen besseren Überblick über den Zustand des Patienten. Dieses „Tool“ begleitet den Patienten während der gesamten Betreuungsphase und ist bei jedem Arzt- bzw. Ambulanzbesuch vorzulegen. Falls notwendig, kann der Patient auf Vermittlung des betreuenden praktischen Arztes/Internisten zusätzlich eine geschulte Fachpflegeperson eines mobilen Hilfsdiensts in Anspruch nehmen, wenn dieser der Meinung ist, dass der Patient passager noch einer intensiveren Betreuung bedarf. Die Fachpflegeperson hat dann die Aufgabe, den Patienten bei den regelmäßigen Eintragungen ins Herzinsuffizienz- Tagebuch zu unterstützen, die angeordnete Medikamenteneinnahme zu überwachen und bei klinischer Verschlechterung den Kontakt zum betreuenden Arzt zu suchen. Regelmäßige klinische und Laborkontrollen des Patienten bei seinem einschreibenden Arzt sind verpflichtend vorgesehen. Sollte eine klinische Verschlechterung des Patienten eine stationäre Aufnahme notwendig machen, kann diese über eine „Notfallnummer“ in den jeweiligen Projekt-Krankenhäusern rasch und unbürokratisch organisiert werden. Falls notwendig sind auch kurzfristige Konsultationen von Internisten oder die Begutachtung in der Herzinsuffizienz- Ambulanz eines der Projekt-Krankenhäuser möglich. Parallel zu den Kontrollen beim betreuenden praktischen Arzt/Internisten kann auch eine geplante Nachkontrolle in der Herzinsuffizienzambulanz vorgesehen sein, wenn beim Patienten noch über Therapieerweiterungen (z. B. Deviceimplantationen) zu entscheiden ist. Die Abschlusskontrolle des Patienten erfolgt nach einem Jahr in der Herzinsuffizienzambulanz eines der Projekt-Krankenhäuser mit klinischer Untersuchung, umfassendem Labor und Echokardiografie. Dabei wird auch die Patienten-Compliance anhand des ausgefüllten Herzinsuffizienz- Tagebuchs beurteilt und erfasst, ob im Betreuungszeitraum neuerliche stationäre Aufnahmen wegen Herzinsuffizienz notwendig waren. Um auch Befindlichkeitsinformationen aus Patientensicht zu erhalten, wird am Beginn und nach Betreuungsabschluss der reduzierte KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire) ausgefüllt. Notwendige Dokumente und Informationen für die teilnehmenden Ärzte sind auf einer dafür eingerichteten homepage der OÖGKK bereitgestellt und abrufbar.</p> <h2>Aktueller Stand des Projekts</h2> <p>Der Einschluss von Patienten in das Projekt erfolgte bis 31. 12. 2018. Zu diesem Zeitpunkt waren insgesamt 197 Patienten ins Projekt aufgenommen worden. Beim Herzinsuffizienz-Update 2018 im November in Linz konnte ich eine Vorabauswertung einzelner Punkte präsentieren. So zeigte sich hinsichtlich der Betreuungsmodalität, dass Patienten mit Herzinsuffizienz im ländlichen Bereich zu einem hohen Prozentsatz von praktischen Ärzten betreut werden, während sich in der Stadt vorwiegend Internisten/Kardiologen dieser Patientengruppe annehmen. Die endgültige Auswertung ist erst mit 31. 12. 2019 zu erwarten, wenn der letzte Patient seine Abschlusskontrolle hatte. Je nach Ergebnis ist dann mit den Kostenträgern über eine Übernahme des Programms in den Regelbetrieb zu verhandeln.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher
Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...


