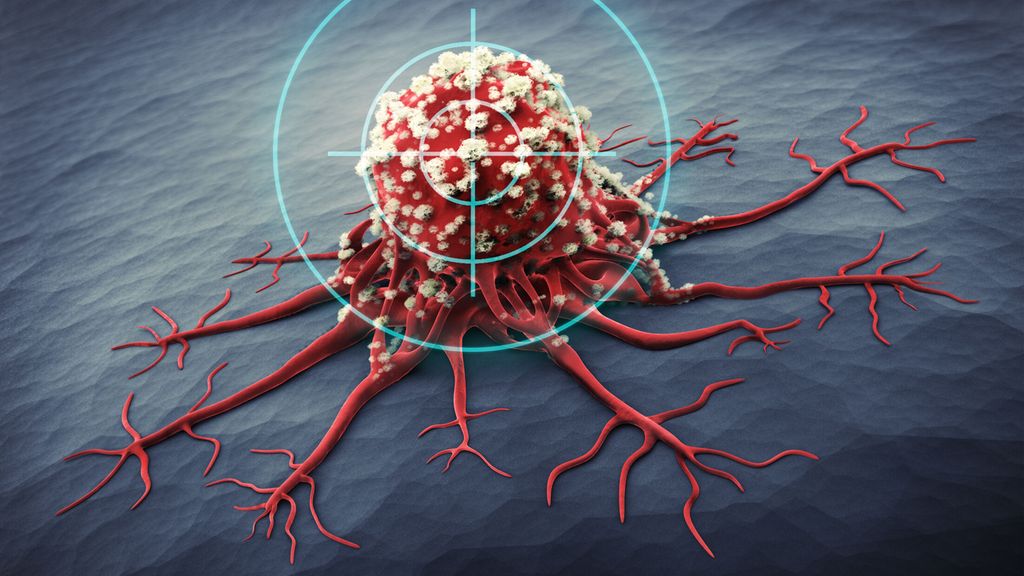
©
Getty Images/iStockphoto
Atezolizumab wird als First-Line-Therapie des Ovarialkarzinoms untersucht
Jatros
Autor:
Dr. Richard Schwameis
Univ.-Klinik für Frauenheilkunde<br> Abteilung für allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie<br> Medizinische Universität Wien<br> E-Mail: richard.schwameis@meduniwien.ac.at
30
Min. Lesezeit
27.12.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die IMAGyn050-Studie ist eine globale, multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-III-Studie, die in Österreich von der Arbeitsgruppe für Gynäkologische Onkologie (AGO Austria) durchgeführt wird und sich gerade in der Rekrutierungsphase befindet. Die Studie ist offen für Patientinnen mit weit fortgeschrittenem Ovarial-, Peritoneal- oder Tubenkarzinom (in den Stadien FIGO III und FIGO IV) und untersucht, ob die zusätzliche Gabe von Atezolizumab zur etablierten Standardtherapie einen Überlebensvorteil für Patientinnen mit weit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom mit sich bringt.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Das Ovarialkarzinom ist das gynäkologische Malignom mit der höchsten Mortalitätsrate.</li> <li>Atezolizumab ist ein Anti-PDL1- Antikörper und kann das Immunsystem gegen Tumorzellen aktivieren.</li> <li>IMAGyn050 ist die erste Studie, die ein Immunonkologikum als First-Line-Therapie bei Patientinnen mit Ovarialkarzinom untersucht.</li> </ul> </div> <p>Jährlich erkranken weltweit rund 250 000 Frauen an einem Ovarialkarzinom. Besonders dramatisch ist, dass etwa 75 % der Fälle erst in späten Stadien, das bedeutet in den Stadien FIGO III oder FIGO IV, diagnostiziert werden. Das sind Stadien, in denen das Ovarialkarzinom bereits die Grenzen des Beckens überschritten hat und sich im Bauchraum oder im gesamten Körper verteilen konnte.<br /> Die etablierte Standardtherapie in diesem weit fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung ist ein multidisziplinäres Vorgehen. Entweder es wird initial eine Debulkingoperation durchgeführt oder die Patientin wird zuerst mittels neoadjuvanter Chemotherapie (NACT) behandelt und anschließend einer Operation zugeführt. Ziel der Operation ist es, den gesamten Tumor makroskopisch zu entfernen. Im Anschluss an die Operation wird eine platinhältige Kombinationschemotherapie verabreicht.<br /> Ein Großteil der Patientinnen mit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom erleidet ein Rezidiv und entwickelt nach und nach eine Resistenz gegen die Chemotherapie. Aufgrund dessen sterben pro Jahr etwa 140 000 Patientinnen weltweit an dieser Erkrankung und somit weist das Ovarialkarzinom die höchste Mortalitätsrate gynäkologischer Malignome auf. In den letzten Jahren konnte durch eine Verbesserung der Chemotherapie und vor allem durch die Einführung der antiangiogenetischen Therapie das Überleben der Patientinnen verlängert werden, allerdings konnte innerhalb der letzten drei Dekaden die Heilungsrate von Patientinnen mit Ovarialkarzinom nicht erhöht werden. Daher steht das Ovarialkarzinom weiterhin im zentralen Fokus gynäkologisch-onkologischer Forschung.</p> <h2>Immuntherapie</h2> <p>Die Immuntherapie, vor allem in Form der Immuncheckpoint-Inhibitoren, hielt vor einigen Jahren Einzug in die Onkologie. Immuncheckpoints werden Rezeptoren auf T-Lymphozyten genannt, die die Immunantwort modulieren, das heißt dämpfen oder steigern können. Diese Immuncheckpoints sind für die Immunhomöostase enorm wichtig. Passend zu den Rezeptoren gibt es Liganden, die zum Schutz vor dem Immunsystem von körpereigenen Zellen exprimiert werden. Viele Tumorzellen exprimieren ebenfalls diese Liganden bzw. ist in vielen Tumoren die Expression dieser Liganden deutlich hochreguliert. Damit können sich Tumorzellen der Immunantwort entziehen, da sie vom Immunsystem toleriert werden.<br /> Immuncheckpoint-Inhibitoren sind Substanzen, die an diese Rezeptoren und/ oder Liganden binden und deren Funktion inhibieren. Damit kann das Immunsystem aktiviert und die Immunantwort verstärkt werden.<br /> In unserem Immunsystem gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Rezeptor-/Ligandenkombinationen, sogenannte „immune pathways“. Einer der derzeit im Fokus stehenden „immune pathways“ ist der „PD- 1/PD-L1 pathway“. Hierbei steht PD-1 für „programmed cell death protein 1“ und stellt den Rezeptor an der T-Zelle dar. PDL1 steht für „programmed death-ligand 1“ und stellt den Liganden, der von Tumorzellen übermäßig exprimiert werden kann, dar. Derzeit gibt es viele unterschiedliche Substanzen, die in diesen „pathway“ eingreifen. Nivolumab und Pembrolizumab binden an und inhibieren PD-1. Atezolizumab ist neben Avelumab einer der Antikörper, die sich gegen PD-L1 richten.<br /> In der IMAGyn050-Studie wird Atezolizumab in Kombination mit Chemotherapie und Bevacizumab als First-Line-Therapie in der Behandlung des Ovarialkarzinoms untersucht.</p> <h2>Studiendesign</h2> <p>Die IMAGyn050-Studie ist eine globale, multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-III-Studie. Sie wird in Kooperation der Gynecologic Oncology Group, des European Network for Gynaecological Oncology Trial Groups und der Hoffmann-La Roche Ltd. durchgeführt. In Österreich wird diese Studie von der Arbeitsgruppe für Gynäkologische Onkologie (AGO Austria) durchgeführt. Derzeit partizipieren vier österreichische Studienzentren: die Medizinische Universität Wien, die Medizinische Universität Innsbruck, die Salzburger Landeskliniken und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz. In diese Studie werden Patientinnen mit weit fortgeschrittenem Ovarial-, Peritoneal- oder Tubenkarzinom (in den Stadien FIGO III und FIGO IV) eingeschlossen. Untersucht wird, ob die zusätzliche Gabe von Atezolizumab zur etablierten Standardtherapie einen Überlebensvorteil für Patientinnen mit weit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom mit sich bringt. In dieser Studie erhalten die Patientinnen entweder Carboplatin AUC 6/Paclitaxel 175mg/m<sup>2</sup> Bevacizumab 15mg/kg KG mit Placebo oder Carboplatin AUC 6/Paclitaxel 175mg/m<sup>2</sup> Bevacizumab 15mg/kg KG und Atezolizumab 1200mg.<br /> Atezolizumab ist ein humanisierter Anti- PD-L1-Antikörper, der initial in Ovarialzellen chinesischer Hamster entwickelt wurde. Durch die Bindung von PD-L1 verhindert Atezolizumab die Bildung des PD- 1/PD-L1-Komplexes. Dadurch kann der immunsupprimierende Effekt der Tumorzelle über PD-L1 nicht auftreten und die T-Zelle eine Immunantwort gegen die Tumorzelle in Gang setzen.<sup>1</sup> In vielen präklinischen, aber auch klinischen Untersuchungen zeigt Atezolizumab eine beträchtliche Wirksamkeit gegen solide Tumoren unterschiedlichen Ursprungs, wie das nicht kleinzellige Bronchuskarzinom, das maligne Melanom, das Urothel- und Nierenzellkarzinom sowie gegen das epitheliale Ovarialkarzinom.<sup>2–4</sup> In Europa ist Atezolizumab derzeit für die Therapie des nicht kleinzelligen Bronchuskarzinoms sowie des rezidivierten Urothelkarzinoms zugelassen.<br /> Patientinnen können in diese Studie entweder nach einer primären Debulkingoperation oder im Setting einer NACT eingeschlossen werden. Abbildung 1 zeigt das Studiendesign der beiden Behandlungsgruppen. Besonders interessant am Studiendesign der Gruppe primär operierter Patientinnen (Abb. 1a) ist, dass in diese Gruppe nur Patientinnen eingeschlossen werden können, bei denen während der Operation Tumorgewebe im Abdomen verblieben ist (R1). Diese Patientinnen werden dann randomisiert in einen der beiden Studienarme Carboplatin/Paclitaxel/Bevacizumab plus Placebo oder Carboplatin/Paclitaxel/ Bevacizumab plus Atezolizumab.<br /> Atezolizumab wird konkomitant zu jedem Chemotherapiezyklus verabreicht. Im Anschluss an die Chemotherapie wird Atezolizumab als Erhaltungstherapie, ähnlich wie von Bevacizumab bekannt, über ein Jahr verabreicht.<br /> Im Setting der NACT-Gruppe (Abb. 1b) können alle Patientinnen mit nicht resektablem Ovarialkarzinom der Stadien FIGO III und IV eingeschlossen werden, sofern diese einen entsprechend guten Performance- Status aufweisen. Im Gegensatz zum üblichen klinischen Prozedere erhalten Patientinnen der NACT-Gruppe Bevacizumab auch schon während der neoadjuvanten Therapiephase. Aufgrund des erhöhten Risikos für Wundheilungsstörungen wird Bevacizumab perioperativ pausiert. Die Gabe von Atezolizumab muss perioperativ nicht unterbrochen werden. Die Patientengruppen werden für die statistischen Analysen nach dem FIGO-Stadium, dem Performance-Status, dem PD-L1-Expressionsstatus des Tumors und nach der Behandlungsgruppe stratifiziert. Der primäre Endpunkt der Studie sind sowohl das progressionsfreie als auch das Gesamtüberleben.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Onko_1807_Weblinks_jatros_onko_1807_s78_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1267" /></p> <h2>Aktueller Studienfortschritt</h2> <p>Insgesamt soll diese Studie 55 Monate dauern und 1300 Patientinnen weltweit rekrutieren. Aktuell läuft die Rekrutierung weltweit sehr gut. Die derzeit vorliegenden Rekrutierungszahlen liegen knapp über dem aktuellen Rekrutierungsziel. Dies liegt vor allem am gut strukturierten und konsequenten Studiendesign, das es erlaubt viele Patientinnen aus unterschiedlichen Behandlungsgruppen in die Studie einzuschließen. Viele Studienzentren weltweit können daher schneller rekrutieren als zuvor erwartet. Dazu zählen auch die vier österreichischen Zentren, die bisher 8 Patientinnen eingeschlossen haben, und damit die Erwartungen erfüllen. Um die Studie erfolgreich abzuschließen, werden aktuell noch Patientinnen gesucht.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Chen DS, Mellman I: Oncology meets immunology: the cancer-immunity cycle. Immunity 2013; 39: 1-10 <strong>2</strong> Fehrenbacher L et al.: Atezolizumab versus docetaxel for patients with previously treated non-small-cell lung cancer (POPLAR): a multicentre, open-label, phase 2 randomised controlled trial. Lancet 2016; 387: 1837-46 <strong>3</strong> Infante JBF, Emens LA: Safety, clinical activity and biomarkers of atezolizumab in advanced ovarian cancer (OC). Eur Soc Med Oncol (ESMO) 2016, Poster, Abstr Poster 871p <strong>4</strong> Herbst RS et al.: Predictive correlates of response to the anti-PD-L1 antibody MPDL3280A in cancer patients. Nature 2014; 515: 563-7</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Erhaltungstherapie mit Atezolizumab nach adjuvanter Chemotherapie
Die zusätzliche adjuvante Gabe von Atezolizumab nach kompletter Resektion und adjuvanter Chemotherapie führte in der IMpower010-Studie zu einem signifikant verlängerten krankheitsfreien ...
Highlights zu Lymphomen
Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1
Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten
Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...


