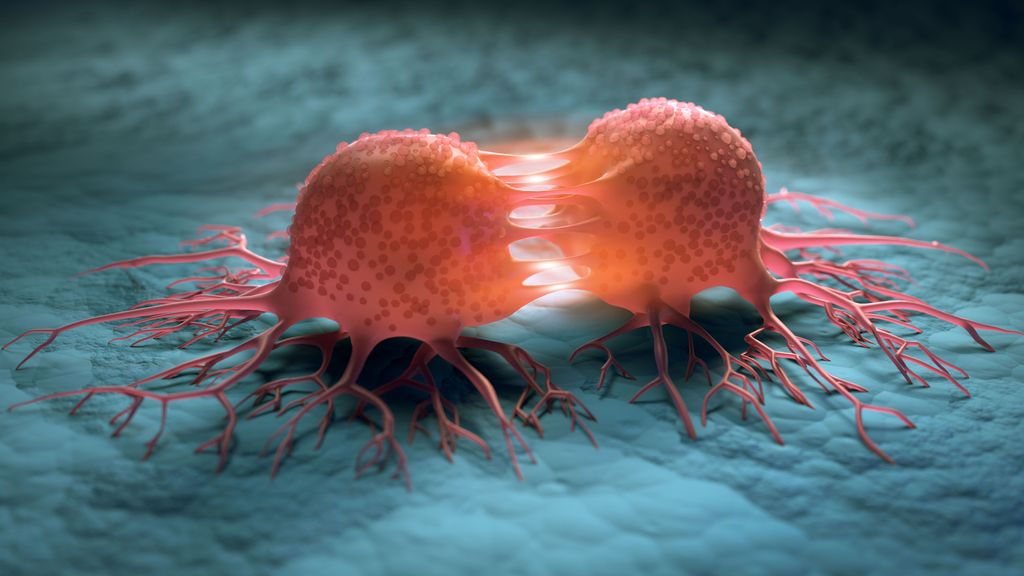<p class="article-intro">Biologicals sind hochmolekulare Proteine, die körpereigenen Proteinen nachempfunden sind und potenziell immunogen wirken können. Ihr Nebenwirkungsprofil unterscheidet sich deutlich von dem klassischer, kleinmolekularer Medikamente. Aufgrund ihrer stetig steigenden therapeutischen Relevanz ist es umso wichtiger, die entsprechenden zugrunde liegenden Pathomechanismen zu erkennen und klinisch adäquat zu reagieren.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Bei Biologicals handelt es sich verglichen mit klassischen kleinmolekularen Medikamenten um eine neue Art von Arzneimitteln, da sie Ähnlichkeiten mit menschlichen Proteinen aufweisen. Es sind potenziell immunogene Proteine, welche parenteral verabreicht werden und zur Entfaltung ihrer Wirkung nicht metabolisiert werden müssen (Tab. 1). Sie interagieren zielgerichtet mit Liganden und Rezeptoren auf Zelloberflächen oder können Signalwege in einer Zelle verändern.<sup>1</sup> Dementsprechend haben sie sich als effektive Behandlungsmöglichkeiten etabliert, insbesondere bei immunologischen, rheumatologischen, hämatologischen und onkologischen Erkrankungen. Mögliche Nebenwirkungen unterscheiden sich von denen klassischer, kleinmolekularer Medikamenten vor allem in Bezug auf die Pathogenese und die klinische Konsequenz.<sup>1</sup> Nebenwirkungen können auch je nach Art der Grunderkrankung des Patienten variieren. Vor allem Infusionsreaktionen haben meist unterschiedliche Pathomechanismen, sodass vom klinischen Bild eine Unterscheidung in allergische bzw. IgE-vermittelte Reaktionen und nicht allergische Reaktionen schwierig ist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Onko_1906_Weblinks_lo_onko_1906_s87_tab1_joerg_hausmann.jpg" alt="" width="550" height="232" /></p> <h2>Einteilung von Nebenwirkungen bei Biologicals</h2> <p>Nebenwirkungen bei Biologicals können anhand des Pathomechanismus klassifiziert werden und helfen, allfällige Reaktionen besser zu verstehen. Es existieren verschiedene Einteilungen, eine Möglichkeit ist die Klassifizierung analog zu der klassischen Einteilung der unerwünschten Arzneimittelwirkung A–E bei Medikamenten unter Verwendung der griechischen Buchstaben Alpha – Epsilon (Tab. 2):<sup>1, 2</sup><br /> Alpha-Reaktionen werden durch eine hohe Konzentration von Zytokinen ausgelöst, entweder direkt durch die Verabreichung des Biologicals als Zytokine (Interferon) oder durch die Freisetzung aus den körpereigenen Zellen. Möglich ist eine Vielzahl von Symptomen, von grippeähnlichen Beschwerden über anaphylaktoide Allgemeinreaktionen bis hin zum «Zytokin-Sturm» mit Multiorganbeteiligung. Bekanntestes Beispiel hierfür ist der CD28-Antikörper TGN-1412, welcher im Rahmen einer Phase-I-Studie bei mehreren Probanden eine lebensgefährliche Reaktion ausgelöst hat.<sup>3</sup> TNF-alpha-Blocker und Rituximab sind ebenfalls mögliche Auslöser, wenn auch zumeist in milderer Form.<sup>4</sup><br /> Bei den Beta-Reaktionen handelt es sich um die klassischen Hypersensitivitätsreaktionen. Da Biologicals meist in Tierzelllinien produziert werden, enthalten sie auch nicht humane Anteile. Selbst vollständig humanisierte Antikörper sind keine Ausnahme, insbesondere die Antigen-bindende Stelle wird hier als «fremde» Aminosäuresequenz erkannt. Daneben spielen auch die Glykosylierungseigenschaften eines Biologicals sowie allfällige Zusatzstoffe (z. B. Carboxymethylcellulose, Polysorbat 80 usw.) eine Rolle bei der Auslösung von Hypersensitivitätsreaktionen.<sup>5, 6</sup> Die Reaktionen sind in der Regel Soforttypreaktionen und Antikörper-vermittelt, nur selten sind auch T-Zellen involviert. Klassische IgE-vermittelte Reaktionen sind selten, wesentlich häufiger sind IgG-Antikörper involviert. Es wird vermutet, dass auch die Aktivierung des Komplementsystems eine Rolle spielt.<sup>7</sup><br /> Basierend auf dem Angriffsziel des Biologicals kann es zu einer Immunsuppression oder auch einer Immundysregulation kommen. Dies kann einerseits Infektionskrankheiten (z. B. Exazerbation einer Tuberkulose unter Tumornekrosefaktor[TNF]-alpha-Blockern), andererseits aber auch Autoimmunphänomene (z. B. Kolitis, Lupus-ähnliches Zustandsbild usw.) zur Folge haben. Solche Reaktionen werden unter Typ Gamma zusammengefasst.<sup>1, 2</sup><br /> Schlussendlich entstehen Typ-Delta-Reaktionen durch eine Kreuzreaktivität einer Zielstruktur, welche sowohl in krankhaften wie auch gesunden Zellen vorkommt. Unter Typ-Epsilon-Reaktionen werden weitere Nebenwirkungen zusammengefasst, bei welchen das Immunsystem nicht direkt beteiligt ist.<sup>1, 2</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Onko_1906_Weblinks_lo_onko_1906_s87_tab2_joerg_hausmann.jpg" alt="" width="550" height="232" /></p> <h2>Akute Infusionsreaktionen</h2> <p>Ein häufiges Problem bei der Gabe von Biologicals sind akute Infusionsreaktionen. Diese treten nicht selten auf, die Zahlen variieren je nach Biological und liegen zumeist im einstelligen Prozentbereich. Sie sind zum grössten Teil nicht allergischer Genese, der zugrunde liegende Mechanismus kann jedoch klinisch nicht immer sicher unterschieden werden. Der «Zytokin-Sturm» kann als Maximalvariante einer Infusionsreaktion gesehen werden.<sup>3</sup> Zu den häufigsten Symptomen gehören Juckreiz, Flushing, Dyspnoe, gastrointestinale Beschwerden, Arthralgien, Brust- und Rückenschmerzen sowie auch Fieber.<sup>8</sup> Letztere sprechen eher gegen eine Hypersensitivitätsreaktion, sondern vielmehr für ein Zytokin-Freisetzungssyndrom («cytokine-release syndrome», CRS). Urtikaria, Angioödeme, Nasenobstruktion und Dysphagie wie auch ein rasches Auftreten bei Infusionsbeginn hingegen wären typisch für eine Hypersensitivitätsreaktion (bzw. potenziell auch einen IgE-vermittelten Prozess) oder deuten auf eine schwere Reaktion hin. Der grösste Teil der Infusionsreaktionen ist mild und tritt in der Regel nicht zu Beginn, sondern erst im Therapieverlauf auf.<sup>1</sup></p> <h2>Therapie und Vorgehen bei akuten Infusionsreaktionen</h2> <p>Therapeutisch ist im Falle einer akuten Infusionsreaktion ein Stoppen der Infusion sowie eine symptomatische Behandlung wichtig. Vor allem bei milden Reaktionen, welche erst im Verlauf der Medikamentengabe auftreten, sind ein erneuter Start mit geringer Infusionsgeschwindigkeit oder eine langsame Gabe im Rahmen einer nächsten Infusion meist möglich.<sup>8</sup> Bei schweren Reaktionen sind ein sofortiger Stopp und eine Behandlung wie bei einer klassischen Anaphylaxie nötig. Die Behandlungsmassnahmen umfassen die Lagerung des Patienten, Volumengabe, die möglichst rasche Gabe von Adrenalin intramuskulär sowie auch die Gabe von Antihistaminika und systemischen Steroiden in einem weiteren Schritt.<sup>9</sup> Das Vorgehen in einer solchen Situation ist in Abbildung 1 zusammengefasst.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Onko_1906_Weblinks_lo_onko_1906_s88_abb1_joerg_hausmann.jpg" alt="" width="550" height="1018" /></p> <h2>Diagnostik bei Infusionsreaktionen auf Biologicals</h2> <p>Wichtig ist, anhand von Anamnese und Klinik den Schweregrad der Reaktion und den zugrunde liegenden Mechanismus zu erfassen. Hierbei kann auch die Serumtryptase hilfreich sein, vor allem, wenn innerhalb von 1–3 Stunden nach der Reaktion abgenommen. Die Serumprobe muss also nicht auch noch während der meist stressigen akuten Behandlungsphase abgenommen werden. Dies kann gut nach Stabilisierung des betroffenen Patienten erfolgen. Auch die Lagerung der Serumprobe ist unproblematisch (stabil bei Raumtemperatur bis 2 Tage, bei Kühlschranktemperaturen sogar bis 5 Tage). Da es sich um ein mastzellspezifisches Enzym handelt, beweist es die Beteiligung von Mastzellen an der Reaktion. Eine im Vergleich zum Basalwert erhöhte Tryptase weist auf eine Mastzellaktivierung hin.<sup>10</sup> Bei Verdacht auf eine allergische bzw. IgE-vermittelte Reaktion, insbesondere auch bei schweren oder rasch auftretenden Reaktionen, empfiehlt sich eine allergologische Abklärung.<br /> Ergänzend können Hauttests, insbesondere Prick- und Intradermaltest vorgenommen werden.<sup>10</sup> Diese sind jedoch bis auf wenige Ausnahmen nicht standardisiert<sup>11</sup> und können primär nur IgE-vermittelte Reaktionen erfassen. Da es sich bei den meisten Hypersensitivitätsreaktionen nicht um IgE-vermittelte Prozesse handelt, hilft der Hauttest oft nur beschränkt weiter. Hauttests sollten zudem frühestens 4–6 Wochen nach der Reaktion erfolgen. Ein positiver Befund hingegen deutet darauf hin, dass die betroffene Substanz gemieden werden soll oder dass eine erneute Gabe nur unter vorsichtiger Desaktivierung/Desensibilisierung erfolgen darf.<sup>10</sup></p> <h2>Risiko für Hypersensitivitätsreaktionen</h2> <p>Ob und wie ein Patient eine Hypersensitivitätsreaktion entwickelt, hängt von vielen Faktoren ab. Wie bereits erwähnt spielen aufseiten des Medikaments das Ausmass der Humanisierung, das Glykolysierungsmuster sowie Zusatzstoffe eine wesentliche Rolle.<sup>1</sup> Auch eine allfällige Komedikation hat einen Einfluss, so entwickeln Patienten unter gleichzeitiger immunsuppressiver Behandlung z. B. mit Methotrexat seltener Hypersensitivitätsreaktionen. Das Gleiche gilt für die zu behandelnde Erkrankung: Onkologische Erkrankungen stellen ein höheres Risiko für Infusionsreaktionen dar, da die Tumorlast gerade bei hämatoonkologischen Erkrankungen gut mit dem Ausmass der Zytokinfreisetzung korreliert. Weitere Risikofaktoren sind die intravenöse Gabe sowie eine hohe Infusionsgeschwindigkeit. Die Bedeutung einer allfälligen Atopie ist unklar.<sup>12</sup></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Biologicals sind hochmolekulare, potenziell immunogene Proteine und den körpereigenen Proteinen nachempfunden, weswegen sich ihre Nebenwirkungen von denen der klassischen, kleinmolekularen Medikamente deutlich unterscheiden. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen akute Infusionsreaktionen, welche jedoch nur zu einem kleinen Teil allergisch bedingt sind. Aufgrund des klinischen Bildes ist eine eindeutige Unterscheidung zwischen Hypersensitivitätsreaktion, CRS und klassischer Allergie oft schwierig. Da vor allem bei einem IgE-vermittelten Mechanismus ein striktes Vermeiden des Auslösers nötig ist oder im Falle einer Reexposition eine aufwendige Desaktivierung/Desensibilisierung erfolgen müsste, ist diese Unterscheidung wichtig. Hierbei kann neben Anamnese und Klinik die Bestimmung der Tryptase, gegebenenfalls auch eine Hauttestung weiterhelfen. Vor allem schwere oder rasch auftretende Reaktionen sollten allergologisch weiter abgeklärt werden.</p> </div></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Hausmann OV et al.: The complex clinical picture of side effects to biologicals. Med Clin North Am 2010; 94: 791- 804 <strong>2</strong> Pichler WJ: Adverse side-effects to biological agents. Allergy 2006; 61: 912-20 <strong>3</strong> Suntharalingam G et al.: Cytokine storm in a phase 1 trial of the anti-CD28 monoclonal antibody TGN1412. N Engl J Med 2006; 355: 1018-28 <strong>4</strong> Winkler U et al.: Cytokine-release syndrome in patients with B cell chronic lymphocytic leukemia and high lymphocyte counts after treatment with an anti- CD20 monoclonal antibody (rituximab, IDEC-C2B8). Blood 1999; 94: 2217-24 <strong>5</strong> Chung CH et al.: Cetuximab-induced anaphylaxis and IgE specific for galactose-alpha-1,3- galactose. N Engl J Med 2008; 358(11): 1109-17 <strong>6</strong> Grims RH et al.: Pitfalls in drug allergy skin testing: false-positive reactions due to (hidden) additives. Contact Dermatitis 2006; 54(5): 290-4 <strong>7</strong> Corominas M et al.: Hypersensitivity reactions to biological drugs. J Investig Allergol Clin Immunol 2014; 24(4): 212-225 <strong>8</strong> Boyman O et al.: Adverse reactions to biologic agents and their medical management. Nat Rev Rheumatol 2014; 10: 612-27 <strong>9</strong> Ring JBK et al.: Leitlinie zu Akuttherapie und Management der Anaphylaxie. Allergy J Int 2014; 23: 96-112 <strong>10</strong> Galvao VR et al.: Hypersensitivity to biological agents-updated diagnosis, management, and treatment. J Allergy Clin Immunol Pract 2015; 3: 175-85 <strong>11</strong> Brockow K et al.: Skin test concentrations for systemically administered drugs – an ENDA/ EAACI Drug Allergy Interest Group position paper. Allergy 2013; 68: 702-12 <strong>12</strong> Vultaggio A et al.: Immediate adverse reactions to biologicals: from pathogenic mechanisms to prophylactic management. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2001; 11: 262-8</p>
</div>
</p>