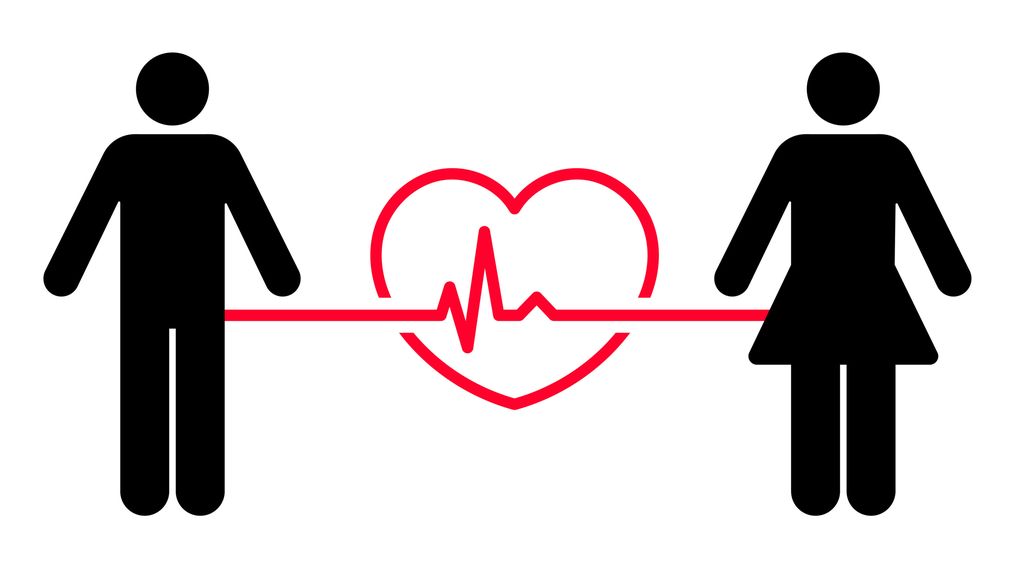
©
Getty Images/iStockphoto
Ablationstherapie von ventrikulären Rhythmusstörungen
Jatros
Autor:
Priv.-Doz. Dr. Markus Stühlinger
Univ.-Klinik für Innere Medizin III, Kardiologie<br/> Medizinische Universität Innsbruck<br/> Tirol Kliniken<br/> E-Mail: markus.stuehlinger@tirol-kliniken.at
30
Min. Lesezeit
16.05.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Nach einer anhaltenden ventrikulären Tachykardie (VT) mit EKG- Dokumentation oder Kammerflimmern (VF) im Rahmen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes muss nach Stabilisierung der Akutsituation die pathophysiologische Ursache der Rhythmusstörung eruiert werden. Ventrikuläre Rhythmusstörungen werden meist durch eine Myokardischämie oder aber durch ventrikuläre Extrasystolen (VES) auf Basis einer Kardiomyopathie (CMP) oder einer „elektrischen“ Herzerkrankung ausgelöst.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <p>Indikation zur Ablation bei häufigen VES und nicht anhaltenden VT</p> <ul> <li>häufige (> 10 % aller Schläge im 24 h-Holter) und symptomatische monomorphe VES</li> <li>Einschränkung der systolischen LV-Funktion durch VES</li> </ul> <p>Indikation zur Ablation bei anhaltenden VT bei struktureller Herzerkrankung</p> <ul> <li>häufige ICD-Schocks („VT-Sturm“) oder symptomatische VT</li> <li>Narben-abhängige CMP (iCMP, ARVD)</li> <li>adäquat funktionierendes ICD-System</li> <li>Leitlinien-definierte medikamentöse Therapie</li> <li>(VT-Rezidive trotz adäquater antiarrhythmischer Therapie)</li> </ul> </div> <p>Dementsprechend sollte jeder Patient mit dokumentierter, anhaltender VT oder VF einer intensiven Diagnostik mit seriellen EKG, KHK-Abklärung (CAG oder Herz-CT) und einer myokardialen Bildgebung (Echokardiografie und / oder MRT) unterzogen werden. Bei einer reversiblen Ursache (z. B. Ischämie) oder einer vorübergehenden Herzerkrankung (z. B. Myokarditis) steht die Behandlung derselben im Vordergrund. Trat die Rhythmusstörung allerdings auf Basis einer CMP oder einer Ionenkanalerkrankung auf, muss als Sekundärprophylaxe die Implantation eines implantierbaren Defibrillators (ICD) erwogen werden.</p> <h2>Katheterablation bei VES oder nicht anhaltenden VT</h2> <p>Das diagnostische und therapeutische Vorgehen bei nicht anhaltenden oder hämodynamisch gut tolerierten ventrikulären Rhythmusstörungen und VES ist im Vergleich zum oben beschriebenen Algorithmus schwieriger. So sollte auch bei diesen Arrhythmien zunächst eine Dokumentation im 12-Kanal-EKG und dann eine strukturelle Abklärung erfolgen. Nach Ausschluss einer Herzerkrankung bzw. bei Vorliegen von nur minimalen myokardialen Veränderungen kann allerdings als Alternative zur ICD-Implantation eine medikamentöse Therapie oder eine Ablationstherapie der VT erwogen werden. Bei Vorliegen von monomorphen Rhythmusstörungen, die von Prädelektionsstellen ausgehen, wird in der Regel eine interventionelle Therapie präferiert. Diese Entscheidung basiert auf Untersuchungen in kleinen Patienten-Kohorten, in denen Patienten entweder in einen Arm mit antiarrhythmischer Therapie oder in eine Gruppe mit einer Katheterablation der monomorphen VES randomisiert wurden. In diesen Studien konnte gezeigt werden, dass die Effektivität der Katheterablation die medikamentöse Therapie um ein Vielfaches übersteigt und dass sich die Symptomatik der Linksventrikel-Funktion nach einer erfolgreichen Ablation signifikant verbessert. Selbstverständlich ist das interventionelle Verfahren mit seltenen, aber manchmal signifikanten Risiken wie einer Perikardtamponade, einer Blutung oder einer Thromboembolie verbunden. Dennoch ist die Katheterablation von nicht anhaltenden VT oder VES aufgrund ihrer Effektivität bei sehr häufigen Rhythmusstörungen (z. B. Extrasystolie in > 10 % der Gesamtschläge im Holter), starker Symptomatik oder ventrikulärer Dysfunktion als Folge der VES heute die Therapie der Wahl (Abb. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Kardio_1902_Weblinks_a2-abb1.jpg" alt="" width="633" height="670" /></p> <h2>Katheterablation bei Kardiomyopathien</h2> <p>Patienten mit struktureller Herzerkrankung – insbesondere Kardiomyopathien – sind trotz ICD-Implantation gefährdet, Rezidive von VT und damit Schock-Therapien des ICD zu erleiden. Die wichtigste Maßnahme, um einerseits die Wandspannung des linken Ventrikels zu reduzieren und andererseits eine Progression der Grunderkrankung zu verhindern, ist eine durch entsprechende Richtlinien definierte medikamentöse Herzinsuffizienztherapie. So konnte eine neurohumorale Therapie mit Betablockern, ACE-Hemmern, AT- 2-Antagonisten, Aldosteron-Antagonisten und zuletzt auch ARNI das Auftreten von ventrikulären Tachyarrhythmien und auch des plötzlichen Herztods in den letzten 20 Jahren beträchtlich reduzieren. Auch die medikamentöse Therapie mit Antiarrhythmika – allen voran eine Kombination aus Betablockern und Amiodaron – reduziert die Häufigkeit von VT-Episoden und auch ICD-Schocks, eine Mortalitäts-Reduktion konnte durch diese Medikamente allerdings noch nicht nachgewiesen werden.</p> <p>Eine Katheterablation von ventrikulären Rhythmusstörungen nach ICD-Implantation ist daher neben der Herztransplantation eine gute Alternative, wenn VT refraktär auf Antiarrhythmika auftreten oder aber diese Medikamente aufgrund von Nebenwirkungen abgesetzt werden müssen. Besonders nach häufigen ICDEntladungen („elektrischer Sturm“, > 3 ICD-Schocks innerhalb von 24 Stunden) sollte daher dringend Kontakt mit einem Ablationszentrum aufgenommen werden. In der Regel wird bei einer VT-Ablation nach Auslösung der Rhythmusstörung der Ursprung der Tachykardie lokalisiert und mit hochfrequentem Wechselstrom über einen Katheter von endokardial behandelt. Oft werden die ausgelösten VT allerdings nicht so lange hämodynamisch toleriert, bis die Arrhythmie genau lokalisiert werden kann. Darüber hinaus können bei fortgeschrittener CMP verschiedene VT ausgelöst werden. Immer häufiger wird daher statt der Lokalisierung der VT ein Substrat- Mapping im Sinusrhythmus durchgeführt. Dabei wird das Endokard des linken und rechten Ventrikels mit Spezialkathetern abgetastet und dadurch die Narbe, aber auch mögliche myokardiale Kanäle an der Grenze zum gesunden Myokard, durch die ventrikuläre Rhythmusstörungen entstehen, gezielt mit Radiofrequenzablationen (RFA) behandelt. Durch diese Strategie konnte die Komplikationsrate, aber auch die Effektivität der Ablationsbehandlung signifikant verbessert werden. Besonders bei ischämischer Kardiomyopathie können die Infarktnarben definiert und Rhythmusstörungen verhindert werden (Abb. 2). Dennoch werden im Langzeitverlauf bei über 40 % aller Patienten Rezidive von VT festgestellt, was einerseits in der Progression der Grunderkrankung und andererseits in einer limitierten Tiefenwirkung der RFA begründet ist. Beim heutigen Stand der Technik kann die Ablationstherapie VT daher meist nicht stark genug unterdrücken, um als Alternative zur ICD-Implantation angewendet zu werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Kardio_1902_Weblinks_a2-abb2.jpg" alt="" width="691" height="569" /></p> <h2>Neue Trends und Limitationen der VT-Ablation</h2> <p>Einer der Gründe für die erhöhte Rezidivrate nach VT-Ablation ist die geringe Tiefe im Myokard, in die die RFA eindringen und dort Rhythmusstörungen unterdrücken kann. In den letzten Jahren wurden daher Techniken entwickelt, um die Arrhythmie von epikardial zu abladieren (Abb. 3). Dabei erfolgt eine subxiphoidale Punktion des Perikards, über die der Ablationskatheter eingeführt wird. Selbstverständlich ist diese Punktion (ohne Perikarderguss) sehr schwierig, darüber hinaus können extensive Ablationen zu Perikarditis und zu Verletzungen der Koronargefäße und des N. phrenicus führen. Allerdings kann die Rezidivrate durch eine zusätzliche epikardiale Ablation besonders bei nicht ischämischer Kardiomyopathie und arrhythmogener rechtsventrikulärer Dysplasie drastisch reduziert werden.<br /> Eine weitere Neuentwicklung ist die nicht invasive Ablation, bei der das Ablations- Target mittels Mehrkanal-EKG aufgezeichnet, mit einem MRT oder CT gekoppelt und dann mittels stereotaktischer Bestrahlung von extern behandelt wird. Erste Serien mit nur wenigen Patienten zeigen mit dieser Methode äußerst erfolgversprechende Ergebnisse, randomisierte Studien, die diese Technik mit der interventionellen RFA von VT vergleichen, sind derzeit in Planung.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Kardio_1902_Weblinks_a2-abb3.jpg" alt="" width="677" height="529" /></p> <h2>Zeitpunkt und Vorbereitung für die Ablation</h2> <p>Der richtige Zeitpunkt für die Ablationsbehandlung wird derzeit unter Experten intensiv diskutiert. Eine Akutablation einer ventrikulären Rhythmusstörung ist mit einem großen personellen und organisatorischen Aufwand verbunden. Darüber hinaus weisen VT-Patienten im elektrischen Sturm, im kardiogenen Schock oder mit schwerer Herzinsuffizienz und auch solche mit schwerer Niereninsuffizienz auch nach einer erfolgreichen RFA eine hohe Mortalität auf. Aus diesem Grund wird von immer mehr Experten empfohlen, eine frühe Ablationstherapie als Alternative zu einer intensivierten antiarrhythmischen Behandlung zu erwägen.<br />Jede VT-Ablation muss ausreichend geplant und vorbereitet werden. Das wichtigste Detail ist hierfür ein Anfalls-EKG mit 12 Standard-Ableitungen, um den Ursprung der Rhythmusstörung und damit das Ablationsziel eingrenzen zu können. Bei Patienten mit implantiertem ICD muss darüber hinaus vor der Intervention eine adäquate Funktion des Implantats bestätigt werden. Viele Zentren führen vor der Intervention auch eine kardiale Bildgebung – ein Thorax-CT oder Herz-MRT – durch, um den Zugangsweg für einen elektiven Eingriff zu planen, aber auch um myokardiale Narben und Aneurysmen für die Ablation zu visualisieren und intrakavitäre Thromben auszuschließen.<br />Auch die Nachbetreuung der Patienten muss langfristig gesichert sein. Eine signifikante Reduktion der kardialen oder der Gesamtmortalität ist darüber hinaus auch durch intensive interventionelle Verfahren wie die VT-Ablation bisher nicht gelungen. Daher benötigen Patienten auch nach erfolgreicher Ablationstherapie intensive Nachkontrollen durch Herzinsuffizienzspezialisten und Rhythmologen.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...
Labormedizinische Fallstricke bei kardialen Markern
Bei Schädigung oder Stress des Herzmuskels werden kardiale Marker in den Blutkreislauf freigesetzt. Ihre labormedizinische Bestimmung spielt eine Schlüsselrolle in der Diagnostik, ...


