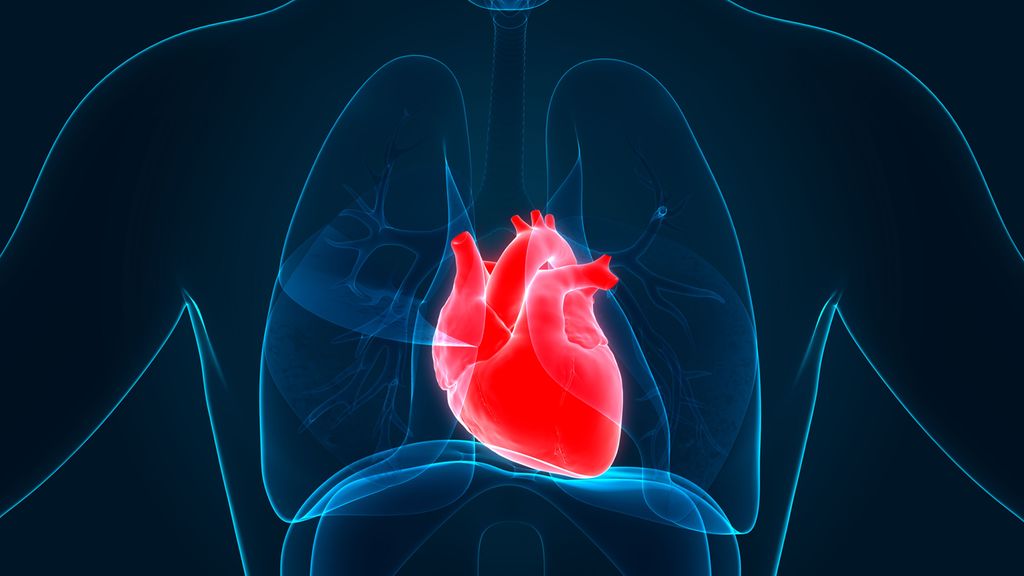
©
Getty Images/iStockphoto
HFmrEF: Übergangsstadium oder eigenständige Entität?
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
31.08.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Während die Behandlung der Herzinsuffizienz mit eingeschränkter linksventrikulärer Auswurffraktion u.a. durch die Einführung des Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin- Inhibitors Valsartan/Sacubitril (Entresto®) weiter verbessert werden konnte, wurden bei der Herzinsuffizienz mit erhaltener linksventrikulärer Auswurffraktion kaum Fortschritte verzeichnet. Das Gleiche gilt für die Behandlung der akuten Herzinsuffizienz.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Innere_1704_Weblinks_s39.jpg" alt="" width="2315" height="1144" /></p> <p>Die neue Einteilung der Herzinsuffizienz («heart failure», HF) anhand der linksventrikulären Auswurffraktion (LVEF), insbesondere die neu geschaffene Kategorie der HF mit einer mittleren («mid-range») LVEF von 40–49 % (HFmr- EF), wird auch ein Jahr nach dem Erscheinen der ESC-Guidelines kontrovers diskutiert. Während Prof. Dr. med. Roger Hullin, Universitätsspital Lausanne, seine Zweifel äusserte, ob es sich bei HFmrEF um eine eigenständige Entität handelt oder nicht vielmehr um ein Übergangsstadium, bezeichnete PD Dr. med. Micha T. Maeder vom Kantonsspital St. Gallen die neue Einteilung als korrekt. «Die aktuell empfohlene Behandlung der Herzinsuffizienz mit reduzierter LVEF (HFrEF) basiert auf grossen Studien, die Patienten mit einer LVEF <35 % oder <40 % eingeschlossen haben, weshalb der Grenzwert der HFrEF von 40 % konsequent ist», sagte Maeder. Andererseits haben Analysen von Studien zur HF mit erhaltener LVEF (HFpEF), die oft Patienten mit einer LVEF bis 40 % eingeschlossen haben, gezeigt, dass Patienten mit einer LVEF zwischen 40 und 50 % anders auf die Therapie reagieren als diejenigen mit einer LVEF >50 % («echte» HFpEF). Somit ergebe sich, gemäss Maeder, zwangsläufig die HFmrEF-Kategorie mit einer LVEF von 40–50 % . Es gibt gewisse Hinweise darauf, dass HFmrEFPatienten eher wie HFrEF- denn wie HFpEF-Patienten behandelt werden müssen. Die neue Kategorisierung eröffnet die Möglichkeit, mehr Informationen im Allgemeinen und über die Behandlung der HFmrEF und HFpEF im Speziellen zu gewinnen.</p> <h2>Was wissen wir über die HFmrEF?</h2> <p>Einer Analyse des ESC-Langzeitregisters zufolge ist rund ein Viertel der HFPatienten von einer HFmrEF betroffen.<sup>1</sup> Ähnlichkeiten und Differenzen finden sich sowohl zur HFrEF als auch zur Herzinsuffizienz mit erhaltener LVEF (HFpEF), wobei die Nähe zur HFrEF grösser ist. Dafür spricht unter anderem das Vorgehen bei der Behandlung. Wie aus der Analyse des Langzeitregisters ersichtlich ist, wurden die Betroffenen mit einer HFmrEF etwa gleich häufig mit Betablockern (BB), ACEInhibitoren (ACE-I) oder Angiotensin-Rezeptor- Blocker (ARB) behandelt wie Patienten mit einer HFrEF. «Obwohl wir keine Evidenz für diese Behandlung haben, glauben wir, dass die Betroffenen davon profitieren», sagte Hullin. Als weiteren Punkt, der die HFmrEF in die Nähe der HFrEF rückt, nannte der Kardiologe den positiven Einfluss der BNP-gesteuerten Therapie auf die Mortalität. Obwohl die BNP- und NT-proBNP-Spiegel bei der HFmrEF niedriger sind als bei der HFrEF, sind die Werte auch bei der HFmrEF ein wichtiger Marker für die Krankheitsprognose.</p> <h2>Hoffnung auf Spironolacton bei der diastolischen Herzinsuffizienz</h2> <p>Wie wenig man in der Behandlung der HFpEF (LVEF >50 % ) in der Hand hat, zeigt sich u.a. an den aktuellen Guidelines der ESC. Während das Management der HFrEF 31 Seiten umfasst, sind es bei der HFpEF gerade einmal knapp 1,5 Seiten. Die offiziellen Behandlungsempfehlungen beschränken sich darauf, die Patienten auf kardiovaskuläre (CV) und nicht kardiovaskuläre Komorbiditäten zu screenen und diese zu behandeln. Patienten mit Stauungssymptomen sollten zudem mit Diuretika therapiert werden.<sup>2</sup> Alle bisherigen Studien, welche die Behandlung mit bei HFrEF etablierten Medikamenten (wie z.B. ACE-I/ARB) bei Patienten mit HFpEF untersuchten, waren neutral. Lediglich in der CHARM-Preserved- Studie (Vergleich des ARB Candesartan mit Placebo bei Patienten mit einer LVEF >40 % ) zeigte sich ein Trend zu weniger Hospitalisationen.<sup>3</sup> Neue Analysen der Studie zeigen aber, dass dieses Resultat durch die Daten der Patienten mit einer LVEF von 40–50 % (also heute HFmrEF) und nicht durch diejenigen der Patienten mit «echter» HFpEF (LVEF =50 % ) zustande kam. «Sehr wenige Daten (auch keine negativen) gibt es für die Behandlung von BB bei HFpEF», sagte Maeder. Der If-Channel- Blocker Ivabradin (Procolaran<sup>®</sup>) wird analog den BB mit dem Ziel eingesetzt, mittels einer Reduktion der Herzfrequenz (HF) die diastolische Funktion zu verbessern. Die vielversprechenden Ergebnisse der Studie von Kosmala et al., bei der sich eine Verbesserung der diastolischen Funktion und der Leistungsfähigkeit von HFpEFPatienten durch die Behandlung mit Ivabradin zeigte, konnten in anschliessenden Studien nicht reproduziert werden.<sup>4–6</sup> Gross war die Enttäuschung zunächst, als die Ergebnisse der TOPCAT-Studie mit Spironolacton publiziert wurden.<sup>7</sup> Die Studie war in Zentren in den USA und Russland durchgeführt worden. Nachdem die Resultate zweier vorhergehender Studien mit dem Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten (MRA) bezüglich der diastolischen Funktion und Leistungsfähigkeit bei HFpEF-Patienten vielversprechend gewesen waren, fielen die Resultate der TOPCAT-Studie in Bezug auf den primären Endpunkt neutral aus. «Eine kürzlich im ‹New England Journal of Medicine› publizierte Analyse zu Spironolacton-Metaboliten und dem Verlauf des Serum- Kaliums in einer Subgruppe der TOPCATPopulation legte nun den Verdacht nahe, dass ein Teil der Patienten in Russland nicht mit dem Studienmedikament behandelt wurde», sagte Maeder. Zudem seien die Patienten in Russland offenbar weniger krank gewesen (sie hatten eine deutlich bessere Prognose). Betrachte man nur die Daten aus den USA, sei die Studie positiv. «Wenn neue Hoffnung für die Behandlung von HFpEF-Patienten besteht, dann ist der Grund dafür Spironolacton», sagte Maeder.</p> <h2>«ARNI beyond PARADIGM»</h2> <p>Zentraler Punkt der aktuellen ESCGuidelines zur Behandlung von Patienten mit einer HFrEF und einer EF =35 % , die trotz optimaler medikamentöser Behandlung noch immer symptomatisch sind, ist der Wechsel von ACE-I/ARB zu dem Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor (ARNI) Valsartan/Sacubitril (Entresto<sup>®</sup>). Dieser hat allein aufgrund der Ergebnisse der PARADIGM-HF-Studie Eingang in die Behandlungsempfehlungen gefunden.<sup>1, 8</sup> Obwohl die Ergebnisse mit einer Reduktion des relativen Risikos für den Eintritt des primären, kombinierten Endpunkts (CV Tod oder herzinsuffizienzbedingte Hospitalisation) um 20 % (p<0,001, für beide) unter Valsartan/Sacubitril im Vergleich zu Enalapril bei symptomatischen HFrEF-Patienten (NYHA I–IV) robust sind, «bleiben in der Behandlung noch viele Fragen offen», sagte PD Dr. med. Frank Enseleit vom Herzzentrum des Universitätsspitals Zürich. Eine davon betrifft den Einfluss der ARNI-Behandlung auf die Häufigkeit von Rehospitalisationen. Wie eine Subanalyse der PARADIGM-HF-Studie von Desai et al. zeigte, führte die Behandlung mit Valsartan/Sacubitril zu signifikant weniger Rehospitalisationen innerhalb von 30 Tagen nach der Entlassung. <sup>9</sup> Dies betraf die Häufigkeit von Rehospitalisationen aufgrund jeglicher Ursache (17,8 % vs. 21 % ; OR: 0,74; p=0,031) sowie die herzinsuffizienzbedingten Rehospitalisationen (9,7 % vs. 13,4 % ; OR: 0,62; p=0,006). Auch 60 Tage nach der Entlassung war die Rehospitalisationsrate bei den mit ARNI behandelten Patienten im Vergleich zur Enalapril-Gruppe niedriger. Der Unterschied war aber nicht statistisch signifikant. Weitere Subanalysen der PARADIGM-HF-Studie zeigten, dass der positive Behandlungseffekt von Valsartan/ Sacubitril unabhängig war von der medikamentösen Basistherapie und nicht durch die linksventrikuläre EF (=40 % ) beeinflusst wurde.<sup>10, 11</sup></p> <h2>Eisensubstitution: bei welchen Patienten und wie?</h2> <p>Die Empfehlung zur Eisensubstitution bei Patienten mit symptomatischer HFrEF und Eisenmangel (Serum-Ferritin <100µg/l; oder 100–299µg/l und Transferrinsättigung, TSAT <20 % ) basiert auf den Ergebnissen der beiden grossen Studien FAIR-HF und CONFIRM-HF.<sup>12, 13</sup> Diese hatten gezeigt, dass die Symptome der Herzinsuffizienz, die Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität der Betroffenen durch die i.v. Substitution von Eisencarboxymaltose (Ferinject®) verbessert werden. Eine kürzlich erschienene Metaanalyse zeigt zudem, dass die Eisensubstitution die Häufigkeit der Hospitalisationen infolge von Herzinsuffizienz reduziert.<sup>14</sup> Ob die Mortalität durch die Behandlung ebenfalls beeinflusst werden kann, soll die FAIR-HF-2-Studie untersuchen. Die Prävalenz des Eisenmangels bei HFrEF ist mit 55 % hoch, am häufigsten davon betroffen sind Frauen. «Bei Patienten mit chronischer HF, NYHA II–IV, ist die Kontrolle von Ferritin und TSAT sowie des Hämoglobins zum Ausschluss einer Anämie indiziert», sagte PD. Dr. med. Otmar Pfister vom Universitätsspital Basel. Die Eisensubstitution erfolgt intravenös und nach einem einfachen Schema (Abb. 1). Wie die kürzlich publizierten Ergebnisse der IRONOUT-Studie zeigten, hat die orale Eisensubstitution keinen Einfluss auf das klinische Outcome von HFrEF-Patienten. <sup>15</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Innere_1704_Weblinks_s39-2.jpg" alt="" width="1463" height="1698" /></p> <h2>Akute Herzinsuffizienz</h2> <p>«Die akute Herzinsuffizienz (AHF) ist angesichts einer nicht akzeptierbar hohen Rate von Morbidität und Mortalität und unglaublich vieler fehlgeschlagener Studien vermutlich die Erkrankung mit dem höchsten ‹unmet need›», sagte Prof. Dr. med. Christian Müller vom Universitätsspital Basel. Zwei vielversprechende Substanzen mit vasodilatierenden Eigenschaften, die zuletzt in der Behandlung der AHF untersucht worden sind, sind Ularitid und Serelaxin. Allerdings zeigen die nun publizierten Ergebnisse der TRUE-AHFStudie, dass die Behandlung mit Ularitid ergänzend zur Standardtherapie im Vergleich zu Placebo keinen Einfluss auf das klinische Outcome und das CV Überleben der untersuchten AHF-Patienten hatte.<sup>16</sup> Enttäuschend fielen auch die Ergebnisse der RELAX-AHF-2-Studie mit Serelaxin aus, die am jährlichen «Heart Failure Meeting» der ESC in Paris vorgestellt wurden. «Diese haben für Serelaxin verglichen mit Placebo weder eine Verbesserung des klinischen Outcomes noch einen Überlebensvorteil gezeigt», sagte Prof. Dr. med. John Teerlink, San Francisco. Die Ergebnisse stehen in Kontrast zur RELAX-AHFStudie, die eine signifikante Abnahme von Dyspnoe und anderen klinischen HF-Zeichen sowie eine signifikante Reduktion der Gesamtmortalität innerhalb von 180 Tagen nach Hospitalisation gezeigt hatte.<sup>17</sup></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie
(SGK), 7.–9. Juni 2017, Baden
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Chioncel O et al.: Epidemiology and one-year outcomes in patients with chronic heart failure and preserved, midrange and reduced ejection fraction: an analysis of the ESC Heart Failure Long-Term Registry. Eur J Heart Fail 2017 [epub ahead of print] <strong>2</strong> Ponikowski P et al.: 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail 2016; 18: 891-975 <strong>3</strong> Yusuf S et al.: Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and preserved left-ventricular ejection fraction: the CHARM-Preserved Trial. Lancet 2003; 362: 777-81 <strong>4</strong> Kosmala W et al.: Effect of If-channel inhibition on hemodynamic status and exercise tolerance in heart failure with preserved ejection fraction: a randomized trial. J Am Coll Cardiol 2013; 62: 1330-8 <strong>5</strong> Pal N et al.: Effect of selective heart rate slowing in heart failure with preserved ejection fraction. Circulation 2015; 132: 1719-25 <strong>6</strong> Komajda M et al.: Effect of ivabradine in patients with heart failure with preserved ejection fraction: the EDIFY randomized placebo-controlled trial. Eur J Heart Fail 2017 [epub ahead of print] <strong>7</strong> Pitt B et al.: Spironolactone for heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med 2014; 370: 1383-92 <strong>8</strong> McMurray JJ et al.: Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014; 371: 993-1004 <strong>9</strong> Desai AS et al.: Influence of sacubitril/ valsartan (LCZ696) on 30-day readmission after heart failure hospitalization. J Am Coll Cardiol 2016; 68: 241-8 <strong>10</strong> Okumura N et al.: Effects of sacubitril/valsartan in the PARADIGM-HF trial (Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure) according to background therapy. Circ Heart Fail 2016; 9: e003212 <strong>11</strong> Solomon SD et al.: Influence of ejection fraction on outcomes and efficacy of sacubitril/valsartan (LCZ696) in heart failure with reduced ejection fraction: the Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure (PARADIGM-HF) trial. Circ Heart Fail 2016; 9: e002744 <strong>12</strong> Anker SD et al.: Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. N Engl J Med 2009; 361: 2436-48 <strong>13</strong> Ponikowski P et al.: Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency. Eur Heart J 2015; 36: 657-68 <strong>14</strong> Jankowska EA et al.: Effects of intravenous iron therapy in iron-deficient patients with systolic heart failure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Heart Fail 2016; 18: 786-95 <strong>15</strong> Lewis GD et al.: Effect of oral iron repletion on exercise capacity in patients with heart failure with reduced ejection fraction and iron deficiency. The IRONOUT HF randomized clinical trial. JAMA 2017; 317: 1958-66 <strong>16</strong> Packer M et al.: Effect of ularitide on cardiovascular mortality in acute heart failure. N Engl J Med 2017; 376: 1956-64 <strong>17</strong> Teerlink JR et al.: Serelaxin, recombinant human relaxin-2, for treatment of acute heart failure (RELAX-AHF): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2013; 381: 29-39</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Mechanische Kreislaufunterstützung im Infarkt-bedingten kardiogenen Schock
Der Infarkt-bedingte kardiogene Schock (AMI-CS) ist trotz der enormen Fortschritte in der interventionellen Versorgung des akuten Myokardinfarktes in den vergangenen Jahrzehnten ...
ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen
Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...
ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport
Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...


