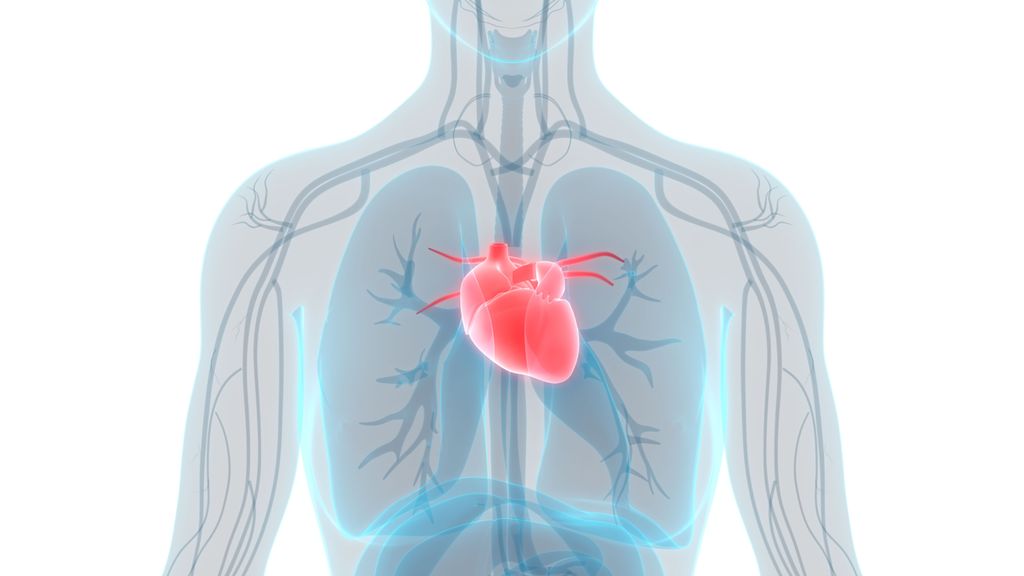
COPD-Medikation und das linke Herz
Autoren:
Prof. Dr. Peter Altera
Prof. Dr. Claus F. Vogelmeiera
Priv.-Doz. Dr. Rudolf A. Jörresb
aKlinik für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin, Philipps-Universität Marburg
bInstitut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin, Klinikum der Universität München
Korrespondierender Autor:
Prof. Dr. Peter Alter
Klinik für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin, Philipps-Universität Marburg
E-Mail: alter@uni-marburg.de
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die chronischobstruktive Lungenerkrankung (COPD) geht häufig mit funktionellen Auswirkungen auf das Herz einher. In den letzten Jahren wurde gezeigt, dass das Ausmaß der Beeinträchtigung der Lungenfunktion mit einem verringerten Linksherzvolumen und damit auch einem reduzierten Schlagvolumen assoziiert ist. Interventionelle COPD-Studien mit Präparaten zur Bronchodilatation haben gezeigt, dass die respiratorische Medikation zu einer Verbesserung der Linksherzfunktion führen kann. Unklar war allerdings, ob diese berichteten Kurzzeiteffekte auch mit einer COPD-Dauermedikation in der Langzeittherapie erzielt werden können. Um diese Frage zu beantworten, analysierten wir Daten aus der deutschen COSYCONET-COPD-Kohorte. Dabei zeigten sich für eine COPD-Dauermedikation mit den Substanzen ICS, ICS+LABA und LABA+LAMA im Echokardiogramm günstige kardiale Effekte in Form einer Verbesserung der linksatrialen Füllung.
Keypoints
-
Günstige Kurzzeiteffekte einer respiratorischen COPD-Medikation auf das linke Herz sind aus prospektiven randomisierten Therapiestudien bekannt.
-
Analysen der Beobachtungsstudie COSYCONET konnten statistisch robuste Zusammenhänge zwischen einem Parameter des linken Herzens (LA) und einer COPD-Dauermedikation mit ICS, LABA+ICS und LABA+LAMA zeigen.
-
Dies spricht dafür, dass eine respiratorisch effektive COPD-Dauertherapie nicht nur die Lungenfunktion, sondern auch die Linksherzfunktion verbessert.
Funktionelle Zusammenhänge zwischen Herz und Lunge sind seit vielen Jahrzehnten bekannt. Es ist geradezu klassisches pathophysiologisches Wissen, dass bei Lungenerkrankungen, die mit einer Erhöhung des Strömungswiderstandes im Gefäßbett einhergehen, eine Rechtsherzbelastung auftreten kann. Hierfür wurde der Begriff des „Cor pulmonale“ geprägt. Erkenntnisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass bei pulmonalen Erkrankungen, insbesondere der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD, auch Veränderungen am linken Herzen zu finden sind.1,2 Ein höherer Schweregrad der funktionellen pulmonalen Beeinträchtigung ist mit einem verkleinerten linken Herzen assoziiert. Hieraus kann beispielsweise ein reduziertes Herzzeitvolumen resultieren. Dies wiederum kann, wenn auch in kleinerem Ausmaß als die Lungenerkrankung selbst, zur Dyspnoe bei COPD beitragen.3
Wissen aus RCT
Prospektive randomisierte interventionelle Studien (RCT) haben gezeigt, dass eine medikamentöse Bronchodilatation bei COPD eine Verbesserung der linkskardialen Funktion bewirken kann. Dies wurde zuerst für eine ICS-LABA-Kombination („inhaled corticosteroid + long acting β2-agonist“) und in der Folge, in stärkerem Ausmaß, für eine duale Bronchodilatation mit einem LABA-LAMA-Präparat („long acting β2-agonist + long acting muscarinic receptor antagonist“) gezeigt.4,5 In diesen Studien waren die Patienten sehr gut charakterisiert, und die kardialen Untersuchungen erfolgten mit Magnetresonanztomografie, dem derzeitigen Goldstandard für die volumetrische und funktionelle Vermessung. Trotz einer recht kleinen Patientenzahl konnten signifikante Zusammenhänge identifiziert werden. Da es sich bei den genannten Studien um prospektive Interventionsstudien handelte, war die Therapiedauer begrenzt, und die Behandlungsdauer ging nicht über eine bzw. zwei Wochen hinaus. Daher stellt sich die Frage, ob die beobachteten kurzzeitigen Effekte auch bei einer COPD-Langzeitbehandlung zu finden sind, und, wenn ja, in welchen Messgrößen und in welchem Ausmaß.
Ergebnisse der COSYCONET-COPD-Kohorte
Wir haben daher in der COSYCONET-Kohorte („COPD and Systemic Consequences – Comorbidities Network“) untersucht, ob für eine COPD-Erhaltungstherapie ähnliche Effekte zu finden sind. COSYCONET ist eine multizentrische Langzeitbeobachtung von Patienten mit stabiler COPD ohne studienbedingte Intervention.
Initial wurden 2741 Patienten in COSYCONET eingeschlossen.6 Für die nachfolgend dargestellten Analysen wurden Daten der Visiten 1 und 3, welche 18 Monate auseinanderliegen, eingeschlossen.7 Nach Anwendung von Kriterien zur Qualitätskontrolle und Plausibilität konnten 846 Patienten in die Untersuchungen eingeschlossen werden.8,9 Das mittlere Patientenalter lag bei 65 Jahren, die mittlere Einsekundenkapazität (FEV1) bei 57% des Sollwertes, der Tiffeneau-Index (FEV1 dividiert durch forcierte Vitalkapazität) bei 0,53, und die Diffusionskapazität für Kohlenmonoxid (TLCO) bei 5% des Sollwertes. Ca. 18% der Patienten berichteten kardiovaskuläre Komorbiditäten in Form einer KHK, eines durchgemachten Myokardinfarktes oder einer bestehenden Herzinsuffizienz. Dies liegt in der Größenordnung, wie es für Patienten mit stabiler COPD zu erwarten und auch in anderen Studien berichtet ist, sodass die Kohorte als repräsentativ aufgefasst werden kann. Eine kardiovaskuläre Medikation in Form von ACE-Hemmern, AT-Antagonisten, Betablockern, Diuretika, Aldosteronantagonisten lag bei fast der Hälfte der Patienten vor (43%). Bei den meisten Patienten war die kardiale Funktion allerdings nicht beeinträchtigt, sodass vermutlich eine Hypertonie die Hauptindikation für die Medikation dargestellt haben dürfte. Die linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) lag im Mittel bei 62%, und auch die echokardiografisch gemessenen Linksherzdiameter bewegten sich weitaus überwiegend im Normbereich.
Im nächsten Schritt wurde die Konstanz der respiratorischen Medikation über die Visiten V1 und V3 untersucht; dies diente dazu, Patienten mit einer Mindestdauer einer spezifischen respiratorischen Therapie zu identifizieren. Eine ICS-Therapie zu beiden Visiten fand sich bei 53% der Patienten, eine LABA+ICS-Therapie bei 51%, eine LABA+LAMA-Therapie bei 56% und eine Tripeltherapie (ICS+LABA+LAMA) bei 40%. Für diese Analysen galt es als unerheblich, ob die Substanzen einzeln oder als „Fixed-dose“-Kombinationen vorlagen; aus einer früheren Analyse wissen wir, dass die Adhärenz zu Medikationen in COSYCONET-Patienten generell sehr hoch ist. Zu diesen Patientengruppen mit Therapiekonstanz wurde jeweils das Komplement gebildet, das heißt diejenigen Patienten identifiziert, die zu keinem der beiden Zeitpunkte eine solche Medikation aufwiesen. Hiermit war der stärkste Kontrast von Patienten mit versus Patienten ohne entsprechende Medikation für die Analysen gewährleistet.
Die Analysen erfolgten mittels adjustierter multivariater Regressionen sowie eines Matchings der jeweiligen Behandlungsgruppen über einen statistischen Score. Zu diesem Zweck wurden Messgrößen der Lungenfunktion, die kardiovaskuläre Vorgeschichte und Medikation, respiratorische Symptome (definiert über die GOLD-Gruppen BD vs. AC), die Exazerbationshistorie (definiert über die GOLD-Gruppen CD vs. AB), das Patientenalter, Geschlecht, Größe und Körperoberfläche als Prädiktoren der kardialen Funktion und Morphologie gewählt. Als entscheidender Prädiktor wurden dann die genannten vier Medikationsklassen (jeweils „immer“ vs. „nie“) hinzugefügt und auf statistische Signifikanz getestet. Die Zielgrößen, deren mögliche Beeinflussung durch die Medikation erfasst wurde, waren der linksatriale Diameter, der linksventrikuläre enddiastolische (LVEDD) und endsystolische Diameter (LVESD) sowie die linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF).
Es zeigten sich statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen einer ICS-, LABA+ICS- und LABA+LAMA-Therapie und dem linksatrialen (LA) Diameter,7 nicht jedoch den anderen echokardiografisch erfassten Größen. Patienten mit einer dieser Medikationen hatten einen im Mittel größeren LA-Diameter als Patienten ohne eine solche Medikation. Die Analysen mittels des Standardverfahrens der adjustierten Regressionsanalyse (Abb. 1) und des Matchings mittels Propensity Score (Abb. 2) ergaben übereinstimmende Ergebnisse, was die Größe der Effekte anging. Ferner waren die Effekte für die genannten drei Medikationen einander ähnlich, allerdings für LABA+LAMA am stärksten ausgeprägt. Dass sich für die Tripeltherapie kein statistisch signifikanter Effekt fand, war vermutlich der Tatsache geschuldet, dass die Vergleichsgruppe (niemals Tripel) immer noch potente Medikamente (z.B. ICS+LABA oder LABA+LAMA) enthielt und daher nur ein geringer Unterschied zu erwarten war.
Abb. 1: Die Säulen zeigen basierend auf adjustierten Regressionsanalysen geschätzte mittlere Effekte (und 95% CI) der respiratorischen Medikation auf den Diameter des linken Vorhofs (LA, in mm) für Therapien mit ICS, LABA+ICS, LABA+LAMA und die Tripeltherapie (ICS+LABA+LAMA), (p<0,05)
Abb. 2: Die Säulen zeigen basierend auf Propensity-Score-Matching geschätzte mittlere Effekte (und 95% CI) der respiratorischen Medikation auf den Diameter des linken Vorhofs (LA, in mm) für Therapien mit ICS, LABA+ICS, LABA+LAMA und die Tripeltherapie (ICS+LABA+LAMA), (p<0,05)
Interpretation
Der positive Zusammenhang zwischen der typischen respiratorischen Erhaltungs-Medikation und dem linksatrialen (LA) Diameter dürfte auf eine bessere Linksherzfüllung zurückzuführen sein. Der LADiameter war der einzige echokardiografisch erhobene Parameter, der signifikante Zusammenhänge aufwies. Dies dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass der linke Vorhof besonders sensitiv reagieren kann, da er anatomisch dünnwandig aufgebaut ist und damit suszeptibel für eine veränderte (erhöhte) Vorlast sein dürfte. Änderungen des Volumens oder der Funktion des linken Ventrikels, wie sie in den vorgenannten Interventionsstudien mit kardialer Magnetresonanztomografie auftraten, fanden sich in den Querschnittsanalysen der vorliegenden Studie nicht. Dies dürfte am ehesten auf die geringere Sensitivität der Echokardiografie zurückzuführen sein.
Zusammenfassung
Bei Patienten mit stabiler COPD fanden sich in einer Querschnittsanalyse Zusammenhänge zwischen einer COPD-Dauertherapie und dem linksatrialen Diameter. Diese Zusammenhänge waren signifikant für die Inhalation von ICS, LABA+ICS und LABA+LAMA. Die Ergebnisse sind konsistent mit denen prospektiver interventioneller Kurzzeitstudien und pathophysiologisch plausibel. Sie legen nahe, dass eine übliche respiratorische COPD-Medikation günstige Langzeiteffekte auf das linke Herzausübt. Umgekehrt wurden inzwischen positive Effekte einer systemischen Medikation für Komorbiditäten auf die Lunge gezeigt. Diese Beobachtungen unterstreichen, dass eine adäquate Einschätzung der COPD nicht nur Lunge, Komorbiditäten und organspezifische Medikation, sondern auch mögliche positive Kollateraleffekte der Medikation berücksichtigen sollte.
Literatur:
1 Watz H et al.: Decreasing cardiac chamber sizes and associated heart dysfunction in COPD: role of hyperinflation. Chest 2010; 138: 32-8 2 Barr RG et al.: Percent emphysema, airflow obstruction, and impaired left ventricular filling. N Engl J Med 2010; 362: 217-27 3 Alter P et al.: Prevalence of cardiac comorbidities, and their underdetection and contribution to exertional symptoms in COPD: results from the COSYCONET cohort. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2019; 14: 2163-72 4 Stone IS et al.: Lung deflation and cardiovascular structure and function in chronic obstructive pulmonary disease. A randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med 2016; 193: 717-26 5 Hohlfeld JM et al.: Effect of lung deflation with indacaterol plus glycopyrronium on ventricular filling in patients with hyperinflation and COPD (CLAIM): a double-blind, randomised, crossover, placebo-controlled, single-centre trial. Lancet Respir Med 2018; 6: 368-78 6 Karch A et al.: The German COPD cohort COSYCONET: aims, methods and descriptive analysis of the study population at baseline. Respir Med 2016; 114: 27-37 7 Kellerer C et al.: COPD maintenance medication is linked to left atrial size: results from the COSYCONET cohort. Respir Med 2021; 185: 106461 8 Alter P et al.: Left ventricular volume and wall stress are linked to lung function impairment in COPD. Int J Cardiol 2018; 261: 172-8 9 Alter P et al.: Airway obstruction and lung hyperinflation in COPD are linked to an impaired left ventricular diastolic filling. Respir Med 2018; 137: 14-22
Das könnte Sie auch interessieren:
Chronische Atemwegserkrankungen in einem sich verändernden Klima
Die global steigenden Temperaturen und zunehmenden Hitzewellen haben einen negativen Einfluss auf die Luftqualität, vor allem in Städten. Die Atemwege und die Lunge als Eintrittspforten ...
Pathobiologie und Genetik der pulmonalen Hypertonie
Für die 7. Weltkonferenz für pulmonale Hypertonie (World Symposium on Pulmonary Hypertension; WSPH) 2024 beschäftigten sich zwei Task-Forces aus 17 internationalen Experten allein mit ...




