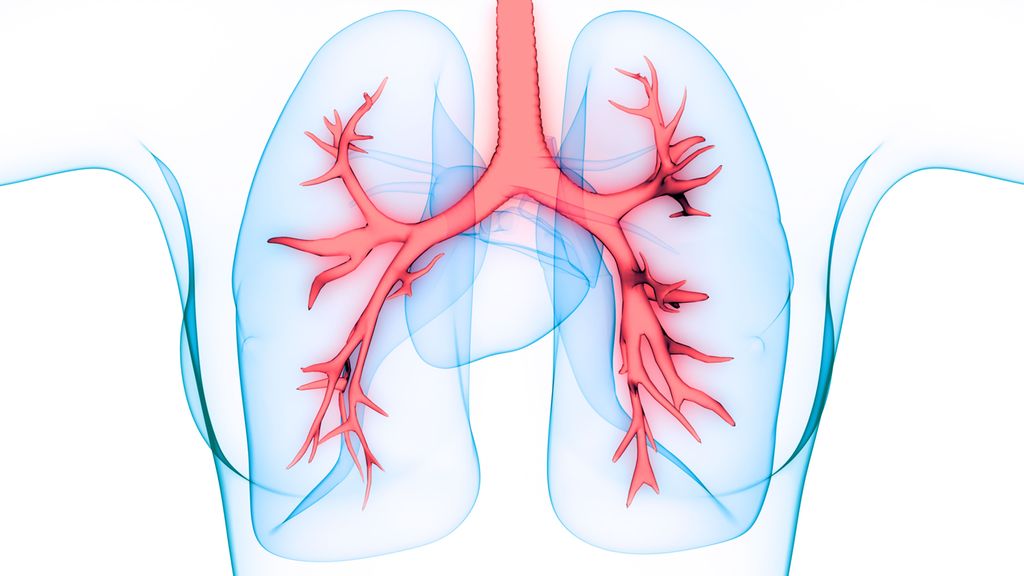
©
Getty Images/iStockphoto
Haustiere und Tierhaarallergie
Jatros
Autor:
Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Hemmer
Floridsdorfer Allergiezentrum, FAZ<br> E-Mail: hemmer@faz.at
30
Min. Lesezeit
14.12.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Felltragende Haustiere gehören weltweit neben Hausstaubmilben und Pollen zu den häufigsten Auslösern von Inhalationsallergien. Etwa 35–40 % der österreichischen Allergiker (das entspricht ca. 10 % der Gesamtbevölkerung) weisen eine Tierhaarsensibilisierung auf.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Unter den Haustieren, die Tierhaarsensibilisierungen verursachen können, steht die Katze mit Abstand an erster Stelle (Abb. 1). Dies ist einerseits Folge der hohen Allergenität der Katzenallergene, spiegelt aber andererseits auch die Beliebtheit der Katze bei den Tierhaltern wider: 40 % der österreichischen Haushalte beherbergen ein Haustier, davon 63 % eine Katze, gefolgt von Hund (42 % ) und – mit bereits deutlichem Abstand – Kleintieren wie Kaninchen, Meerschweinchen oder Hamster (13 % ).<sup>1</sup> Fast die Hälfte der Tierhalter besitzt gleich mehrere Haustiere.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Pneumo_1706_Weblinks_s11_abb1.jpg" alt="" width="1419" height="1061" /></p> <h2>Haustiere ja oder nein?</h2> <p>Als Quelle perennialer Innenraumallergene spielen Haustiere eine wichtige Rolle in der Pathogenese von allergischer Rhinokonjunktivitis und Asthma bronchiale. Schon früh wurde der Zusammenhang zwischen dem Tierbesitz und der Entwicklung allergischer Erkrankungen und Asthma systematisch beleuchtet. Insbesondere für den pädiatrischen Bereich existieren zahlreiche Querschnitts- und Kohortenstudien zum Risiko frühkindlicher oder pränataler Exposition gegenüber Katze und Hund, relevante Daten gibt es auch für Adoleszente und Erwachsene. Die Ergebnisse dieser Studien sind in Summe jedoch heterogen und teilweise widersprüchlich. Folgt man rezenten Metaanalysen, finden sich letztlich keine klaren Beweise, dass (frühkindlicher) Tierbesitz mit einem erhöhten Allergie- oder Asthmarisiko verbunden wäre.<sup>2</sup> In zahlreichen Studien finden sich sogar Hinweise auf gewisse protektive Effekte, insbesondere durch Hundebesitz. <br />Die aktuelle Leitlinie zur primären Allergieprävention empfiehlt demnach generell keine Einschränkung bezüglich Haustierhaltung bei Personen ohne erhöhtes Allergierisiko, und selbst bei Risikokindern wird lediglich von der Neuanschaffung einer Katze abgeraten (bereits vorhandene Tiere können behalten werden), da dies bei manchen zwar nicht mit einem erhöhten Asthmarisiko, aber mit einem erhöhten Ekzemrisiko einhergehen könnte.<sup>3</sup> Hunde gelten generell als unbedenklich.<br /> Die in epidemiologischen Studien und insbesondere in Metaanalysen aufgezeigten möglichen protektiven Effekte wurden mit dem Hinweis auf methodische Fehlerquellen wiederholt angezweifelt. Insbesondere die Möglichkeit, dass Personen/ Familien mit hohem Atopierisiko Tierkontakte a priori meiden bzw. dass zwischenzeitlich Erkrankte ihre Tiere in der Folge wieder weggeben, könnte erklären, warum letztlich bei Nichttierbesitzern höhere Sensibilisierungsraten gefunden werden als bei Tierbesitzern und sich Tierbesitz als vermeintlich protektiv erweist. Die spezielle Analyse derartiger Effekte in einigen Studien spricht aber dafür, dass diese Mechanismen nur begrenzt wirksam sein dürften.<sup>4</sup> Wichtiger Grund dafür ist die hohe emotionale Bindung der meisten Tierbesitzer an ihr Haustier, was auch im Falle einer manifesten Allergie selten zur Weggabe des Tieres führt. Auch hält ein bereits bekanntes familiäres Allergierisiko häufig nicht von der Anschaffung eines Haustieres ab.</p> <h2>Tierbesitz und Allergierisiko</h2> <p>Dass zwischen Tierexposition und Sensibilisierungsrisiko dennoch ein kausaler Zusammenhang bestehen muss, zeigt sich sowohl epidemiologisch als auch bei der Betrachtung spezieller Sensibilisierungsmuster. Die hohe Prävalenz von Katzenallergien in Mitteleuropa spiegelt die Dominanz der Katze als beliebtestes Haustier wider. In Ländern, in denen mehr Hunde als Katzen gehalten werden, zeigen die Sensibilisierungsraten ein umgekehrtes Verhältnis.<br /> Dass Katzenhaarallergien bei uns auch bei vielen Personen auftreten, die niemals eine Katze besessen haben, ist gut durch die ubiquitäre Präsenz von (verschleppten) Katzenallergenen im öffentlichen Raum (Schulen, Arbeitsplatz, öffentliche Verkehrsmittel etc.) erklärbar. So haben beispielsweise Untersuchungen an deutschen Schulkindern ohne Katze ergeben, dass das Sensibilisierungsrisiko mit der Anzahl der Katzenbesitzer unter den Mitschülern steigt. Mithilfe der modernen komponentenbasierten Allergiediagnostik (s.u.) lässt sich erkennen, dass die Situation bei Hundeallergien anders als bei der Katze ist: Hier besteht eine sehr viel engere Assoziation zwischen Sensibilisierung und Hundebesitz. Auch die vergleichsweise seltenen Allergien gegen Kleintiere (Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Maus, Ratte) unterstreichen den kausalen Zusammenhang zwischen Tierkontakt und Sensibilisierung: Solche Sensibilisierungen können zwar auch im Rahmen von Kreuzallergien auftreten, sehr oft sind sie aber monospezifisch gegen ein ganz bestimmtes Tier gerichtet und stehen im Einklang mit einer entsprechenden Exposition.</p> <h2>Allergiediagnostik bei Tierhaarallergien: das Problem der Polysensibilisierungen</h2> <p>Etwa die Hälfte aller Tierhaarallergiker reagiert beim Allergietest auf mehr als eine Tierart, obwohl der Kontakt mit diesen anderen Tieren häufig als unproblematisch angegeben wird. Monovalente Sensibilisierungen gegenüber einer einzigen Tierart sieht man am häufigsten bei Katzenallergikern. Gründe dafür sind die Omnipräsenz und hohe allergene Potenz des Katzenhauptallergens Fel d 1. Dennoch war in einer aktuellen Studie des Floridsdorfer Allergiezentrums mit über 300 Tierhaarallergikern jeder zweite Katzenallergiker im Allergietest auch für Hund und/oder Pferd positiv.<br /> Unter den Hundeallergikern waren lediglich 13 % ausschließlich gegenüber dem Hund sensibilisiert, bei den Pferdeallergikern gar nur 6 % . Dies spricht dafür, dass polyvalente Tierhaarsensibilisierungen häufig Ausdruck von Kreuzreaktionen zwischen verwandten Tierallergenen sind und nicht immer „echte“ Sensibilisierungen darstellen. Bisher existieren nur wenige Untersuchungen zum molekularen Hintergrund derartiger Polysensibilisierungen und zu ihrer klinischen Relevanz.</p> <h2>Einblick in individuelle Sensibilisierungsmuster durch die molekulare Allergiediagnostik</h2> <p>Bei der traditionellen Diagnostik mit Gesamtextrakten bleibt offen, ob bei Patienten mit positiven Testreaktionen auf mehrere Tiere eine echte Mehrfachsensibilisierung oder lediglich eine Kreuzreaktivität vorliegt. Die moderne, auf Einzelallergenen beruhende Komponentendiagnostik gewährt erstmals Einblick in individuelle Sensibilisierungsmuster und deren molekulare Hintergründe. Sie erlaubt dem Allergologen eine Unterscheidung zwischen genuiner Sensibilisierung und Kreuzreaktivität.<br /> Die Situation ist hier im Prinzip vergleichbar mit der Situation bei Pollenallergien, bei denen die gezielte In-vitro-Testung auf bestimmte „Markerallergene“ inzwischen Standard ist, um sicher zwischen genuiner Sensibilisierung und Kreuzreaktion zu unterscheiden und im Falle einer Immuntherapie den korrekten Impfstoff auszuwählen. Auch wenn Immuntherapien bei Tierhaarallergien aus verschiedenen Gründen nur selten durchgeführt werden, könnte diese Diskriminierung künftig bei der Beurteilung der möglichen klinischen Relevanz von Mehrfachsensibilisierungen wichtig sein und zu einem verbesserten Patientenmanagement führen.</p> <h2>Die komplexe Welt der Tierhaarallergene</h2> <p>Während für alle wichtigen Pollenarten sehr selektive Markerallergene identifiziert werden konnten, mit deren Hilfe eine verlässliche Diagnose möglich ist, ist die Situation bei den Tierhaarallergien unglücklicherweise schwieriger. Fast alle bekannten Tierhaarallergene gehören nämlich Proteinfamilien an, die grundsätzlich in vielen (oder gar allen) Tierarten vorkommen (Tab. 1). Da innerhalb jeder Allergenfamilie, je nach Ähnlichkeit der einzelnen Vertreter untereinander, Kreuzreaktionen möglich sind, können sich sehr komplexe Sensibilisierungsmuster ergeben.<br /> Die am längsten bekannten Allergene mit starker Kreuzreaktivität sind die Serumalbumine. Sie wurden früher als wichtigste Ursache einer polyvalenten Tierhaarsensibilisierung angesehen, da sie in praktisch allen felltragenden Tieren vorkommen und strukturell stark konserviert sind. Als kreuzreaktive Allergene noch wichtiger scheinen neueren Forschungsergebnissen zufolge allerdings die Lipocaline zu sein, eine sehr umfangreiche Proteinfamilie, der zahlreiche Haupt- oder Nebenallergene von Katze, Hund, Pferd und diversen Kleintieren angehören. Die Sequenzübereinstimmungen zwischen verschiedenen Lipocalinen sind extrem unterschiedlich (<20 % bis >70 % ), entsprechend komplex können sich die Kreuzreaktionsmuster gestalten.<br /> Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Tiere gleich mehrere verschiedene Lipocaline produzieren, die untereinander oft weniger Ähnlichkeit aufweisen als mit den Lipocalinen anderer Arten. So sind beim Hund bereits vier verschiedene Lipocalin-Allergene bekannt, bei der Katze zwei. Kreuzreaktionen gibt es aber nur zwischen Hund und Katze, aber nicht innerhalb der beiden Spezies.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Pneumo_1706_Weblinks_s11_tab1.jpg" alt="" width="1418" height="1132" /></p> <h2>Praktischer Nutzen der Komponentendiagnostik im Alltag?</h2> <p>Auch wenn die Komponentendiagnostik dem Allergologen eine plausible molekulare Erklärung für komplexe Sensibilisierungsmuster liefert, stellt sich die Frage nach dem praktischen Nutzen dieser Informationen. Rezente klinische Studien zu Tierhaarkomponenten betreffen fast ausschließlich Kinderkohorten, in denen molekulare Sensibilisierungsdaten im Hinblick auf Asthmarisiko und Schweregrad analysiert und als prognostisch hilfreich erkannt wurden.<sup>5</sup> Der tatsächliche Vorteil der Komponentendiagnostik gegenüber der konventionellen Extrakt-basierten Diagnostik im klinischen Routinebetrieb wurde bisher noch kaum systematisch untersucht.<br /> Ein anschauliches und klinisch relevantes Beispiel für den potenziellen Gewinn durch die Komponentendiagnostik sind Katze-Hund-Doppelsensibilisierungen. Diese Konstellation findet sich bei etwa 25 % aller tierhaarsensibilisierten Routinepatienten, wobei es sich vielfach um klinische Katzenallergiker ohne bekannte Hundeallergie handelt. Durch selektive Testung auf die bekannten Markerallergene in Katze (Fel d 1) und Hund (Can f 1, 2 und 5) kann nun gezielt eine genuine Katzen- und/oder Hundeallergie nachgewiesen bzw. ausgeschlossen werden (Abb. 2). Die Untersuchung eigener Katze-Hund-doppeltpositiver Routinepatienten (n=80) ergab dabei, dass nur 50 % tatsächlich eine genuine Hundesensibilisierung aufwiesen, während in allen anderen Fällen lediglich eine Kreuzsensibilisierung über Minorallergene vorlag. Bei der Erhebung klinischer Daten zeigte sich schließlich, dass allergische Symptome bei Hundekontakt signifikant häufiger bei den Patienten mit „echter“ Hundesensibilisierung auftraten, nur selten und schwach hingegen bei denen mit einer Kreuzsensibilisierung.<br /> Die Kenntnis der molekularen Sensibilisierungsmuster könnte sich somit in Zukunft als hilfreich bei der Beurteilung der klinischen Relevanz von Tierhaarsensibilisierungen erweisen und vermehrt individualisierte Empfehlungen im Sinne einer personalisierten Medizin zulassen, auch wenn die derzeit noch präliminären Daten an größeren Patientenkollektiven kritisch überprüft werden müssen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Pneumo_1706_Weblinks_s11_abb2.jpg" alt="" width="1419" height="694" /></p> <h2>Can f 5 – ein rein männliches Hundeallergen</h2> <p>Ein weiteres plakatives Beispiel für den konkreten Nutzen der aktuellen Komponentendiagnostik ist das Hunde-Majorallergen Can f 5. Dieses Allergen ist identisch mit Prostata-Kallikrein und wird nur von männlichen Tieren gebildet. Patienten, die ausschließlich gegenüber diesem Hundeallergen sensibilisiert sind, wären demnach in der Lage, gefahrlos ein weibliches Tier zu halten. Im eigenen Patientenkollektiv traf dies auf knapp 30 % der Hundeallergiker zu.<br /> Can f 5 findet sich primär im Urin und gelangt erst sekundär durch Kontamination auf das Hundefell. Interessanterweise findet man IgE-Antikörper gegen Can f 5 fast ausschließlich bei Besitzern männlicher Hunde, was den Zusammenhang zwischen Sensibilisierungsmuster und realer Exposition eindrucksvoll unterstreicht. Erwähnenswert ist überdies die hohe Homologie von Can f 5 mit humanem PSA, die 55–60 % beträgt. Dies kann infolge von Kreuzreaktionen bei Can-f-5-sensibilisierten Frauen in Einzelfällen zu anaphylaktischen Reaktionen bei Kontakt mit Sperma führen.<sup>6</sup></p> <h2>Komponentendiagnostik – aktuelle Limitationen und Ausblick</h2> <p>Trotz des verbesserten Verständnisses von individuellen Sensibilisierungsmustern durch die derzeit kommerziell verfügbaren Komponenten bleiben die Zusammenhänge in vielen Fällen unklar und die möglichen Schlüsse begrenzt. Bei den Kleintieren ebenso wie bei landwirtschaftlichen Nutztieren (Rind, Schaf etc.) und Wild stehen aktuell fast gar keine Einzelkomponenten zur Verfügung, aber auch bei Katze, Hund und Pferd fehlen wichtige Nebenallergene. Im Sinne eines umfassenden Verständnisses von bei Tierhaarallergien möglichen Kreuzreaktionen und eines letztlich besseren Patientenmanagements wäre ein erweitertes Panel an Testmolekülen für gezielte Studien zum Stellenwert einzelner Allergene und zur klinischen Relevanz ihrer Kreuzreaktionen wünschenswert.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Spectra Market Investigation, 2013, www1.spectra.at/ cms/aktuelles/spectra-aktuell/2013/ <strong>2</strong> Lødrup Carlsen KC et al.: Does pet ownership in infancy lead to asthma or allergy at school age? Pooled analysis of individual participant data from 11 European birth cohorts. PLoS One 2012; 7(8): e43214 <strong>3</strong> Schäfer T et al.: S3-Leitlinie Allergieprävention - Update 2014. Leitlinie der DGAKI und der DGKJ. Allergo J Int 2014; 23: 32-45 <strong>4</strong> Almqvist C et al.: Effects of early cat or dog ownership on sensitisation and asthma in a high-risk cohort without disease-related modification of exposure. Paediatr Perinat Epidemiol 2010; 24: 171-8 <strong>5</strong> Bjerg A et al.: A population-based study of animal component sensitization, asthma, and rhinitis in schoolchildren. Pediatr Allergy Immunol 2015; 26: 557-63 <strong>6</strong> Kofler L et al.: A case of dog-related human seminal plasma allergy. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2012; 44: 89-92</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Chronische Atemwegserkrankungen in einem sich verändernden Klima
Die global steigenden Temperaturen und zunehmenden Hitzewellen haben einen negativen Einfluss auf die Luftqualität, vor allem in Städten. Die Atemwege und die Lunge als Eintrittspforten ...
Pathobiologie und Genetik der pulmonalen Hypertonie
Für die 7. Weltkonferenz für pulmonale Hypertonie (World Symposium on Pulmonary Hypertension; WSPH) 2024 beschäftigten sich zwei Task-Forces aus 17 internationalen Experten allein mit ...


