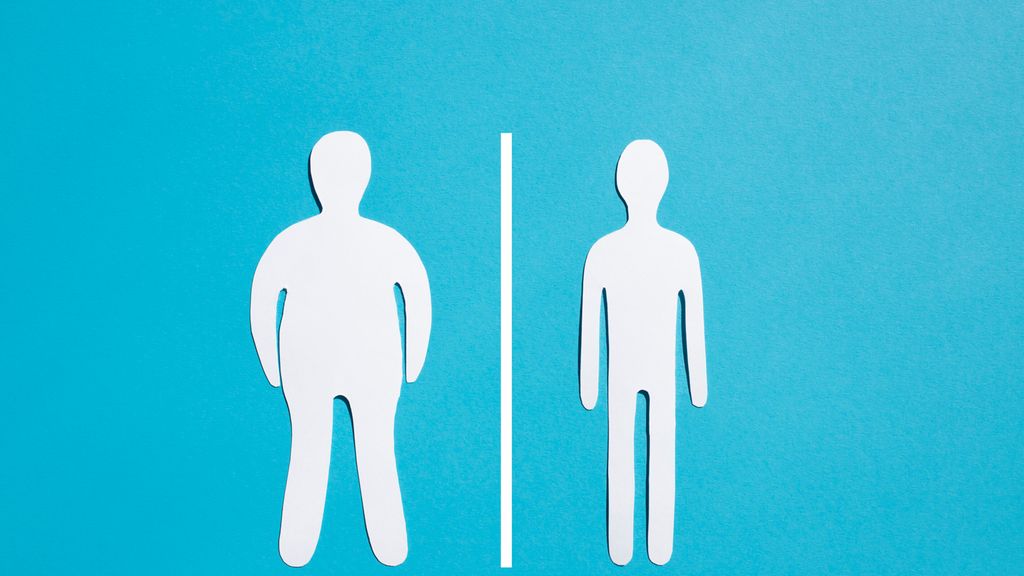
Adipositasbehandlung – weg von der Schuldzuweisung, hin zur Therapie
Das Interview führte Christian Fexa
Unsere Gesprächspartnerin:
OÄ Dr. Johanna Brix
Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft, Fachärztin für Innere Medizin, 1. Med. Abteilung, Klinik Landstraße, Wien
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Dr. Johanna Brix ist Oberärztin in der Klinik Landstraße in Wien und seit Herbst 2021 Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft. Wir gehen mit ihr der spannenden Frage nach, wie es in Österreich um das Thema Adipositas steht.
Frau Dr. Brix, wie ist es um die Adipositas in Österreich bestellt?
J. Brix: Prinzipiell nicht gut. Adipositas ist seit dem Jahr 2000 eine durch die WHO anerkannte Erkrankung. Dies wird in Österreich aber nicht gelebt, obwohl wir, wie viele andere europäische Länder, in den letzten Jahren eine starke Zunahme der Adipositas gesehen haben.
Welchen Einfluss hat Corona darauf gehabt? Gibt es dazu Daten?
J. Brix: Die letzten zwei Jahre der Corona-Pandemie haben die Lage verschärft. Aber es gibt keine gute Übersicht, um wie viel schlechter die Situation geworden ist. Uns stehen derzeit nur geringe Zahlen zu Kindern aus Klagenfurt zur Verfügung. An diesen sieht man, dass sich das Problem nochmals aggraviert haben dürfte.
Was bedeutet es für unser Gesundheitssystem, wenn die Adipositaszahlen so steigen?
J. Brix: Adipositas ist eine starke Belastung für unser Gesundheitssystem. Wir wissen, dass im Gesundheitssystem aufgrund der Folgen der Adipositas jährliche Kosten von bis zu 3 Milliarden Euro entstehen. In der aktuellen Corona-Situation kommt hinzu, dass Adipositas gemeinsam mit der Herzinsuffizienz als einziger Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf übrig geblieben ist. Wir rechnen daher auch aus diesem Grund mit zusätzlichen Kosten. Außerdem ist Adipositas eine Gatekeeper-Erkrankung für viele andere Erkrankungen.
Was hat die ÖAG mit ihrem Engagement gegen Adipositas bis jetzt erreicht?
J. Brix: Die ÖAG hat in den letzten Jahren viel erreicht. Wir feiern heuer das 25-jährige Bestehen der Österreichischen Adipositas Gesellschaft. Wir versuchen eine wissenschaftliche Community aufzubauen, was in einem kleinen Land wie Österreich nicht leicht ist, insbesondere weil Adipositas oft nur als Anhang zu Diabetes oder zu hormonellen Erkrankungen gesehen wird. Mit einem Wissenschaftsschwerpunkt kann das Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Adipositas eine eigenständige Erkrankung ist, bei der es wichtig ist, sie zu verstehen und Therapieansätze zu finden. Was die ÖAG auszeichnet, ist die Interdisziplinarität. Adipositas ist eine Erkrankung, die nicht eine Sparte alleine lösen kann: weder Arzt noch Diätologie noch Physiotherapie. Viele verschiedene Disziplinen müssen zusammenarbeiten, um ein gutes Therapiekonzept zu erstellen. Dies sieht man auch, wenn man zum Beispiel den Vorstand der ÖAG betrachtet. Diese hat sich die Interdisziplinarität auch auf die Fahnen geschrieben.
Planen Sie für die Zukunft einen Ausbau?
J. Brix: In den letzten Jahren haben meine Vorgänger eine Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Adipositas- und Metabolische Chirurgie begonnen. Ich halte in dem Zusammenhang die gemeinsame Jahrestagung für sehr wichtig, weil die bariatrische Chirurgie eine wichtige Säule der Adipositastherapie ist. Auch hier sind die Interdisziplinarität und der Austausch untereinander wichtig.
Ein zweites Ziel ist die Erstattung der medikamentösen Therapie der Adipositas. Dazu haben wir mit den Sozialversicherungen Kontakt aufgenommen.
Der dritte große Schwerpunkt werden Behandlungsleitlinien und ein Konsensuspapier sein. Wir haben heuer Ende März das erste Mal eine Adipositasklausur abgehalten, zu der wir alle Internistinnen und Internisten, die sich in Spitalsambulanzen mit Adipositas beschäftigen, eingeladen haben, um uns mit Fragen wie diesen zu beschäftigen: Wo stehen wir? Was sind die dringendsten Fragen? Derzeit gibt es nämlich noch kein Konsensuspapier zur Behandlung der Adipositas.
Sie behandeln ja auch Adipositaspatienten selbst. Wer sind diese, wie schauen sie aus?
J. Brix: Wenn man sich Studiendaten ansieht, dann ist der erste Ansprechpartner für einen Menschen mit Adipositas immer die Hausärztin oder der Hausarzt – und das ist gut so. Zu mir in die Spezialambulanz kommen meist Menschen mit einer sehr weit fortgeschrittenen Erkrankung. Diese haben eine schwere Adipositas, sodass sehr häufig eine bariatrische Operation notwendig ist. Eine andere Gruppe von Patienten kommt nach einem solchen Eingriff aufgrund von Komplikationen und Spätfolgen. Eine Herausforderung ist, dass nicht allen Behandlern bekannt ist, welche therapeutischen Möglichkeiten bestehen, sodass dann auch auf alte Stigmatisierungen zurückgegriffen wird – etwa: Bewegen Sie sich mehr und essen Sie weniger.
.jpg)
Sehen Sie das ungekürzte Interview mit Dr. Johanna Brix
Welche Pitfalls gibt es in der Behandlung solcher Patienten?
J. Brix: Ein Pitfall ist, dass man als Arzt und als Patient akzeptieren muss, dass Adipositas eine chronische Erkrankung ist. Das fällt vielen Patientinnen und Patienten sehr schwer. Außerdem ist es für Patienten schwer, professionelle Hife zu suchen. Das ganze Ausmaß des Problems wird nicht wahrgenommen. Es besteht auch oft die Illusion: „Wenn ich ein bisschen abnehme, dann ist alles wieder gut, und mir geht es gesundheitlich besser.“ Die Aktzeptanz ist wesentlich, aber auch ein schwieriger Faktor in der weiteren Behandlung.
Das zweite große Problem ist, dass die diätologische Beratung im niedergelassenen Bereich nicht erstattet wird. Das heißt de facto, dass es diese Behandlung nicht gibt. Wenn Betroffene sich zur Ernährung außerhalb von Krankenhäusern oder den großen Zentren der Gesundheitskassen informieren wollen, muss das privat bezahlt werden. Das ist eine große Hürde.
Das dritte Problem ist, dass wir viel zu wenig Männer behandeln. Betrachtet man die großen Diabetesstudien, so ist der Frauenanteil niedrig. Die beste Studie, was den Frauenanteil betrifft, ist REWIND; da sind es 45%. Üblicherweise liegt der Anteil bei 30%. Die Ergebnisse werden dann auf beide Geschlechter generalisiert. Betrachtet man Adipositaskohorten, so sind in den Studien immer 70–80% Frauen. Und im „real life“, wenn man die Zahlen in Österreich ansieht, wissen wir, dass ca. 15% aller Männer in Österreich adipös sind und ca. 10% aller Frauen. Also müssten wir eigentlich viel mehr Männer behandeln. Es stellt sich die Frage: Wieso sehen wir weniger Männer in unseren Praxen und Ambulanzen? Das hat etwas mit dem Bild, das es von der Erkrankung Adipositas gibt, zu tun und darin sehe ich ein großes Problem.
Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe?
J. Brix: Es gibt zwar keine Untersuchungen dazu, aber es dürfte so sein, dass Adipositas beim Mann eher toleriert wird. Frauen sind nach wie vor stärker dem Modediktat unterworfen. Männliche Role Models wie David Beckham und andere gibt es erst relativ kurz, Frauen kämpfen dagegen schon viel länger mit dem idealisierten Körperbild. Aber auch die Themen Body-Positivity und Body-Shaming sind im Hinblick auf Adipositas eine Herausforderung. Einerseits ist es wichtig, nicht zu stigmatisieren, andererseits ist aber klar: Adipositas ist ungesund und eine Erkrankung. Diese Gratwanderung muss auch das Gesundheitspersonal bewältigen.
Was bedeutet Stigmatisierung im Alltag für die Betroffenen?
J. Brix: Stigmatisierung und Diskriminierung sind im Alltag ein großes Thema. Das beginnt beim Hänseln im Kindergarten und setzt sich ganz banal gesprochen bis zum Urlaubsflug fort. Wenige von uns möchten im Flugzeug 10 Stunden neben jemandem sitzen, der schwer adipös ist. Aber das liegt nicht an dem Menschen, sondern daran, dass der Sitzplatz so schmal bemessen ist, damit man noch eine zusätzliche Person in die Sitzplatzreihe hineinquetschen kann. So ist unser Alltag, und dem sind diese Menschen permanent ausgesetzt.
Zur Adipositas wurde und wird viel geforscht. Was wurde bis jetzt erreicht?
J. Brix: Wir haben sehr viel erreicht, was das Verständnis der Erkrankung anbelangt. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir durch die Forschung vom Schuldproblem wegkommen sind. Wir wissen, dass bei den meisten Menschen viele Phänomene auftreten, die sie übergewichtig werden lassen. Ein Beispiel dafür ist das Thema Epigenetik: Dazu gibt es eine Studie über den Hungerwinter in Holland. Man hat Frauen untersucht, die 1945 schwanger waren, und herausgefunden, dass deren Kinder zu Typ-2-Diabetes und Adipositas neigen, weil sich die Evolution auf diese Art schützt.
Was die medikamentöse Therapie anbelangt, war das lange Zeit ein Tal der Tränen. Aber nun bekommen wir endlich Medikamente, die sehr gut wirken, sicher sind und die wir aus der Diabetologie schon viele Jahre kennen; womit wir also auch schon Erfahrung haben.
Ein weiterer Erfolg war sicher auch die Entwicklung der bariatrischen Chirurgie mit all ihren Höhen und Tiefen, was Spätfolgen und Komplikationen anbelangt.
Wie wird die Adipositastherapie der Zukunft aussehen?
J. Brix: Derzeit wird eine bariatrische Chirurgie ab einem BMI von 35kg/m2 bezahlt, wenn eine Begleiterkrankung vorliegt, und das ist meist der Fall, und außerdem ab einem BMI von 40kg/m2 ohne Begleiterkrankungen. Im unteren morbiden BMI-Bereich ist die Komplikationsrate bei der Operation wesentlich geringer als etwa bei einem BMI von 60kg/m2. In diesem unteren Bereich sind aber auch neue Medikamente gut wirksam. Ende des Jahres wird hoch dosiertes Semaglutid auf den Markt kommen. Große Hoffnungen setze ich auch in die dualen GLP-1/GIP-Therapien, wie Tirzepatid, wo wir sehr große Gewichtsabnahmen bei Menschen mit Diabetes sehen, die sich ja per se aufgrund ihrer Insulinresistenz sehr schwer mit der Gewichtsabnahme tun. Ich glaube, dass wir die bariatrische Chirurgie nach wie vor brauchen, aber dass sie ihren Platz bei höheren BMI-Werten der morbiden Adipositas finden wird und dass wir bei BMIs bis 40kg/m2 mit einer medikamentösen Therapie gut zurechtkommen werden.
Sie haben schon einige Stakeholder erwähnt. Welche sind die wichtigsten?
J. Brix: Als Stakeholder bei Adipositas braucht man alle, die mit dem Thema Gesundheit zu tun haben: Sozialversicherungen, Gesundheitskassen, Schulen, das Bildungswesen, vom Bildungsministerium bis zu den Bildungsdirektionen, aber auch Kindergärten. Auch der Bereich Arbeit ist wichtig, etwa die Arbeiterkammer und das Arbeitsministerium. Es gibt Daten aus Deutschland, die belegen, dass Menschen mit Adipositas wesentlich schwerer Lehrstellen bekommen. Aber auch sonst ist es so, dass bei gleicher Qualifikation schlanke Bewerber eher den Job bekommen als übergewichtige.
Außerdem braucht man auch im religiösen und im kulturellen Bereich Unterstützung. Wir wissen, dass gerade bei Migranten Adipositas ein großes Thema ist. Es eröffnet Chancen, wenn man solche Stakeholder mit ins Boot holen kann.
Wo sehen Sie Widerstände? Wo gibt es Schwierigkeiten?
J. Brix: Schwierig ist die Erstattung der medikamentösen Adipositastherapien. Diese sind auf einer Liste von Medikamenten, die keine Krankheiten behandeln, ähnlich wie Kontrazeptiva. Und das ist einfach absurd, wenn man bedenkt, dass Adipositas seit dem Jahr 2000 als Krankheit anerkannt ist und wir darüber hinaus sichere Medikamente haben. Natürlich muss man die Patienten in die Verantwortung nehmen. Wenn ein Patient nicht mitarbeitet, dann machen natürlich auch Medikamente wenig Sinn, aber man sollte den Menschen eine Chance geben, die sich die Behandlung sonst nicht leisten können. Eine Lösung wäre vielleicht eine Erfolgskontrolle, wie früher bei den GLP-1-Rezeptoragonisten bei Diabetes. Den Menschen Chancen zu geben ist mir sehr wichtig.
Widerstände gibt es natürlich in der Lebensmittelindustrie, die sehr mächtig ist. Haben Sie schon einmal versucht herauszufinden, ob das Joghurt, das Sie kaufen, wirklich gesund ist? Das ist nicht leicht. Hier braucht es pragmatische Lösungen, die einfach und verständlich eine Nahrungsmittelkennzeichnung ermöglichen.
Was erwarten Sie da vom Gesundheitsminister? Es ist eine hochpolitische Entscheidung, so etwas durchzubringen.
J. Brix: Der Gesundheitsminister steht momentan vor riesigen Problemen. Die Coronapandemie wird ihn weiter beschäfigten, außerdem darf man nicht auf den Pflegenotstand vergessen. Natürlich hoffe ich aber, dass ihm auch die Adipositas ein Anliegen ist. Wenn wir die Erstattung der Behandlung durchsetzen könnten, wäre ein großer Schritt getan und dabei wünsche ich mir seine Unterstützung.
Unsere Gesprächspartnerin:
OÄ Dr. Johanna Brix
Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft, Fachärztin für Innere Medizin, 1. Med. Abteilung, Klinik Landstraße, Wien
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...
Notfall Diabetische Ketoazidose: Leitliniengerechtes Handeln kann Leben retten
Akute Stoffwechselentgleisungen können lebensbedrohlich sein und erfordern eine rasche und leitliniengerechte Diagnostik und Therapie. Pathogenese, Klinik, typische Befunde und die ...
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...


