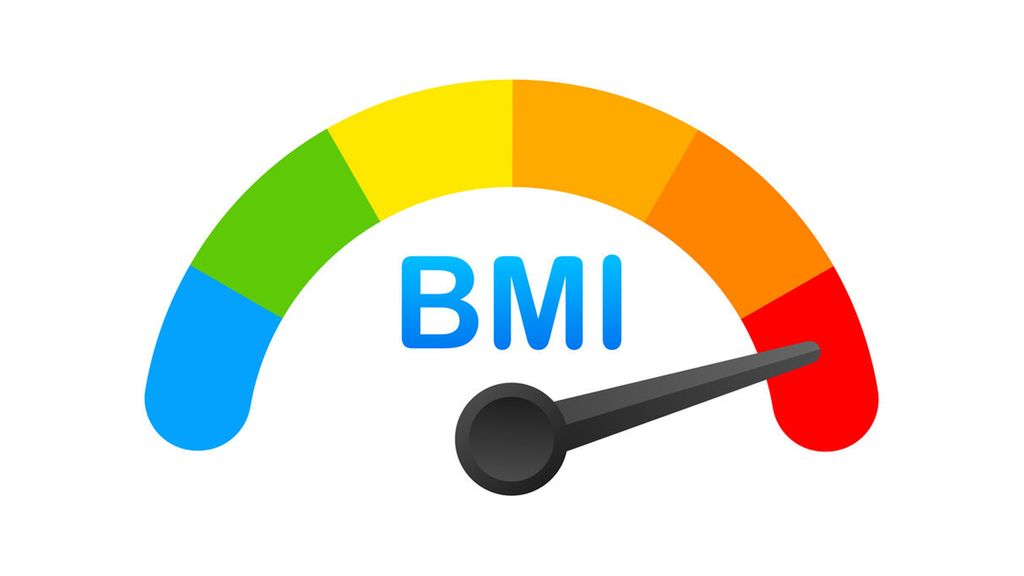
Rückblicke: Wichtigste Entwicklungen zum Thema Adipositas in 25 Jahren
Autor: Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak
Medizinische Universität Graz
Universitätsklinik für Innere Medizin
Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie
E-Mail: hermann.toplak@medunigraz.at
Die Ausgangssituation für Menschen mit Adipositas ist heute eine gänzlich andere – nicht nur die Anzahl an Betroffenen ist gestiegen, auch die Krankheitsauffassung, die Vertretung in Fachgesellschaften und die therapeutischen Möglichkeiten in Österreich haben sich verändert.
Keypoints
-
1997 wurde mit der ÖAG eine Fachgesellschaft für Adipositas in Österreich gegründet.
-
Adipositas gilt zukünftig alseigenständige Diagnose in der ICD 11.
-
Pharmakologische Möglichkeiten werden gebraucht und haben sich sehr ausgeweitet.
Im Jahr 1988 waren in Österreich 6,5% der erwachsenen Bevölkerung von Adipositas betroffen, 3,5% hatten einen Diabetes mellitus – in diesem Jahr begann meine Karriere im Umfeld und Bereich des metabolischen Syndroms. Schon bald kam man zu der Erkenntnis, dass die Adipositas wohl der Haupttreiber der Pandemie des metabolischen Syndroms werden würde. Heute haben sich die Zahlen von damals etwa verdreifacht (Adipositasrate ca. 20%, Diabetesrate ca. 10%).
Während das Problem in Europa und international bereits in den 1980er-Jahren erkannt wurde und entsprechende Fachgesellschaften gegründet wurden, die sich seinerannahmen, war es in Österreich erst 1997 so weit, dass die Östereichische Adipositasgesellschaft (ÖAG) gegründet wurde – einige prominente Lehrstuhlinhaber gaben damals nicht ihre Zustimmung dazu.
Adipositas: eigenständige Diagnose
Gemeinsam ist fast allen Ländern, dass die Adipositas als vielleicht das wichtigste singuläre Problem große Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat. Die Anerkennung als eigenständige Erkrankung ist zwar früh erfolgt, aber nie wirklich ernst genommen worden. Während andere Erkrankungen, wie Diabetes und der arterielle Hypertonus, selbstverständlich auf Kassenkosten behandelt werden können, sind wir bei der Adipositas davon noch deutlich entfernt.
Aber es ist vieles passiert: Es wurden 2008 die ersten Europäischen Leitlinien zur Adipositastherapie publiziert. Das Update 2015 blieb bisher das letzte. Die Leitlinien waren auch assoziiert mit der „Milan Declaration“, einem Handlungsaufruf im Bereich Adipositas. Dafür kamen 2019 zusätzlich die „European Practical and Patient-Centred Guidelines for Adult Obesity Management in Primary Care“, die erstmals die Patienten ins Zentrum stellten. Diese Entwicklungen wurden vom Thema der Stigmatisierung begleitet, worin echte Fortschritte zu erkennen sind. Adipositas ist nicht schuldbehaftet, sondern beruht auf einem nicht kontrollierbaren Verhalten. Bereits 2014 stellteein zentrales Paper fest, dass es neben der Verhaltestherapie eine suffiziente medikamentöse Adipositastherapie brauchen wird. 2017 wurde auf die Gemeinsamkeit der zukünftigen Therapien von Adipositas und Typ-2-Diabetes hingewiesen. 2018 wurde die Notwendigkeit erkannt, auch sarkopene Adipositasformen (oft bei Normalgewicht) zu beachten. Die ersten postbariatrischen Leitlinien kamen 2017 dazu. Im selben Jahr wurde auch darauf hingewiesen, dass Adipositas einen eigenen Unterpunkt in der ICD 11 (International Classification of Diseases, 11th Revision) bekommen und nicht einfach weiterhin unter den nahrungsabhängigen Krankheiten kategorisiert sein soll. Nach aktuellen Informationen wird dies auch weiterverfolgt.
Neuerungen und medikamentöse Therapien
Ebenso ist ein Update der Europäischen Leitlinien in Arbeit,es wird Anfang 2023 erwartet. Die dazugehörigen Publikationen wurden, wie auch viele andere, in Obesity Facts publiziert und sind auch via Homepage der European Association for the Study of Obesity (EASO) abrufbar.
Zu erwähnen sind auch die Centers for Obesity Management (COMs), deren Kriterien 2011 publiziert wurden und von denen so viele wie möglich – auch in Österreich – entstehen sollten. Es gibt dafür leider keinerlei Anreize seitens des Hauptverbandes, aber: Adipositas ist nicht selten und braucht viele Therapeuten. Das Herausragendste ist zurzeit aber die Dynamik in der Entwicklung von Medikationen, zumeist für Adipositas und Typ-2-Diabetes. Dazu gehören Pharmaka wie Naltrexon/Bupropion, Liraglutid, Semaglutid, Tirzepatid und z.B. die Kombination von Semaglutid und Cagrilintid (siehe publizierte Phase-I-Studie), um nur einige zu nennen. Die Wirkung dieser Medikamente wird gebraucht und die Zahl der Verschreibung steigt ständig. Der wichtigste zu schaffende Schritt wird die Erstattung, wenigstens für Subgruppen von Patienten mit Komorbiditäten, sein.
Zurück zur ÖAG: Sie wird heuer 25 Jahre alt und hat über die Jahre bewiesen, dass sie ein wichtiger Motor für die Zukunft im Bereich Adipositas ist.
Literatur:
beim Verfasser
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...
Notfall Diabetische Ketoazidose: Leitliniengerechtes Handeln kann Leben retten
Akute Stoffwechselentgleisungen können lebensbedrohlich sein und erfordern eine rasche und leitliniengerechte Diagnostik und Therapie. Pathogenese, Klinik, typische Befunde und die ...
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...


