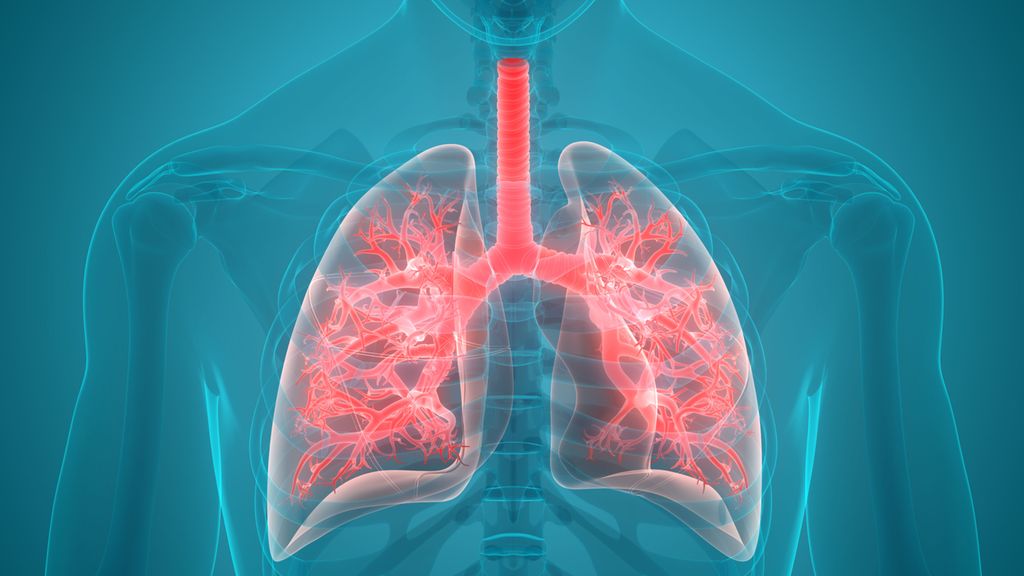
©
Getty Images/iStockphoto
Die obere Einflussstauung – wie kann man intervenieren?
Jatros
Autor:
OA Dr. Gerard Mertikian
Interventionelle Radiologie<br> KH Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel, Wien<br> E-Mail: gerard.mertikian@wienkav.at
30
Min. Lesezeit
14.03.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die obere Einflussstauung wurde erstmals im Jahre 1757 durch den schottischen Arzt William Hunter anhand des Leichnams eines 39-jährigen Mannes beschrieben, der an einem rupturierten syphilitischen Aortenaneurysma verstorben war.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die obere Einflussstauung ist meist das letzte Kapitel einer malignen Erkrankung.</li> <li>Sie wird hervorgerufen durch den Verschluss der V. cava sup., der V. anonyma und/ oder der V. subclavia.</li> <li>Die Akuität der Okklusion bestimmt die Symptomatik.</li> <li>Eine minimal invasive Therapie mit Stentimplantation und/oder Thrombektomie ist Standard.</li> </ul> </div> <p>Die obere Einflussstauung, auch bekannt unter dem englischen Akronym SVCS („Superior Vena Cava Syndrome“), verursacht je nach der Akuität der Venenokklusion unterschiedliche Symptome. Hämodynamische Auswirkungen führen zu einer Schwellung im Bereich des Gesichts sowie der oberen Extremitäten, die je nach Lokalisation des Venenverschlusses auch asymmetrisch auftreten können. Typisch ist eine verstärkte Venenzeichnung, die sich besonders im Bereich der Thoraxwand bemerkbar macht.<br /> Zu den respiratorischen Leitsymptomen zählen Dyspnoe/Orthopnoe, Zyanose und Stridor, die zusammen mit einer begleitenden Dysphagie und ggf. neurologischer Problematik wie Schwindel, Kopfschmerzen und Verwirrtheit hauptverantwortlich sind für den vor allem subjektiv sehr belastenden Beschwerdekomplex. Es gibt fließende Übergänge der Symptome, die einerseits durch die Einflussstauung selbst, andererseits durch die primär zugrunde liegende und meist maligne Raumforderung verursacht sind. Klinisch wird die obere Einflussstauung in 5 Stadien eingeteilt. Das Spektrum reicht von einer asymptomatischen Einengung des zentralen Einstroms bis hin zum letalen Ausgang (Tab. 1). Lebensbedrohliche Symptome sind vor allem das Hirn- und das Larynxödem.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1901_Weblinks_jatros_pneumo_1901_s24_tab1.jpg" alt="" width="550" height="260" /></p> <h2>Ätiologie und Pathophysiologie</h2> <p><strong>Ätiologie</strong><br /> Ausgangspunkt für die obere Einflussstauung ist meist ein maligner Prozess, besonders das Bronchuskarzinom sowie die metastatische Lymphadenopahtie, obgleich in den letzten Jahrzehnten durch den immer häufiger werdenden Einsatz von zentralvenösen Kathetern und Schrittmachersonden auch benigne Ursachen als Auslöser infrage kommen.</p> <p><strong>Pathophysiologie</strong><br /> Die Vena cava superior ist ein Niederdrucksystem und verantwortlich für etwa 30 % des venösen Rückstroms zum Herzen. Die Tatsache, dass die obere Hohlvene aus leicht kompressiblem Gewebe besteht und von relativ rigiden Strukturen wie Sternum, Trachea, Aorta, Pulmonalarterie und mediastinalen und paratrachealen Lymphknoten umgeben ist, wird es verständlich, wie raumfordernde Prozesse der unmittelbaren Umgebung zu einem SVCS führen können. Wird die obere Hohlvene entweder durch Kompression oder durch direkte Infiltration okkludiert, kann dies zu einem Druckanstieg über 40 mm Hg führen. Die Entwicklung der Symptomatik wird hauptsächlich von der Schnelligkeit und dem Ausmaß der Obliteration bestimmt. So kann ein sich langsam entwickelnder Venenverschluss durch Ausbildung von Kollateralkreisläufen ausreichend kompensiert werden und somit zu kaum wahrnehmbaren Symptomen führen. Es gibt eine Vielfalt an Umgehungszirkulationen, die hierbei aktiviert werden können (Abb. 1). Der Hauptabfluss erfolgt über das Azygos/ Hemiazygos-System; weitere Kollateralkreisläufe sind die Interkostalvenen, die Vv. epigastricae sup. und inf., das paravertebrale Venennetzwerk und die Beckenvenen. Gravierende Symptome ergeben sich bei einem Verschluss der oberen Hohlvene, der die Einmündung der V. azygos miteinbezieht, da hier das venöse Blut erst über einen retrograden Fluss und über eine längere Strecke über die V. hemiazygos, und in weiterer Folge die Beckenvenen und die untere Hohlvene, das Herz erreicht.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1901_Weblinks_jatros_pneumo_1901_s24_abb1.jpg" alt="" width="250" height="244" /></p> <h2>Therapie und Komplikationen</h2> <p>Der primäre Therapieansatz hat selbstverständlich die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung mittels Bestrahlung, Chemotherapie, ggf. operativer Sanierung zum Ziel. Bestand früher die Tendenz, das symptomatische SVCS zwecks Tumorverkleinerung zunächst einer Bestrahlungstherapie zuzuführen, neigt man in den letzten zwei Dekaden dazu, die Methoden der interventionellen Radiologie früher einzusetzen. Die symptomatische obere Einflussstauung kann minimal invasiv, relativ rasch, komplikationsfrei und mit einer hohen Erfolgsrate signifikant gelindert werden.<br /> Die Stentimplantation in der oberen Einflussstauung fand erstmalig 1986 Eingang in die Literatur (Charnsangavej et al.; Radiology), als Gianturco-Stents zunächst bei einer Versuchsreihe mit Hunden mit iatrogen erzeugter Retroperitonealfibrose und in weiterer Folge erfolgreich in zwei Patienten implantiert wurden.<br /> Die Palette der radiologisch-interventionellen Möglichkeiten hat sich in der Zwischenzeit erweitert. Waren es in den Anfängen arterielle Stents, die auch venös ihren Einsatz fanden, stehen uns heutzutage entsprechend dem abweichenden Anforderungsprofil sogenannte „dedicated venous stents“ zur Verfügung. Die Morphologie der Venenwand und die zu überwindende Pathologie verlangt spezielle Stents mit einer hohen Radialkraft und höherer Flexibilität, mit größerem Durchmesser und größeren Stentlängen. Ummantelte, selbstexpansible und ballonexpansible Stents können dort eingesetzt werden, wo eine Tumorinfiltration die Venenwand bereits arrodiert hat. Liegt angiografisch das Bild von frischen Thromben vor oder kommt es nach einer Stentimplantation zu einem thrombotischen Reverschluss, kann eine mechanische Thrombektomie (z. B. AngioJet<sup>®</sup> [Boston Scientific], Rotarex<sup>®</sup> [Straub Medical]) Abhilfe schaffen.<br /> Entscheidend ist, vor dem Eingriff die Bildgebung mittels Computertomografie vorzunehmen, damit das Ausmaß der Pathologie erfasst und die Behandlungsstrategie festgelegt werden kann. Unter normalen Umständen erfolgt der Zugang von transfemoral. Ist das Ziel, über die V. cava sup. hinaus eine oder beide Vv. anonymae zu rekanalisieren, kann beidseits transfemoral zugegangen werden. Gelingt es nicht, den Verschluss retrograd zu passieren, kann über die zwangsläufig gestaute und leicht punktierbare V. cephalica antegrad zugegangen und rekanalisiert werden.<br /> Die Komplikationsrate (minor et major) wird in der Literatur mit bis zu 20 % angegeben, bei einer Mortalitätsrate von 2 %. Das Gros der Komplikationen stellen postpunktionelle Probleme wie Leistenhämatome, AV-Fistel oder TVT dar. Besorgniserregender ist die akute Stentmigration (z. B. rechter Vorhof, Pulmonalarterie), die auf ein Missverhältnis zwischen Venendurchmesser und dem gewählten Stent zurückzuführen ist, weshalb nochmals auf die Wertigkeit der präinterventionellen Bildgebung mittels Computertomografie hingewiesen werden muss. Weitere nennenswerte Komplikationen sind neben dem akuten/subakuten Stentverschluss das Lungenödem durch das plötzlich entstandene Überangebot an venösem Rückfluss oder die Loslösung von Thromben, die zu einer Pulmonalembolie führen können. Manipulationen durch den Führungsdraht können einerseits Arrhythmien, andererseits, extrem selten, eine Herzbeuteltamponade mit letalem Ausgang auslösen.<br /> Richtlinien für eine einheitliche Antithromboseprophylaxe nach einer Stentimplantation existieren nicht. Basierend auf Metaanalysen (Scalese et al.; Hospital Pharmacy 2017) liegen lediglich Empfehlungen für eine Plättchenaggregationshemmung mit Acetylsalicylsäure in einer Dosierung von 75 bis 325 mg täglich vor, obgleich eine individuelle Anpassung der Therapie besonders im Hinblick auf das generell erhöhte Blutungsrisiko unerlässlich ist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Pneumo_1901_Weblinks_jatros_pneumo_1901_s26_abb2-5.jpg" alt="" width="800" height="582" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...
Post-Covid-Syndrom: Ergebnisse der bevölkerungsbasierten COVIDOM-Studie
Lungenfunktionelle Residuen und Atemwegsinflammation gehören zu den häufigsten Langzeitfolgen nach einer milden akuten Covid-19-Erkrankung. Die deutsche COVIDOM-Studie evaluierte ...


