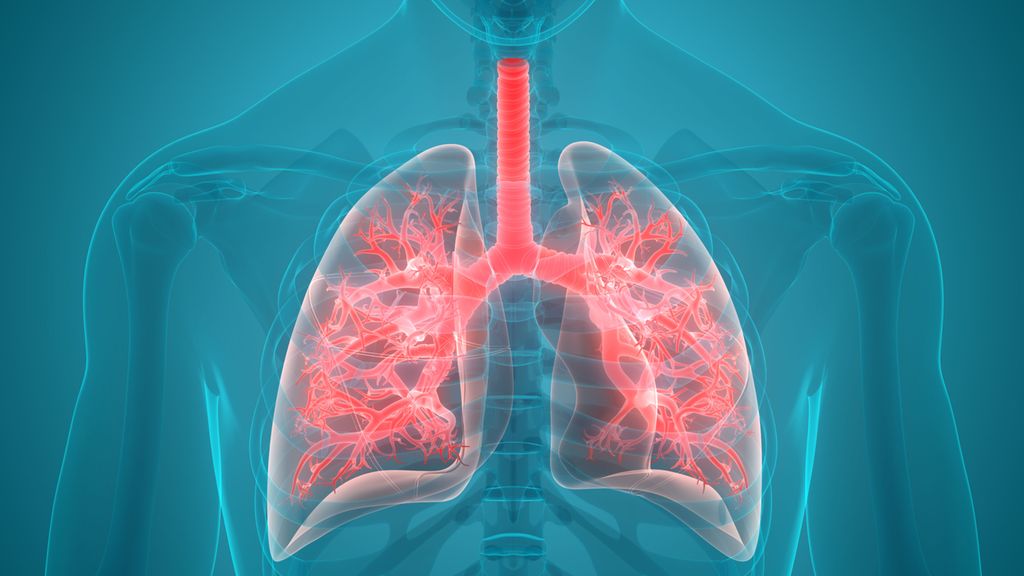
©
Getty Images/iStockphoto
Pollen als Umweltnoxen – Wirkung und Interaktion mit anderen Umweltfaktoren
Jatros
Autor:
Prim. Priv.-Doz. Dr. Fritz Horak
Allergiezentrum Wien West<br> E-Mail: f.horak@allergiezentrum.at
30
Min. Lesezeit
15.03.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Weltweit leiden 300–500 Millionen Menschen an allergischem Schnupfen, von ihnen etwa 200 Millionen an allergischem Asthma.<sup>1</sup> Der Anteil der Pollenallergiker ist groß: In Österreich sind beispielsweise bereits etwa 30 % gegen Gräserpollen sensibilisiert, etwa die Hälfte davon leidet an einer manifesten Allergie.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Pollen – die unterschätzten Umweltnoxen</h2> <p>Pollen kommen in Bäumen, Gräsern und Kräutern vor. Aus allergologischer Sicht sind vor allem die sogenannten Windbestäuber relevant, da ihre Pollen über die Luft verbreitet werden und oft über viele Hunderte bis Tausende Kilometer verfrachtet werden können.<br /> Pollen haben eine Größe von etwa 8–250µm (Birke: 25µm, Ambrosia: 20µm). Sie sind in ihrer Form meist rund oder länglich und zeigen an ihrer Oberfläche verschiedene, teils bizarre Strukturen (Warzen, Stacheln, Keulen etc.), wodurch sie mikroskopisch unterschieden werden können.<sup>2</sup> Je nach Pollenart bedarf es einer bestimmten Anzahl von Pollen in der Luft, um Beschwerden bei Allergikern auszulösen (Birken bei 30 Pollen/m<sup>3</sup>, Gräser bei 15 Pollen/m³, Ragweed bereits bei 10 Pollen/ m³).<sup>3</sup> Auch gibt es starke regionale Unterschiede bei diesem Schwellenwert.<sup>4</sup> In der Schweiz genügen bereits 10 Pollen/ m<sup>3</sup>, um Beschwerden auszulösen, in Ungarn braucht es da schon 50 Pollen/m<sup>3</sup>. Die Ursache dafür dürfte eher nicht in der besseren Toleranz der Ungarn liegen, sondern eher an verschiedenen Umweltfaktoren, die hier beteiligt sind.<br /> Pollen sind Wunder der Natur und sehr effizient. Beispielsweise kann eine einzige Ragweed-Pflanze mehrere Millionen Pollenkörner produzieren, die dann über große Entfernungen transportiert werden können.<sup>5</sup></p> <h2>Pollen tragen Allergene – aber nicht nur</h2> <p>Der Effekt von Pollen, verschiedene Allergien auszulösen, ist bekannt. Alle kennen die Beschwerden der allergischen Rhinokonjunktivitis und von Asthma bronchiale. Von vielen Pollenarten sind ihre Hauptallergene bereits bekannt (Birken- Bet v1; Gräser-Phl p1,5; Ragweed- Amb a1; Beifuß-Art v1 etc.). Aber Pollen können nicht nur auf dem immunologischen Weg der Allergieauslösung Beschwerden verursachen, es gibt auch andere assoziierte Substanzen, die dem Körper Schaden zufügen können (Abb. 1).<br /> PALMs<sup>6</sup> beispielsweise (nicht allergene, bioaktive, Pollen-assoziierte Lipidmediatoren) können über eine verstärkte Chemotaxis von eosinophilen und neutrophilen Granulozyten proinflammatorisch wirken. Gleichzeitig können diese PALMs direkt auf die dendritischen Zellen immunmodulierend wirken (Verstärkung der TH<sub>2</sub>-Differenzierung und Inhibition von IL-12).<br /> Eine weitere Gruppe von Pollen-assoziierten Substanzen sind die NADPH-Oxidasen<sup>6</sup> (reduzierte Nikotinamidadenindinukleotidphosphatoxidasen), welche direkt Atemwegsepithelzellen schädigen können und damit die Wirkung von Allergenen in den Atemwegen verstärken.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1801_Weblinks_s9_abb1.jpg" alt="" width="2150" height="1096" /></p> <h2>Pollen interagieren mit Luftschadstoffen</h2> <p>Die schädigende Wirkung von Luftschadstoffen ist bekannt und in vielen Studien untersucht. Weniger bekannt ist aber, dass es zu einer Interaktion zwischen Luftschadstoffen und Pollen kommen kann.<br /> Staubpartikel, beispielsweise PM10, können an ihrer Oberfläche Pollen und Pollenfragmente tragen und in die tieferen Atemwege transportieren.<sup>7</sup> Auch können Schadstoffe wie NO<sub>2</sub> und CO<sub>2</sub> Vitalität, Form, Größe und Metabolismus des Pollenkorns beeinflussen.<sup>8</sup> Es kann durch Ozon, Schwermetalle, Diesel, SO<sub>2</sub> und CO<sub>2</sub> in der Pflanze zu einer Upregulation bestimmter aktiver Substanzen kommen, die entweder direkt allergen wirken (Chitinasen, Expansin, Oleosin, LTP etc.) oder, wie oben beschrieben, indirekt zellschädigend wirken können (NADPH-Oxidase).<sup>9</sup> Im menschlichen Körper kann die IgE-Bindungsfähigkeit des Allergens erhöht werden und damit zu einer Verstärkung der Allergieantwort führen.<sup>10</sup> Eine aktuelle Studie zeigt auch, dass es unter dem Einfluss von Luftschadstoffen wie NO2 zu einer direkten Wirkung auf das Pflanzengenom kommen kann, was zu einer vermehrten Transkription bestimmter Proteine führt.<sup>11</sup> Vor allem Proteine, die für die Reparatur nach Verwundung der Pflanze (Stress) oder das Pollenschlauchwachstum zuständig sind, zeigten hier eine verstärkte Transkriptionsrate. Aufgrund der Beobachtung, dass viele Allergenproteine (z.B. PR10-Proteine wie Bet v1) und nicht allergene Adjuvanzien in Abwehrprozessen der Pflanzen gegen Mikroben gerichtet sind, untersuchte eine Autorengruppe, ob es ein eigenes Pollenmikrobiom gibt und ob sich hier eine Korrelation mit der Pollenallergenität und mit Luftschadstoffen findet.<sup>12</sup> Gesammelt wurden Birken- und Gräserpollen in der Saison 2014. Weiters wurde die Bakterien- DNA-Diversität auf den Pollen untersucht und es wurden Luftschadstoffe gemessen. Gezeigt haben sich ein unterschiedliches Mikrobiommuster bei Gräser- und Birkenpollen sowie ein Unterschied des Mikrobioms am Land und in der Stadt. Andererseits war die Bakteriendiversität auf den Pollen negativ korreliert mit der Konzentration an NO<sub>2</sub> in der Außenluft. Das heißt, bei steigender NO<sub>2</sub>-Konzentration zeigte sich ein Abfall der Bakteriendiversität auf den Pollen. Die Relevanz für Pflanzen (Stressfaktor oder Symbiose) und Menschen (kein Effekt oder zusätzliche Noxe) ist bisher nicht klar. Aus anderen Bereichen wissen wir aber, dass eine höhere Mikrobiomdiversität eher von Vorteil ist (z.B. Darmbesiedelung, Asthmaprävention etc.).</p> <h2>Einfluss des Klimas auf Pollen</h2> <p>Nicht nur Luftschadstoffe, sondern auch klimatische Bedingungen haben einen wichtigen Effekt auf die Pollen. Die Temperatur ist zum Beispiel ein wesentlicher Faktor, der einerseits Einfluss auf die Blühbereitschaft verschiedener allergener Pflanzen zeigt und andererseits neben der Luftfeuchtigkeit auch den Zeitpunkt der Freisetzung von Pollen mitbestimmen kann.<sup>13</sup> Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, kommt es zu einer Abnahme des Pollenfluges. Auch die Dauer der Pollensaison wird von klimatischen Faktoren wesentlich mitbestimmt und trägt zur Gesamtbelastung der Allergiker bei. So zeigte sich, dass aufgrund der ansteigenden Temperaturen die Dauer der Pollensaison in Europa in den letzten 30 Jahren um etwa 10 Tage zugenommen hat. Dabei bestehen große Unterschiede zwischen den einzelnen Pollenarten. Unter den ambitioniertesten Szenarien zur Reduktion von Treibhausgasen haben wir mit einer Zunahme der mittleren Temperatur bis 2099 um 1,8°C (90 % CI: 1,1–2,9) zu rechnen. Bei „business as usual“ ist ein Anstieg um 4°C (2,4–6,5) zu befürchten.<sup>15</sup><br /> Neben der Temperatur spielen auch Windstärke und Windrichtung eine Rolle.<sup>13</sup> Die „ideale“ Windstärke für Pollen ist 2–4m/s. Dabei finden sich die höchsten Pollenkonzentrationen in der Luft. Eine Zunahme der Windstärke führt aufgrund des Verdünnungseffektes zu einer Abnahme der Pollen in der Luft. Die vorherrschende Windrichtung kann vor allem lokale Auswirkungen, also auf die Belastung eines bestimmten Gebiets, haben.<sup>16</sup></p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Pollen sind biologische Körper, die eine Fülle von allergenen und nicht allergenen Stoffen (meist Proteine) tragen können. Während die allergenen Bestandteile direkt einen Einfluss auf die Auslösung allergischer Symptome bei Pollinosepatienten haben, können andere, nicht allergene Bestandteile (z.B. PALMs, NADPH-Oxidasen etc.) indirekt proinflammtorisch, immunmodulierend oder direkt Epithel-schädigend wirken. Dazu kommen eine Interaktion mit Luftschadstoffen und der Einfluss des Klimas (Abb. 2). Luftschadstoffe haben einen bewiesenen negativen Effekt auf verschiedene Gesundheitsparameter des Menschen. Sie können aber auch die Pollenform und -vitalität beeinflussen, auf die Transkription bestimmter Proteine wirken und die IgE-Bindungsfähigkeit von Allergenen erhöhen. Auch die Diversität eines Pollen-spezifischen Mikrobioms kann einen bisher noch nicht geklärten Effekt auf Pflanze und Mensch haben. Als wichtigster klimatischer Faktor ist v.a. die weltweite Zunahme der Temperatur im Rahmen der globalen Erderwärmung ein nicht zu unterschätzender Faktor, der in Zukunft Vegetationszonen verschieben und eine Verlängerung der Pollensaison bedeuten kann.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1801_Weblinks_s9_abb2.jpg" alt="" width="2150" height="1374" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> GINA Report 2011, GA2LEN <strong>2</strong> Bastl K et al.: Pollen und Allergie. Wien: MANZ-Verlag, 2015 <strong>3</strong> Buters J et al.: Allergo J Int 2015; 24: 108-20 <strong>4</strong> D’Amato G et al.: Allergy 2007; 62: 976-90 <strong>5</strong> Mandroli P et al.: Methods in Aerobiology. Bologna: Pitagora Editrice, 1998 <strong>6</strong> Traidl-Hoffmann C et al.: J Allergy Clin Immunol 2009; 123(3): 558-66 <strong>7</strong> Pazmandi K et al.: PLoS One 2012; 7(12): e52085 <strong>8</strong> Malayeri BE et al.: Biol Trace Elem Res 2012; 147(1-3): 315-9 <strong>9</strong> Schiavoni G: Ann Allergy Asthma Immunol 2017; 118(3): 269-75 <strong>10</strong> Hong Q Env Poll 2018 <strong>11</strong> Zhao F Enf Poll 2017 <strong>12</strong> Obersteiner A et al.: PLoS One 2016; 11(2): e0149545 <strong>13</strong> Sofiev M, Bergmann K: Allergenic Pollen. Wien: Springer Verlag, 2013 <strong>14</strong> Emberlin J et al.: Int J Biometeorol 2002; 46(4): 159-70 <strong>15</strong> Intergovernmental Panel on Climate Change 2007; online: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_ report.htm; letzter Zugriff 2.3.2018, 11:51 <strong>16</strong> Grundström M et al.: Aerobiologia 2017; 33 (4): 457-71</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Chronische Atemwegserkrankungen in einem sich verändernden Klima
Die global steigenden Temperaturen und zunehmenden Hitzewellen haben einen negativen Einfluss auf die Luftqualität, vor allem in Städten. Die Atemwege und die Lunge als Eintrittspforten ...
Pathobiologie und Genetik der pulmonalen Hypertonie
Für die 7. Weltkonferenz für pulmonale Hypertonie (World Symposium on Pulmonary Hypertension; WSPH) 2024 beschäftigten sich zwei Task-Forces aus 17 internationalen Experten allein mit ...


