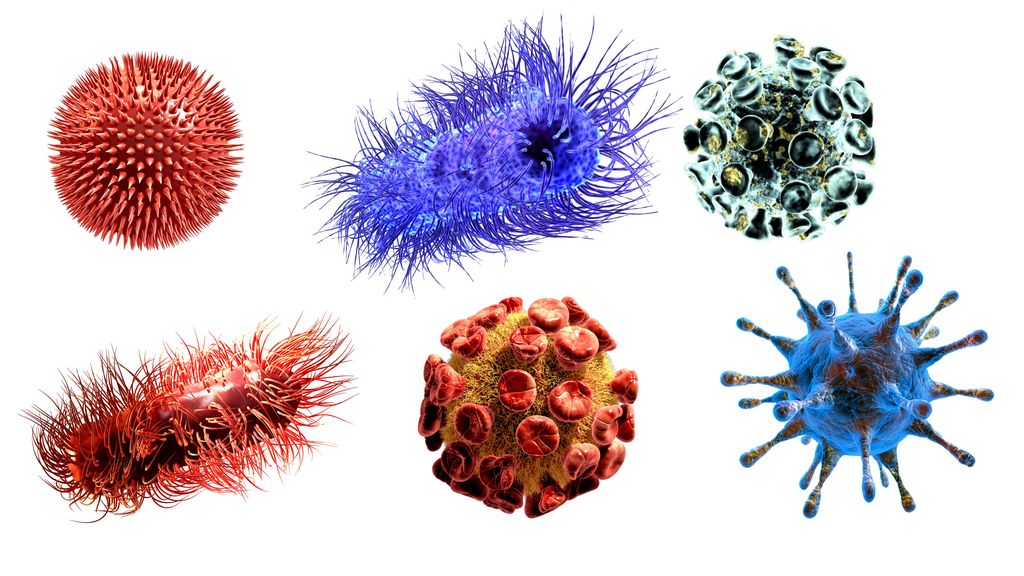
©
Getty Images/iStockphoto
Renaissance einer fast vergessenen Wissenschaft
Jatros
30
Min. Lesezeit
12.09.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Wundantiseptik lag fast ein Jahrhundert lang im Dornröschenschlaf, doch die Zeiten haben sich geändert. Mittlerweile ist das Gebiet wieder sehr wichtig geworden, nachdem die Resistenzproblematik gerade im gramnegativen Bereich weltweit zugenommen hat. Inzwischen gibt es auch fundierte wissenschaftliche Daten und Empfehlungen dazu, wie auch auf dem 1. Wiener Wundkongress zu hören war.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Nahezu 100 Jahre lang hatte die Wundantiseptik so gut wie jede Bedeutung verloren. Das lag an der Toxizität des von Lister eingeführten Karbol-Wundsprays, den toxischen Nebenwirkungen der darauf folgenden Generation von Antiseptika und nicht zuletzt auch an der herrschenden Euphorie nach Einführung der ersten Antibiotika. Man glaubte, Wundantiseptika einfach nicht mehr zu brauchen.</p> <h2>Die Renaissance der Antiseptik</h2> <p>Inzwischen hat sich die Situation jedoch vollkommen verändert, und die Wundantiseptik erlebt eine Renaissance. Das liegt zunächst daran, dass die pandemische Verbreitung von multiresistenten Erregern zu problematischen Situationen führt – somit wird Wundantiseptik auch zu einer Maßnahme der Antimicrobial Stewardship. Zudem dürfen Antibiotika – um das Risiko einer Resistenzbildung zu verringern – von Ausnahmen abgesehen nicht lokal eingesetzt werden. Auch relativ hohe Sensibilisierungsraten sprechen dagegen. Außerdem wirken sie nicht immer bakterizid, was viele (wenn auch nicht alle) Antiseptika sehr wohl tun. Ein weiteres Plus ist die Wirkung von Antiseptika gegen Biofilme. Und schließlich wirken die meisten (wenn auch nicht alle) Antiseptika lediglich lokal und werden nicht resorbiert.<br /> Es gibt allerdings zwei Ausnahmen von der Regel, Antibiotika nicht lokal anzuwenden: erstens dann, wenn gleichzeitig dasselbe Antibiotikum oral oder parenteral gegeben wird, weil sich die Infektion metastatisch ausbreitet; zweitens dann, wenn Knochenzemente oder Implantate mit Antibiotika versetzt werden (jedoch auch auf diesem Gebiet gibt es Bemühungen, Antibiotika durch Antiseptika zu ersetzen).<br /> Liegt eine systemische Beteiligung vor, die z. B. durch eine positive Blutkultur nachgewiesen wurde, so müssen systemisch Antibiotika verabreicht und gegebenenfalls mit topischen Antiseptika kombiniert werden.<br /> Dass Antiseptika eine höhere Wirksamkeit als Antibiotika aufweisen können, wird in Tabelle 1 am Beispiel von Cefuroxim im Vergleich mit drei Antiseptika dargestellt. Dort werden die minimalen Hemmkonzentrationen (MHK) von Cefuroxim und Antiseptika mit einigen wichtigen Erregern verglichen, wobei das Antibiotikum stets am schlechtesten abschneidet.</p> <h2>Evidenz und Indikationen</h2> <p>Gesichert ist, dass infizierte oder kritisch kolonisierte Wunden saniert werden müssen, um die Voraussetzung für eine Heilung zu schaffen. Was die Auswahl des Antiseptikums betrifft, so ist man weitgehend auf indirekte Vergleiche angewiesen, da es bisher nur wenige randomisiert-kontrollierte Studien gibt, in denen direkte Vergleiche verschiedener Antiseptika angestellt wurden.<br /> Als Indikationen für Wundantiseptik kommen die Prävention oder die Therapie von Wundinfektionen bei gleichzeitiger Unterstützung des Heilungsprozesses zur Erzielung einer optimalen Wundheilung infrage. Wichtige präventive Indikationen sind traumatische Wunden nach Débridement, wie kontaminierte Weichteil- und Extremitätenverletzungen, Verbrennungen von mehr als 15 % der Körperoberfläche sowie andere Wunden mit einem „Wound at risk“(WAR)-Score von mindestens 3. Obwohl jede Wunde kontaminiert sein kann, entwickelt nicht jede Wunde eine Infektion. Der WAR-Score ermöglicht eine Risikoabschätzung und ist in Tabelle 2 dargestellt.<br /> Als weitere präventive Indikationen sind die intra- und postoperative Antiseptik zur Prävention von SSI sowie die MRSA-Dekolonisation von chronischen Wunden anzuführen.<br /> Eine Entscheidungshilfe für den therapeutischen Einsatz von Antiseptika in der Wundbehandlung ist der Score gemäß dem „Therapeutischen Index für lokale Infektionen“ (TILI; Kramer und Dissemond 2019). Die Indikation ist gegeben, wenn entweder eine septische chirurgische Wunde besteht, freier Eiter vorliegt, <em>P. aeruginosa</em> nachgewiesen wurde und mindestens zwei der klassischen lokalen Entzündungszeichen (Rubor, Calor, Tumor, Dolor, Functio laesa) bestehen oder wenn gleichzeitig die folgenden sechs klinischen Parameter vorhanden sind: periläsionales Erythem, Überwärmung, Ödem/Verhärtung/Schwellung und/oder Nekrose, spontaner oder Druckschmerz, Stagnation der Wundheilung, Anstieg und/oder Änderung der Farbe oder des Geruchs des Exsudats.</p> <h2>Was soll ein Antiseptikum können?</h2> <p>Für die <em>Wirksamkeit</em> eines Antiseptikums sind verschiedene Testsysteme definiert, die stufenweise absolviert werden müssen. Es soll zu keinen Resistenzentwicklungen kommen und das Antiseptikum soll gegen Biofilme wirksam sein. Diese Anforderungen erfüllen Polyhexanid (PHMB), Octenidin (OCT), Natriumhypochlorit bzw. hypochlorige Säure (NaOCl/HOCl) sowie Povidon-Jod (PVP-I).<br /> Wünschenswert sind darüber hinaus eine intrazelluläre Wirkung (PHMB, PVP- I), Wirksamkeit gegen Fibrinplaques (PHMB), Förderung der Durchblutung (PHMB, OCT, kalte physikalische Plasmen), antiphlogistische Wirkung (PHMB, NaOCl/HOCl) sowie Durchbrechung des Dormant-Stadiums durch forcierte Inflammation (kalte physikalische Plasmen, Hypochlorit?).<br /> Eine Resistenzentwicklung ist dann möglich, wenn ein Antiseptikum nicht mikrobiozid, sondern lediglich mikrobiostatisch wirkt. Dies trifft zu auf Chlorhexidin, quartäre Ammoniumverbindungen (QAV), Triclosan und Silber.<br /> Folgende Anforderungen sind an die lokale Verträglichkeit zu stellen: Die Wundverträglichkeit eines Antiseptikums sollte etwa jener von Ringer- oder Kochsalzlösung oder Hydrogel entsprechen bzw. es sollte die Wundheilung gefördert werden. Es darf kein zytotoxisches Risiko für andere exponierte Strukturen (Knorpel, ZNS, Peritoneum) bestehen. Zudem dürfen keine Sensibilisierungspotenz und kein Anaphylaxierisiko vorliegen. Schließlich darf auch kein Risiko für Langzeitnebenwirkungen (Mutagenität, Karzinogenität, Teratogenität) bestehen.<br /> Ein chirurgischer Aphorismus sagt: „Gib nichts in die chronische Wunde, was du nicht auch ins Auge geben könntest.“ Dies trifft zu auf PHMB 0,04 %, OCT ≤ 0,05 %, PVP-I 5 % und NaOCl bzw. HOCl je 0,004 %. Es trifft jedoch nicht zu auf Silbersulfadiazin und Chlorhexidin.<br /> Die systemische Verträglichkeit sollte ebenfalls gegeben sein. Ein Risiko für resorptive Nebenwirkungen besteht bei PVP-I und Silberverbindungen; ein Risiko für die Bildung kritischer Verbindungen besteht bei Chlorhexidin.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Infekt_1903_Weblinks_j_infekt_1903_s13_tab1_hasenohrl.png" alt="" width="690" height="380" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Infekt_1903_Weblinks_j_infekt_1903_s13_tab2_hasenohrl.png" alt="" width="690" height="337" /></p> <p><strong>Wirkstoffauswahl</strong><br />Aus all dem ergeben sich folgende Empfehlungen für die Wirkstoffauswahl:</p> <ul> <li>Chlorhexidin sollte entweder durch Octenidin oder durch Polyhexanid ersetzt werden. Polyhexanid ist Wirkstoff der ersten Wahl für infizierte chronische Wunden und Verbrennungswunden (Konzentration 0,02 %) sowie für antiseptische Wundauflagen. Zur Infektionsprävention bei ausgedehnten traumatischen kontaminierten, auch tiefer reichenden Verletzungen wird Polyhexanid in einer Konzentration von 0,04 % angewendet.</li> <li>Als neue Option (nach Lösung des Stabilitätsproblems) stehen NaOCl bzw. HOCl zur Verfügung.</li> <li>Für spezielle Indikationen ist PVP-I in Kombination mit Ethanol weiterhin unentbehrlich. Dies sind Stich-, Schnittund Bissverletzungen nach der Phase des induzierten Blutens. Bei Schnittverletzungen besteht die Indikation vor allem dann, wenn eine Infektionsgefährdung hinsichtlich HBV, HCV bzw. HIV vorliegt.</li> <li>Silberverbindungen werden heute neu bewertet. Sie sind Wirkstoffe zweiter Wahl für kritisch kolonisierte oder infizierte chronische Wunden. Ihr Einsatz wird für maximal 14 Tage empfohlen. Sie sollen nicht großflächig, dauerhaft oder prophylaktisch eingesetzt werden.</li> <li><em>Entbehrlich</em> sind Chinolinole, Nitrofural und Chlorhexidin.</li> <li><em>Obsolet</em> sind die lokale Applikation von Antibiotika (mit den genannten Ausnahmen), Farbstoffe, organische Quecksilberverbindungen und Wasserstoffperoxid (H2O2).</li> </ul></p>
<p class="article-quelle">Quelle: „Konsensusempfehlung zu Indikationen und Auswahlkriterien von Wundantiseptika – Update 2018“, Vortrag von Prof. Dr. Axel Kramer, Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Universitätsmedizin Greifswald, gehalten am 1. Wiener Wundkongress, 14. Juni 2019
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Kramer A et al.: Konsensus – Auswahl von Wundantiseptika – Aktualisierung des Expertenkonsensus 2018. Skin Pharmacol Physiol 2018; 31: 28-58 <strong>2</strong> Kramer A, Dissemond J: Editorial. Hyg Med 2019; 44: 115-6 <strong>3</strong> Koburger T et al.: Standardized comparison of antiseptic efficacy of triclosan, PVP–iodine, octenidine dihydrochloride, polyhexanide and chlorhexidine digluconate. J Antimicrob Chemother 2010; 65: 1712-9</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Zytomegalievirus: an die Risiken der Reaktivierung denken!
Infektionen mit dem Zytomegalievirus (CMV) verlaufen bei Gesunden zumeist asymptomatisch, führen jedoch zur Persistenz des Virus im Organismus. Problematisch kann CMV werden, wenn es ...
Medikamenteninteraktionen: hochrelevant im klinischen Alltag
Bei gleichzeitiger Einnahme mehrerer Medikamente ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese einander beeinflussen. Diese Wechselwirkungen können zum kompletten Wirkungsverlust oder auch ...
Update EACS-Guidelines
Im schottischen Glasgow fand im November 2024 bereits zum 31. Mal der KongressHIV Drug Therapy Glasgow, kurz HIVGlasgow, statt. Eines der Highlights des Kongresses war die Vorstellung ...


