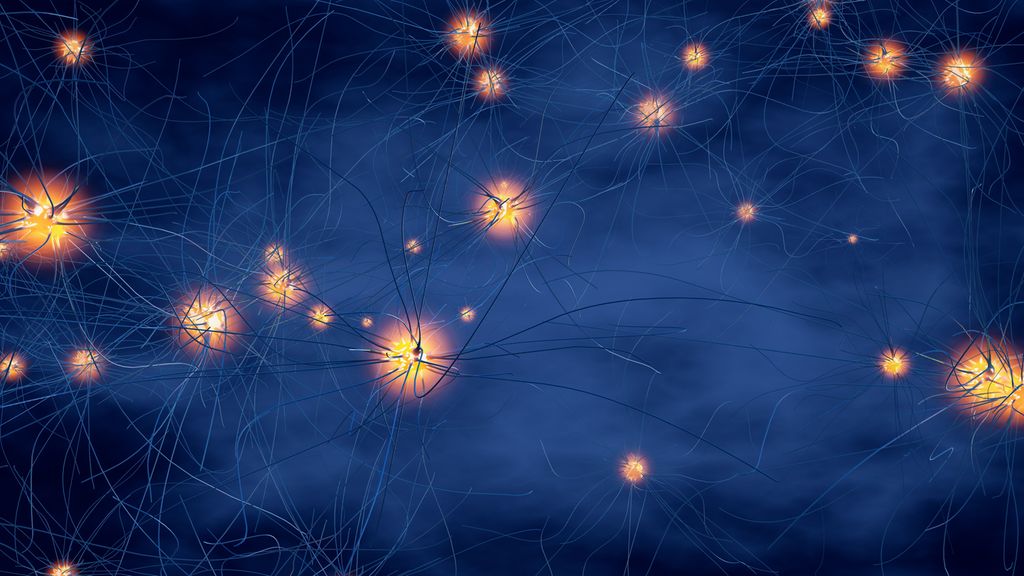
©
Getty Images/iStockphoto
6. Basler Demenzforum: Updates zu Diagnose und Therapie
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
01.03.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Experten und Interessierte trafen einander im November 2017 zum fachlichen Austausch über die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Demenzerkrankungen. Im Interview sprachen die Organisatoren Prof. Dr. phil. Andreas U. Monsch, Leiter der Memory Clinic, und Prof. Dr. med. Reto W. Kressig, Ärztlicher Direktor, Universitäre Altersmedizin Felix Platter-Spital in Basel, über die verschiedenen Themen der Veranstaltung.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><strong>Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigen Aspekte aus dem Demenzforum 2017?<br /><br /> A. Monsch:</strong> Bezüglich der Früherkennung von Hirnleistungsstörungen bei älteren Menschen konnten wir in den letzten Jahren einen aus meiner Sicht sehr sinnvollen Algorithmus entwickeln (Abb. 1). Das BrainCoach-Programm versucht nach dem Motto «Use it or lose it!» bei Menschen mit (nur) subjektiven Schwächen die kognitive Reserve zu verbessern. Im Rahmen des «case finding » kann der Hausarzt bei ausgewählten Patienten den «Brain Check» durchführen. Dieser Test sagt ihm, ob eine weiterführende Abklärung notwendig ist. Falls der Hausarzt selbst weiter abklären möchte, kann er das Montreal Cognitive Assessment (MoCA; www. mocatest.org) durchführen. Für diesen Test stehen ganz neu auch Normwerte für das deutschsprachige Europa zur Verfügung.<br /> Bezüglich medikamentöser Optionen gibt es keine neuen Möglichkeiten. Die bisherigen Studien waren leider nicht erfolgreich. Damit haben die nicht pharmakologischen Möglichkeiten zurzeit einen höheren Stellenwert.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Neuro_1801_Weblinks_s27_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1146" /></p> <p><br /> <strong>Welche Rolle hat der Hausarzt bei der Demenzfrüherkennung? Ist Ihrer Erfahrung nach die Zusammenarbeit zwischen Allgemeinmedizinern als erste Anlaufstelle und dem Facharzt respektive der Spezialklinik zufriedenstellend?<br /><br /> A. Monsch:</strong> Der Hausarzt hat hier eine absolute Schlüsselrolle inne. Wir legen sehr grossen Wert auf eine sorgfältige Kommunikation zwischen den zuweisenden Hausärzten und der Memory Clinic. Aus meiner Sicht funktioniert daher diese Kommunikation zumindest hier in Basel auch sehr gut.<br /><br /><strong> Wie beurteilen Sie die Lage bei der Identifikation von Biomarkern zur Demenzfrüherkennung? Wo liegen die Herausforderungen?<br /><br /> A. Monsch:</strong> Das Problem zurzeit ist, dass wir zwar über Biomarker, zum Beispiel aus dem Liquor, verfügen, die Analyse jedoch von den Krankenkassen (noch) nicht vergütet wird. Das entsprechende Argument lautet: Ein positiver Biomarker hat (noch) keine therapeutische Konsequenz. Wir befinden uns also hier noch in der Phase der Forschung.<br /><br /><strong> Wie ist die Stimmungslage der schweizerischen Ärzte zur Früherkennung der Demenz? Überwiegen die Befürworter oder Kritiker – und mit welchen Argumenten?<br /><br /> A. Monsch:</strong> Die überwiegende Mehrheit der Ärzte in der Schweiz erkennt durchaus die Vorteile einer Früherkennung. Sie wissen, dass die frühzeitige medikamentöse und nicht medikamentöse Intervention für die Patienten und ihre Familien entscheidende Vorteile bringt. Selbstverständlich warten wir alle auf einen Durchbruch bei der Therapie – einer Therapie, die wesentlich wirksamer sein muss als diejenige, die heute zur Verfügung steht.<br /><br /> <strong>Viele Wirkstoffe zur Behandlung der Demenz befinden sich gerade in der Entwicklung, welche sind die aussichtsreichsten Kandidaten?<br /><br /> R. W. Kressig:</strong> Bei den Beta-Amyloid- Immunisierungstherapien sind dies aus meiner persönlichen Sicht die drei Moleküle Aducanumab (Biogen), Gantenerumab (Roche) und CAD-106 (Novartis). Neben den – im Vergleich zu früheren Beta-Amyloid-Immunisierungstherapien – weiter geschärften Molekülprofilen sind hier auch die Studiendesigns sehr innovativ und erfolgversprechend mit einer Studiendurchführung in gezielteren und enger definierten Patientenpopulationen (z.T. bzgl. Demenz asymptomatisch, aber mit höchstem [genetischem] Risiko, eine solche zu entwickeln). Interessant scheinen mir auch die noch in früheren Entwicklungsphasen steckenden Tau-Moleküle. Hier sollten auch bald grössere klinische Phase-III-Studien anlaufen!<br /><br /><strong> Neben möglichst früher Diagnose ist auch multifaktorielle Behandlung basierend auf nicht pharmakologischen und medikamentösen Ansätzen von Bedeutung. Wie sieht die pharmakologische «State of the Art»-Therapie aus?<br /><br /> R. W. Kressig:</strong> Hier hat sich – leider – seit meiner Publikation in «Der informierte Arzt» (2015) nicht wirklich etwas geändert, ausser, dass Ginkgo neben 2x 120mg/d auch in einer täglichen Einmaldosis von 240mg gegeben werden kann.<br /><br /><strong> Wo setzen nicht pharmakologische Therapien an und welchen Stellenwert haben sie?<br /><br /> R. W. Kressig:</strong> Nicht medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten bei Demenz bilden neben einer frühzeitigen Demenzdiagnose, den medikamentösen Therapien und Unterstützungsmassnahmen für die Betreuer einen wesentlichen Pfeiler im erfolgreichen Management der Demenzerkrankung. Die multiplen existierenden nicht medikamentösen Interventionsprogramme basieren zum grossen Teil auf der Kommunikation mit Emotionen und entfalten ihre Hauptwirkung in der Minderung von demenzassoziierten psychosozialen Verhaltensauffälligkeiten.<br /> Körperliche Aktivitätsprogramme zeigen zusätzliche Vorteile für die Alltagsfunktionalität, die insbesondere bei gleichzeitiger proteinreicher Ernährung und Vitamin-D-Supplementation deutlich länger erhalten werden kann. Musik und musikbasierte Bewegungsprogramme wie Tanz und Rhythmik scheinen besonders geeignet, um Hirnreserven zu mobilisieren und damit die Kognition signifikant zu verbessern.<br /><br /><strong> Wie kann der Arzt hier seinen Patienten bei der Erstellung eines Vorsorgeauftrages respektive einer Patientenverfügung unterstützen?<br /><br /> A. Monsch:</strong> Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung – aber auch gegebenenfalls ein Testament – so frühzeitig wie möglich erstellt werden. Ein Arzt sollte sich mit den entsprechenden formalen und inhaltlichen Aspekten inklusive der Frage der Urteilsfähigkeit vertraut machen, um seine Patienten entsprechend unterstützen zu können.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Neuro_1801_Weblinks_s27_abb2.jpg" alt="" width="1455" height="1243" /></p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Menschen mit Demenz: Was beeinflusst deren Überleben nach Diagnosestellung?
Verschiedenste Faktoren beeinflussen die Überlebenszeit nach einer Demenzdiagnose. Das Wissen um Risikofaktoren zum Zeitpunkt der Diagnose einer Demenzerkrankung oder in deren Verlauf ...
Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?
Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...
Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung
Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...


