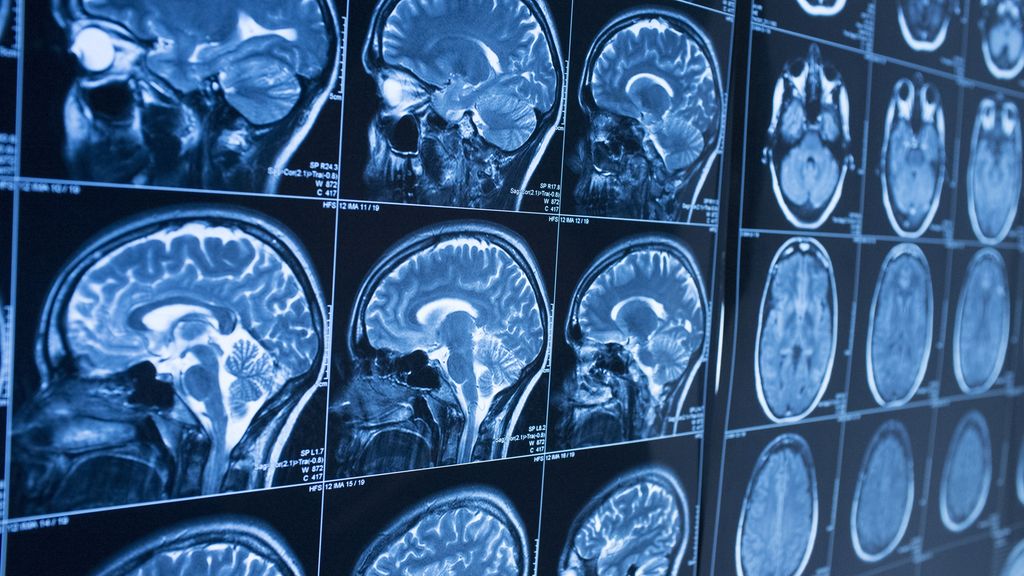
©
Getty Images/iStockphoto
Endstation Frühpension wegen MS
<p class="article-intro">Laut der jüngsten Studie zu „cost of illness“ bei Multipler Sklerose arbeiten 54 % aller Betroffenen im erwerbsfähigen Alter nicht. Und das schon ab einem relativ geringen Behinderungsgrad. Das führt zu finanzieller und sozialer Benachteiligung, aber auch zu erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten. Experten fordern mehr Aufklärung und eine konsequentere Umsetzung vorhandener Unterstützungsmöglichkeiten.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Schweregrade und Arbeitsfähigkeit hängen nur bedingt zusammen</h2> <p>In Österreich gibt es etwa 13 500 von Multipler Sklerose Betroffene.<sup>1</sup> „Der Schweregrad der Erkrankung sagt jedoch nur bedingt etwas über die Arbeitsfähigkeit aus“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Jörg Kraus, Neurologe in Zell am See und Präsident der Österreichischen Multiple Sklerose Gesellschaft. „Bei rein körperlichen Tätigkeiten ist eine Arbeitsunfähigkeit natürlich deutlich schneller erreicht als bei einem Bürojob. Gerade bei geistigen Tätigkeiten können MS-Patienten aber auch dann oft noch tätig sein, wenn sie körperlich bereits deutlicher eingeschränkt sind.“</p> <h2>Erkrankte fallen schnell aus dem Arbeitsprozess heraus</h2> <p>In der Praxis arbeiten Personen mit MS aber oft nicht. Das zeigen die aktuellen Daten aus der europaweit durchgeführten „Cost of illness“(COI)-Studie mit insgesamt knapp 17 000 Patienten, die auch in Österreich durchgeführt wurde. Univ.-Prof. Dr. Thomas Berger, MSc, von der Medizinischen Universität Wien hat die österreichischen Daten<sup>2</sup> analysiert und berichtet: „54 Prozent aller Studienteilnehmer im erwerbsfähigen Alter arbeiten nicht, 43 Prozent davon gaben MS als Grund dafür an. Erschreckend ist auch, dass bereits 50 Prozent der Patienten mit einem leichten Behinderungsgrad (EDSS 0 bis 3) nicht mehr berufstätig sind.“ Weitere Ergebnisse der Studie: 73 % der arbeitenden MS-Patienten berichteten, dass die Krankheit ihre Produktivität bei der Arbeit beeinträchtigt. Besonders unangenehm sind Fatigue (krankheitsbedingte vorzeitige Erschöpfung) (60 %), gefolgt von eingeschränkter Mobilität (30 %), kognitiven Problemen (25 %), Schmerzen (19 %) und getrübter Stimmung (18 %).</p> <h2>Frühpension ist teuer</h2> <p>Die Kosten der Erkrankung pro betroffener Person schwanken laut Studie zwischen 25 100 (Gruppe der wenig eingeschränkten Patienten) und 73 800 Euro (Gruppe der schwer beeinträchtigten Patienten) pro Jahr. Auffällig ist der hohe Kostenanteil für die Frühpensionen. Bereits bei Personen mit mildem Krankheitsverlauf machen Frühpensionen knapp ein Viertel der Gesamtkosten aus. Bei höherem Behinderungsgrad steigen sie weiter an, hier kommen jedoch auch noch weitere starke Kostentreiber wie Pflege und Sozialdienste dazu. Auch europaweit zeigte sich, dass der Verlust der Arbeitskraft die Volkswirtschaft teuer zu stehen kommt: Der größte Teil der von der Erkrankung verursachten Kosten (33 %) kommt nämlich durch den Ausfall der Produktivität der betroffenen Patienten zustande.<sup>3</sup></p> <h2>Krankheitsverlauf verlangsamen, Arbeitskraft erhalten</h2> <p>„Die Daten zeigen also eindeutig auf, wo Handlungsbedarf herrscht. Zum einen müssen wir Ärzte versuchen, durch die individuell beste Therapie für den Patienten den Krankheitsfortschritt zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Zum anderen müssen wir uns mehr als bisher der Behandlung und Vorbeugung der Fatigue, der kognitiven Dysfunktion und der Depression widmen“, appelliert Berger. Außerdem müsse es auch ein wichtigeres Ziel als bisher sein, die Arbeitsfähigkeit der Betroffenen zu erhalten, nicht nur durch medizinische Versorgung, sondern auch durch unterstützende Maßnahmen am Arbeitsplatz. Dies könne nur gelingen, wenn alle zuständigen Stellen optimal zusammenarbeiten.</p> <h2>Mit Unterstützung länger arbeitsfähig</h2> <p>„Oft muss man mit diesen Symptomen aber nur richtig umgehen, um trotzdem arbeiten zu können“, so Kraus. „Entscheidend für die Arbeitsfähigkeit ist, wie sehr Unternehmen ihren Mitarbeitern unterstützend entgegenkommen. Kann jemand, der oft von Fatigue geplagt wird, häufiger Pause machen oder Teilzeit arbeiten, wird er auch länger im Erwerbsleben bleiben können.“ Damit Arbeitgeber ihren Mitarbeitern zukünftig besser helfen können, braucht es Aufklärung, ist Karin Krainz-Kabas, Geschäftsführerin der MS Gesellschaft Wien, überzeugt. „Mehr Information führt zu mehr Verständnis. Die Verantwortlichen in den Firmen würden dann zum Beispiel wissen, dass MS meist in Phasen verläuft und dass nach schwierigen auch wieder gute Phasen kommen, in denen die Mitarbeiter produktiver sind.“ Marlene Schmid von der Multiple Sklerose Gesellschaft Tirol regt auch ganz praktische Hilfe wie die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, oder den vorübergehenden Einsatz von Arbeitsassistenten an. „Arbeitsassistenten unterstützen die Patienten am Arbeitsplatz und damit in weiterer Folge auch die Unternehmen. Sie geben beispielsweise praktische Hilfestellungen oder setzen sich für Ruhepausen ein, wenn jemand an Fatigue leidet.“ Die Kosten dieser Arbeitsassistenten werden von der öffentlichen Hand getragen.</p> <h2>Experten sind für Ausbau bestehender Programme</h2> <p>Auch Programme zur Unterstützung chronisch kranker oder behinderter Menschen nach längeren Krankenständen gäbe es ja schon, ergänzt Hon.-Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp, MBA. Sie müssten nur noch weiter ausgebaut und verfeinert werden. „Unternehmen, die sich dafür entscheiden, Personen mit Einschränkungen einzustellen oder weiterzubeschäftigen, können auf Antrag – genau wie die Betroffenen selbst – vielfältige finanzielle Förderungen von der öffentlichen Hand erhalten“, erläutert Rupp. „Verschiedene relativ junge Instrumente wie etwa fit2work oder die befristete Arbeitszeitreduktion nach den Regeln des Wiedereingliederungsteilzeitgesetzes sind sehr gute Ansätze, um das in anderen Ländern bereits erprobte ,disability management‘ für Österreich zu adaptieren.“ Es gibt allerdings keinen Rechtsanspruch dafür. Die Unternehmen müssen freiwillig mitmachen. Für die Betroffenen ist das ein großer Nachteil.“</p> <h2>Beratung für junge Patienten nach Erstdiagnose von entscheidender Bedeutung</h2> <p>„Die Diagnose MS wird oft um das 20. Lebensjahr herum gestellt. Das ist gleichzeitig ein ganz entscheidendes Alter, in dem viele berufliche und private Weichenstellungen vorgenommen werden“, betont Rupp. „Heute weiß man, dass Ausbildungs- und Berufsentscheidungen, die ohne fachliche Beratung, unter dem Eindruck von schwerwiegenden Diagnosen getroffen werden, häufig dem intellektuellen Potenzial und den Krankheitsverlaufsprognosen für die Betroffenen widersprechen. Fehlentscheidungen in dieser Phase können für die Betroffenen zu unnotwendig eingeschränkten Lebensentwürfen und zu erheblichen finanziellen Nachteilen, die bis in die Pensionsbemessung hineinwirken, führen.“<em> (red)</em></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Pressegespräch „Vereinbarkeit von Multipler Sklerose
und Beruf: Was kann man tun?“, 21. November 2018
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Baumhackl U (Hg.): Multiple Sklerose; Prävalenz & Therapie im 12-Jahres-Vergleich in Österreich. Wien: Facultas, 2014 <strong>2</strong> Berger T et al.: Mult Scler 2017; 23: 17-28. doi: 10.1177/1352458517708099 <strong>3</strong> Kobelt G et al.: New insights into the burden and costs of multiple sclerosis in Europe. Mult Scler 2017; 23(8): 1123-36</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Menschen mit Demenz: Was beeinflusst deren Überleben nach Diagnosestellung?
Verschiedenste Faktoren beeinflussen die Überlebenszeit nach einer Demenzdiagnose. Das Wissen um Risikofaktoren zum Zeitpunkt der Diagnose einer Demenzerkrankung oder in deren Verlauf ...
Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?
Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...
Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung
Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...


