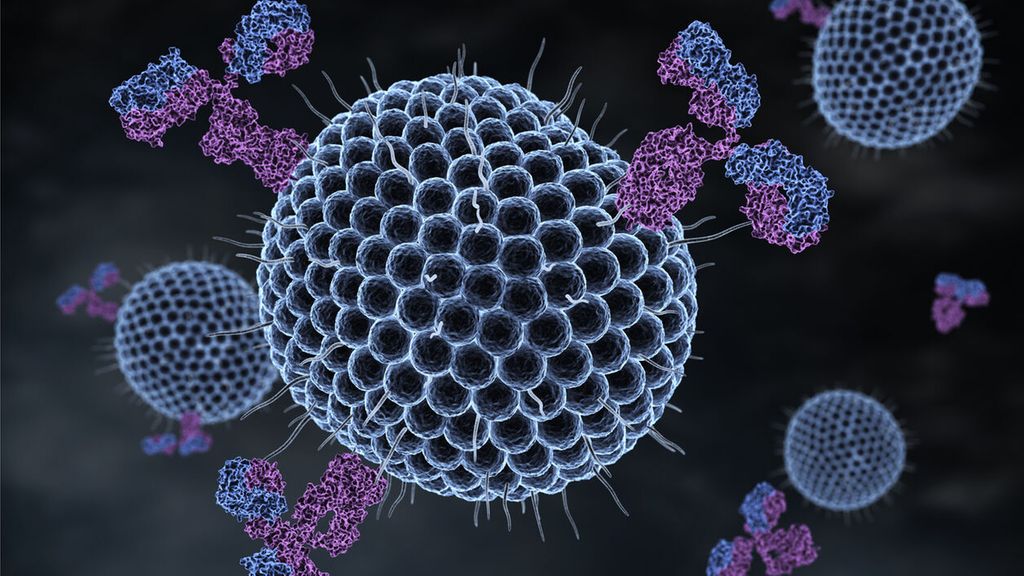
Patienten vor Herpes zoster schützen
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Bald könnte auch hierzulande der besser wirksame Shingrix®-Impfstoff zugelassen werden. Für Verunsicherung sorgen derzeit jedoch Meldungen über mögliche Nebenwirkungen.
Wer als Arzt an Herpes zoster erkrankt, versteht endlich jeden Patienten, der mit leidendem Gesicht und der Diagnose Gürtelrose vor einem in der Praxis sitzt. Die höllischen Schmerzen fühlen sich so an, als schnüre einem ein Reifen den Bauch ein oder als trampele ein Elefant auf einem herum. Flecken tauchen auf Bauch und Rücken auf, man fühlt sich schlapp wie bei einer Influenza, und das noch wochenlang. «Wer einmal unter Gürtelrose litt, wird das nicht so schnell wieder vergessen», sagt PD Dr. med. Alexander Zink, Oberarzt an der Technischen Universität in München. «Die Schmerzen gehören zu den schlimmsten in der Medizin.» Seit 2017 gibt es in der Schweiz eine Impfung gegen Herpes zoster, Zostavax® genannt. Die wirkt aber nicht so gut wie die Shingrix®-Impfung, die schon vor einigen Jahren in den USA und in der Europäischen Union zugelassen wurde. Im Frühling 2020 hat der Hersteller von Shingrix® den Antrag auf Zulassung nun auch in der Schweiz gestellt. Man erwarte die Zusage im dritten oder vierten Quartal und dass der Impfstoff hierzulande im Jahr 2022 eingeführt werde. «Das wird auch Zeit», sagt Prof. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF). «Offenbar hat sich der Hersteller zunächst auf andere Länder fokussiert, weil die Schweiz ein kleiner Markt ist.»
Zugelassen war Shingrix® in der Europäischen Union bisher nur für Menschen ab 50 Jahren, seit Ende August 2020 aber auch für diejenigen ab 18, die eine Immunschwäche haben und damit ein höheres Risiko für Gürtelrose. Zum Beispiel, weil sie an Krebs oder einer Autoimmunkrankheit leiden, eine Niere transplantiert bekamen oder Immunsuppressiva nehmen. In der Schweiz hat die Pharmafirma den Antrag für beide Situationen gestellt. «Mit Shingrix® könnten wir auch jüngere Risikopersonen schützen, und vor allem diejenigen, die eine immunsuppressive Therapie bekommen», sagt Berger. «Das ist der entscheidende Vorteil des neuen Impfstoffs.»
In Deutschland schon seit Längerem Standard
Ältere Menschen und solche mit Immunschwäche erkranken nämlich oft schwerer an Gürtelrose. Das Problem an Zostavax® ist: Es ist nur für Menschen ab 50 Jahren zugelassen, und Patienten mit einer schweren Immunschwäche dürfen nicht mit dem Impfstoff geimpft werden. Das liegt daran, dass Zostavax® lebende, abgeschwächte Varicella-zoster-Viren enthält, gegen die ein gesunder Körper Antikörper bildet. Ist jedoch das Immunsystem geschwächt, können die Impfviren eine Gürtelrose am ganzen Körper verursachen, die auch tödlich enden kann. Im Gegensatz dazu enthält Shingrix® als Totimpfstoff nur einen Teil des Virus, gegen den dann Antikörper gebildet werden. Weil Zostavax® abgesehen davon schlechter wirkt und die Wirkung nicht so lange anhält, empfiehlt die Ständige Impfkommission in Deutschland schon seit Längerem Shingrix® als Standard-Impfung: und zwar Patienten ab 60 beziehungsweise ab 50 Jahren, wenn sie bestimmte chronische Krankheiten haben oder Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem schwächen.1 Geimpft wird zweimal im Abstand von zwei bis sechs Monaten. Schwere Nebenwirkungen traten in den Studien nicht auf. Doch acht von zehn Patienten reagierten mit Schmerzen, Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle und zwei von drei mit Reaktion des ganzen Körpers wie Fieber, Müdigkeit, Muskel- oder Kopfschmerzen. «Die Symptome sind in der Regel nach ein bis zwei Tagen vorbei», sagt Dermatologe Zink. «Und der Patient hat eine sehr grosse Chance, nie eine Gürtelrose zu bekommen, die ihn wochenlang lahmlegen kann.»
Hat ein Patient Herpes zoster einmal durchgemacht, kann er trotzdem wieder daran erkranken. Deshalb wird die Impfung auch in diesen Fällen empfohlen, aber erst wenn die akute Krankheit abgeklungen ist. Unklar ist noch, ob sich in Zukunft auch Jugendliche impfen lassen sollten, die als Kind gegen Windpocken geimpft wurden. Im März 2019 hat der Gemeinsame Bundesausschuss in Deutschland beschlossen, dass Shingrix® von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird, die Richtlinie trat am 1. Mai 2019 in Kraft. «Ich finde es sehr gut, dass die Impfung Kassenleistung geworden ist», sagt Zink. «Das motiviert hoffentlich viele, sich impfen zu lassen.»
Abb. 1: 54-jährige Patientin mit Gürtelrose im rechten Thoraxbereich
Jahre nach der Impfung hohe Antikörpertiter
Die Daten sprechen für Shingrix®. «Es ist sicherlich besser als Zostavax®», sagt Prof. Paul Offit, Infektiologe an der Universität in Philadelphia. «Der Impfschutz ist bemerkenswert und hält vermutlich Jahrzehnte an, weil er so hoch ist.» In drei grossen Zostavax®-Studien mit insgesamt 38546 Patienten verhinderte Zostavax® jede zweite Gürtelrose, ausserdem zwei von drei Fällen einer Post-zoster-Neuralgie, das sind monatelang dauernde Schmerzen.2–4 Aber schon einige Jahre später lässt die Wirkung deutlich nach, und nach sieben bis zehn Jahren ist nur noch jeder Fünfte beziehungsweise jeder Dritte geschützt. In den zwei einschlägigen Studien zu Shingrix® mit insgesamt 29311 Patienten wirkte der Impfstoff in allen Altersgruppen deutlich besser als Zostavax®.5,6 Von 7698 Geimpften über 49 Jahre bekamen in den folgenden drei Jahren zum Beispiel nur 9 eine Gürtelrose, von den 7713 mit einer Placeboimpfung 235. Auch eine postherpetische Neuralgie verhinderte Shingrix® besser. Neun Jahre nach der Impfung wurden ähnlich hohe Antikörper-Titer nachgewiesen wie sechs Jahre danach. Ob die Patienten aber längerfristig genauso gut geschützt sind wie am Anfang, ist noch unklar. Mit Zostavax® braucht man sich nur einmal impfen zu lassen, mit Shingrix® zweimal im Abstand von zwei bis sechs Monaten.
Impfkomplikationen durch Shingrix®?
In den USA und in Kanada wurde Shingrix® im Oktober 2017 zugelassen, im März 2018 in der Europäischen Union. Im Frühling 2020 hat der Hersteller von Shingrix® – GlaxoSmithKline – den Antrag auf Zulassung nun auch in der Schweiz gestellt. Man erwarte die Zusage im dritten oder vierten Quartal 2021 und dass der Impfstoff hierzulande im Jahr 2022 eingeführt werde. Aber was macht man, wenn Patienten aus dem Internet von Shingrix® erfahren haben und sich auch damit impfen lassen wollen? «Grundsätzlich wäre es nach dem Heilmittelgesetz möglich, für einen einzelnen Patienten Shingrix® im Ausland zu kaufen und zu importieren», sagt Dr. Urs Kientsch, Pressesprecher bei GlaxoSmithKline. «Man muss natürlich die entsprechenden Vorschriften zum Transport strikt einhalten.» Patienten in der Schweiz können sich mit einem Rezept Shingrix® in einer deutschen Apotheke kaufen, es in die Schweiz bringen und sich hier impfen lassen. Während der Fahrt müssen sie den Impfstoff kühlen und vor Licht schützen. Die zwei erforderlichen Dosen kosten in Deutschland 226,80 Euro. Auch Zostavax® muss der Patient selbst bezahlen, die Einzeldosis kostet rund 200 Franken. Es soll auch einzelne Spitäler oder Apotheken geben, die Shingrix® importieren und hier verkaufen.
Sorgen bereitet jedoch die Meldung des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vor Kurzem, das unter anderem die Sicherheit von Impfstoffen prüft. Dem PEI und auch der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft meldeten seit August 2019 auffällig viele Ärzte, sie hätten bei ihren Patienten kurz nach der Shingrix®-Impfung einen Ausschlag beobachtet. Der habe entweder so ausgesehen wie eine Gürtelrose oder wie ein anderer Ausschlag mit grösseren Bläschen. Es seien so viele Fälle gewesen, dass das Institut nun in einer Studie klären wolle, ob die beschriebenen Hautausschläge wirklich auf die Impfung zurückzuführen seien. Deshalb soll der Arzt bei Verdacht eine Probe vom Bläscheninhalt nehmen. Denkbar ist, dass die Impfung eine Reaktivierung der Windpocken-Viren im Körper auslöst. Hierzu würde passen, dass einige der unerwarteten Hautausschläge bei Patienten aufgetreten sind, die früher schon einmal eine Gürtelrose gehabt hatten. Allerdings kann das in diesen Fällen auch eine erneute Gürtelrose sein, denn man kann an der Infektion ja mehrmals im Leben erkranken. Das Gleiche trifft zu, wenn im Bläscheninhalt Viren nachgewiesen werden. Theoretisch könnte das für eine Reaktivierung durch die Impfung sprechen, es könnte aber auch sein, dass der Patient in diesem Falle noch einmal an Gürtelrose erkrankt ist. Die Rekrutierung sei abgeschlossen, heisst es im PEI, man erwarte die Publikation der Ergebnisse in der zweiten Hälfte des Jahres 2021.
Die Eidgenössische Kommission fürImpffragen ist dabei, alle Studien erneut zu sichten und eine Impfempfehlung aufzuschreiben. Die könnte entweder nur Shingrix® lauten oder nur Zostavax® oder sich für beide aussprechen. «Wir planen, dass die Empfehlung erscheint, wenn es Shingrix® hierzulande gibt», sagt Christoph Berger. «Bis dahin ist es besser, unsere Patienten mit Zostavax® zu impfen, als gar nicht.»
Bericht:
Dr. med. Felicitas Witte
Medizinjournalistin
Literatur:
1 Epidemiologisches Bulletin 36/2017 des Robert-Koch-Institutes: www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2017/Ausgaben/34_17.pdf?__ blob=publicationFile 2Oxman MN et al.: J Infect Dis 2008; 197(Suppl 2): S228-36 3 Schmader KE et al.: Clin Infect Dis 2012; 55: 1320-8 4 Morrison VA et al.: Clin Infect Dis 2015; 60: 900-9 5 Lal H et al.: N Engl J Med 2015; 372: 2087-96 6 Cunningham AL et al.: N Engl J Med 2016; 375: 1019-32
Das könnte Sie auch interessieren:
KI in der Dermatologie
Die Dermatologie zählt zu den Fachgebieten der Medizin, in denen visuelle Befunde eine zentrale Rolle spielen. Die Haut als grösstes Organ des Menschen erlaubt oftmals eine Vorhersage ...
Systemtherapie des HER2-low fortgeschrittenen Mammakarzinoms
HER2-low- und HER2-ultralow-Mammakarzinome stellen besondere Herausforderungen dar, da sie sich sowohl in ihrer Prognose als auch im Therapieansprechen von HER2-positiven und HER2-zero- ...
Die menschliche Haut in der modernen Kunst
Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...


