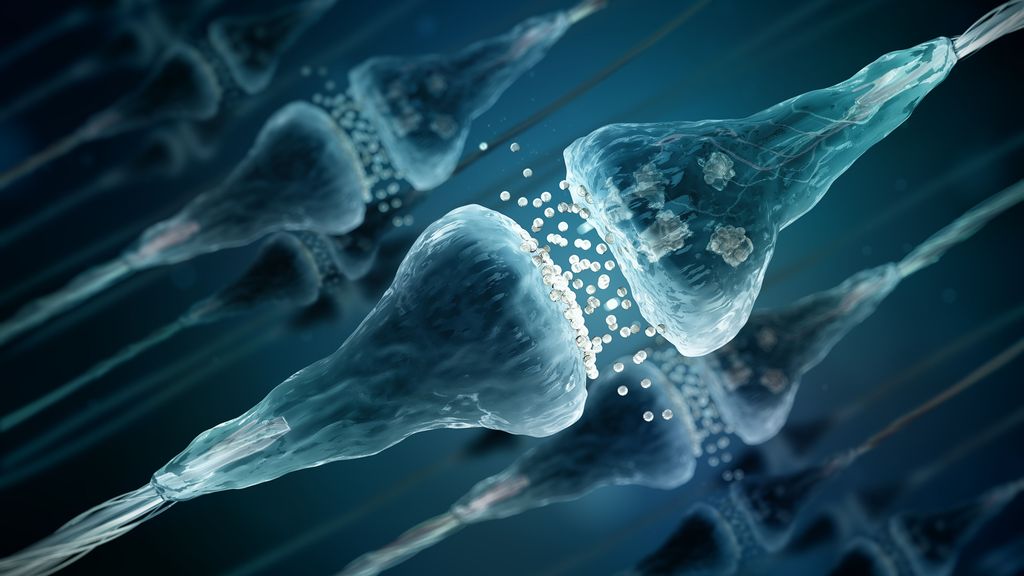
©
Getty Images/iStockphoto
Medikamentöse Therapien in der Spätphase des Morbus Parkinson
Jatros
Autor:
Dr. Selina Haas
Neuromed Campus<br> Kepler Universitätsklinikum, Linz<br> E-Mail: selina.haas@keplerunikinikum.at
30
Min. Lesezeit
14.12.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Gerade beim fortgeschrittenen Parkinsonsyndrom stellt die medikamentöse Therapie eine echte Herausforderung für jeden betreuenden Arzt dar, da nicht nur die motorischen Symptome, sondern auch die nicht motorischen Symptome berücksichtigt werden müssen. Meist erhalten die Patienten eine Vielzahl an Medikamenten – nicht nur wegen der Grunderkrankung selbst, sondern auch aufgrund von mehreren Komorbiditäten. Diese müssen daher ebenfalls in das Therapiekonzept einfließen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die medikamentöse Therapie im fortgeschrittenen Stadium des M. Parkinson ist immer individuell zu gestalten.</li> <li>Sowohl die motorischen als auch die nicht motorischen Komplikationen sind zu berücksichtigen.</li> <li>Therapieanpassungen sind meist laufend erforderlich.</li> </ul> </div> <p>Zu den Schwierigkeiten der Levodopa- Langzeittherapie zählen motorische Komplikationen und eine Zunahme der schlecht Levodopa-responsiven Symptome wie Freezing und Haltungsinstabilität ebenso wie nicht motorische Symptome.</p> <h2>Verfügbare Arzneistoffklassen</h2> <ul> <li>Dopaminsubstitution<br /> - Levodopa<br /> - Dopaminagonisten<br /> - COMT-Hemmer<br /> - MAO-B-Hemmer</li> <li>Amantadin</li> <li>Anticholinergika</li> </ul> <p><strong>Levodopa mit Decarboxylasehemmer</strong><br /> Levodopa ist die die wirksamste Substanz unter den Parkinsonmedikamenten und zeigt eine weiterbestehende Wirksamkeit auch in der Spätphase. Levodopa ist wirksam gegen Off-Phasen, kann aber Dyskinesien auslösen bzw. verstärken. Es weist ein günstiges Verträglichkeitsprofil auf, auch in höherem Alter und bei kognitiv eingeschränkten Patienten, es besteht aber die Gefahr eines dopaminergen Dysregulationssyndroms. Dabei kommt es zu einer Substanzabhängigkeit mit Verhaltens- und kognitiven Auffälligkeiten bei unkontrollierter Levodopaeinnahme durch den Patienten selbst.</p> <p><strong>Dopaminagonisten</strong><br /> Heutzutage sind die nicht ergolinen Substanzen Pramipexol, Ropinirol und Rotigotin in Verwendung. Auch Apomorphin zählt zu den Dopaminagonisten, sogar mit der stärksten Wirksamkeit, die der Wirkstärke von Levodopa entspricht. Dopaminagonisten sind synthetische Substanzen, die direkt an Dopaminrezeptoren wirken. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen den oralen Substanzen. Die Wirkstärke liegt unter der von Levodopa und ihre Wirkung tritt langsamer ein, sie wirken aber länger. Agonisten können Dyskinesien verstärken oder dazu führen, dass diese erstmals auftreten. Die Wahl des Agonisten richtet sich nach individueller Verträglichkeit, Wirksamkeit und Patientenwunsch. Die Risiken bestehen im Auslösen von Halluzinationen, Verwirrtheit, Tagesmüdigkeit, in plötzlichem Einschlafen, Beinödemen und Impulskontrollstörungen.</p> <p><strong>COMT-Hemmer</strong><br /> Entacapon und Tolcapon haben eine ähnliche Wirkdauer wie Levodopa. Sie bewirken durch eine Blockade eines peripheren Abbauweges von Levodopa eine 30– 50 % ige Verlängerung der Verfügbarkeit von Levodopa. Sie weisen keine Verzögerung des Wirkungseintritts auf und sind wirksam gegen motorische Fluktuationen, sie können aber Dyskinesien verstärken.</p> <p>Tolcapon hat eine längere Halbwertszeit als Entacapon, erfordert aber ein Leberfunktionsmonitoring (Leberwertkontrolle vor Einstellung, im 1. Jahr alle 2 Wochen, dann alle 4 Wochen für 6 Monate, danach alle 8 Wochen) und ist daher weniger häufig in Verwendung.</p> <p><strong>MAO-B-Hemmer</strong><br /> Rasagilin und Selegilin sind gegen motorische Fluktuationen wirksam und steigern die zentrale Verfügbarkeit von Levodopa durch Hemmung von MAO-B, das die oxidative Desaminierung von Levodopa bewirkt. Sie sind allgemein gut verträglich und erfordern keine spezielle Überwachung. Eine sichere Wirksamkeit bei motorischen Fluktuationen durch Selegilin ist nicht gegeben, Rasagilin ist gegen motorische Fluktuationen wirksam.</p> <p><strong>Amantadin</strong><br /> Amantadin bewirkt eine amphetaminartige Freisetzung von gespeicherten Katecholaminen, v.a. von Dopamin. Es gibt Hinweise, aber keinen Nachweis der Wirksamkeit bei motorischen Fluktuationen. Der klinische Nutzen liegt in der Anwendung gegen Dyskinesien. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist auch die Möglichkeit einer parenteralen Verabreichung. Das Risiko für Verwirrtheit bei kognitiv eingeschränkten und älteren Patienten ist allerdings hoch.</p> <p><strong>Anticholinergika</strong><br /> Es gibt keine Daten über die Wirksamkeit von Anticholinergika bei motorischen Komplikationen. Sie wirken vor allem auf den Tremor und die Rigidität und es besteht eine Verträglichkeitseinschränkung bei neuropsychiatrisch auffälligen Patienten und bei Patienten über 60 Jahre. Die Anwendung beim fortgeschrittenen idiopathischen Parkinsonsyndrom ist daher deutlich limitiert. In Studien zeigen sie nur ein schwaches Evidenzniveau.</p> <h2>Motorische Komplikationen</h2> <ul> <li>Wearing-off</li> <li>nicht vorhersehbare Fluktuationen</li> <li>Dyskinesien</li> <li>Dystonien</li> </ul> <p>Beim Wearing-off kommt es zu einem erkennbaren Nachlassen einer Einzeldosis am Ende eines Dosisintervalls. Bei den nicht vorhersehbaren Fluktuationen treten plötzlich einsetzende, unerwartete Offs und eine stark verzögerte Wirkung einer Einzeldosis auf. Dyskinesien kommen bei 30–80 % der Patienten im Spätstadium vor. Diese unwillkürlichen choreatischen Bewegungen unterteilt man in „Peak dose“-Dyskinesien bei guter Wirksamkeit der dopaminergen Medikation und die selteneren biphasischen Dyskinesien bei Wirkungseintritt und bei abklingender Wirkung von Levodopa. Dystonien treten meist im Off in den frühen Morgenstunden auf, können schmerzhaft sein und betreffen meist die unteren Extremitäten.</p> <p><strong>Praktisches Vorgehen …</strong><br /> … bei Wearing-off: Eine Verkürzung der Intervalle der Einnahme von Levodopa und die Addition eines COMT-Hemmers mit Aufklärung über die Bedeutung der Einnahmezeiten und die Vermeidung der Einnahme zu den Mahlzeiten (insbesondere in Verbindung mit Eiweiß) können zu einer Reduzierung der Off-Zeiten führen. Auch besteht die Möglichkeit der Addition eines MAO-B-Hemmers oder von Entacapon oder beidem. Die zusätzliche Gabe eines Agonisten ist ebenfalls möglich.</p> <p>… bei frühmorgendlichen und nächtlichen Off-Phasen: Hier kommen retardierte Agonisten, eine Morgendosis lösliches Levodopa und eine abendliche Gabe von Levodopa in retardierter Galenik infrage.</p> <p>… bei unvorhersehbaren Fluktuationen: Unvorhersehbare Fluktuationen stellen die Indikation für eine Eskalationstherapie mit tiefer Hirnstimulation, Apomorphin- oder Duodopapumpe dar. Sollten diese Therapiemöglichkeiten vom Patienten nicht gewünscht sein, kann eine bedarfsweise Gabe von Levodopa zu einer Verbesserung führen. Auch eine s.c. Gabe von Apomorphin kann von den Patienten eventuell toleriert werden.</p> <p>… bei „Peak dose“-Dyskinesien: Eine Verbesserung lässt sich durch eine Verkürzung der Einnahmeintervalle mit kleineren Levodopa-Dosen erzielen. Die Wirkdauer sollte dann durch einen COMT-Hemmer oder Agonisten verlängert werden. Versuchsweise kann auch die Levodopa-Dosis reduziert werden, mit der Gefahr der Zunahme der Off-Phasen. Bei Fehlen einer Kontraindikation kann Amantadin eingesetzt werden.</p> <p>… bei biphasischen Dyskinesien: Hier hilft gelegentlich eine Erhöhung der Einzeldosen von Levodopa oder die Einstellung auf einen Agonisten, wobei aber Letztere „Peak dose“-Dyskinesien verstärken können. Auch hier kann Amantadin bei Fehlen von Kontraindikationen hilfreich sein.</p> <p>Beim fortgeschrittenen Parkinsonsyndrom schränken die nicht motorischen Symptome die Lebensqualität der Patienten oft mehr ein als die motorischen. Entsprechende zusätzliche Medikamentengaben oder auch nicht medikamentöse Maßnahmen wie Physio-, Ergotherapie und Logopädie sind daher häufig erforderlich.</p> <h2>Nicht motorische Symptome</h2> <ul> <li>Demenz</li> <li>Depression</li> <li>Psychose</li> <li>medikamenteninduzierte Verhaltensstörungen (Impulskontrollstörungen, abnorm repetitives Verhalten, dopaminerges Dysregulationssyndrom)</li> <li>autonome Dysfunktion (orthostatische Hypotension, Blasenstörungen, erektile Dysfunktion, Obstipation, Sialorrhö)</li> <li>Schlaf- und Wachstörungen (REMSchlaf- Verhaltensstörung, Insomnie, Tagesmüdigkeit und Einschlafattacken)</li> </ul> <p><strong>Demenz und Halluzinationen</strong><br /> 80 % der Patienten mit idiopathischem Parkinsonsyndrom entwickeln eine Demenz, Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und frontal-exekutive Funktionsstörungen sind ebenfalls häufig. Bei 70 % der Parkinsonpatienten mit Demenz kommt es zu illusionären Verkennungen, Halluzinationen und Wahn. Die Ursache dafür sind häufig Infekte oder auch Medikamente. Die Therapie besteht hier in einer Medikamentenreduktion, bis nur mehr Levodopa gegeben wird. Rivastigmin zeigt eine signifikante, aber mäßige Verbesserung von Kognition und neuropsychiatrischen Symptomen. Antipsychotisch wirken Rivastigmin und Clozapin (regelmäßige Differenzialblutbildkontrollen bei Gefahr einer Agranulozytose erforderlich). Der Stellenwert von Quetiapin ist noch unklar.</p> <p><strong>Depression</strong><br /> Depressionen stellen bei 40 % der Patienten ein Problem dar und haben einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität. Die Depression ist häufig mit Angst und Reizbarkeit verbunden. Es konnte nachgewiesen werden, dass Pramipexol eine antidepressive Wirkung hat. Ansonsten können Sertralin, Paroxetin, Venlafaxin, Nortriptylin, Desipramin und Citalopram eingesetzt werden.</p> <p><strong>Impulsassoziierte Verhaltensstörungen</strong></p> <ul> <li>Impulskontrollstörungen (Glücksspiel, Hypersexualität, impulsartiges Geldausgeben oder Essen)</li> <li>dopaminerges Dysregulationssyndrom (Substanzabhängigkeit in Verbindung mit Verhaltensauffälligkeiten)</li> <li>Punding (lang andauernde, repetitive, stereotype Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit einem früheren Beruf oder Hobby stehen, z.B. putzen, sammeln, ordnen)</li> </ul> <p>Die Therapie besteht in einer Reduktion der dopaminergen Medikation, gegebenenfalls müssen Neuroleptika und Hypnotika verwendet werden.</p> <p><strong>Schlafstörungen und Tagesmüdigkeit</strong><br /> Diese treten bei mindestens 60 % der Patienten auf. Bei nächtlichen Off-Phasen kann Levodopa in retardierter Galenik oder Rotigotin gegeben werden. Bei Nykturie kann eine anticholinerge Beeinflussung der Blasenmotorik erfolgen, vermieden werden soll eine späte Flüssigkeitsaufnahme. Blasentraining und Verwenden eines Leibstuhls können hier eine Alltagserleichterung bringen. Bei nächtlichen Angstzuständen sollen sedierende Antidepressiva zum Einsatz kommen. Liegt eine REM-Schlaf-Verhaltensstörung vor, erfordert dies evtl. eine abendliche Gabe von Clonazepam. Gelegentlich können auch Medikamente selbst zu einer Schlafstörung führen, wenn z.B. Amantadin am späten Nachmittag verabreicht wird. Hier empfehlen sich eine entsprechende Umstellung der Tageszeit der Einnahme und eine Aufklärung des Patienten. Gelegentlich äußert sich ein Punding überwiegend nachts. Genauso wie bei der exzessiven Tagesmüdigkeit, die in 29 % der Fälle auftritt, ist hier eine Reduktion oder ein Absetzen des Agonisten erforderlich.</p> <p><strong>Autonome Funktionsstörungen</strong></p> <ul> <li>Nykturie und Urgesymptomatik</li> <li>orthostatische Regulationsstörung</li> <li>Obstipation (geänderte Magen-Darm- Motilität der Grunderkrankung oder medikamenteninduziert)</li> <li>erektile Dysfunktion</li> <li>Sialorrhö</li> </ul> <p><em>Blasenstörung</em><br /> Bei Blasenstörungen ist ein Ausschluss von Komorbiditäten wie Diabetes mellitus oder einer Prostatahypertrophie erforderlich. Danach ist eine ausreichende Dopaminersatztherapie die Grundlage. Trospiumchlorid und Solifenacin passieren in geringerem Ausmaß die Blut-Hirn-Schranke und sollten daher vor dem Einsatz von Oxybutynin und Tolterodin versucht werden. Zu achten ist bei allen diesen Präparaten auf mögliche anticholinerge Nebenwirkungen.</p> <p><em>Orthostatische Hypotonie</em><br /> Orthostatische Reaktionen sollten durch einen Schellong-Test und eine Kipptischuntersuchung objektiviert werden. Etwaige blutdrucksenkende Medikamente sollen abgesetzt werden. Nicht pharmakologische Maßnahmen sind eine adäquate Flüssigkeitszufuhr, salzreiche Kost, mehrere kleine Mahlzeiten, Kompressionsstrümpfe, langsames Aufrichten und Schlafen in erhöhter Oberkörperposition. Bei ausgeprägter Sturzneigung kommen Fludrocortison und Midodrin zum Einsatz.</p> <p><em>Andere autonome Funktionsstörungen</em><br /> Die Ursache der häufig auftretenden Obstipation aufgrund einer geänderten Magen- Darm-Motilität ist im Rahmen der Grunderkrankung zu sehen, kann aber auch medikamenteninduziert sein. Hier soll auf eine auseichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Meist ist aber der Einsatz von Laxanzien, wie z.B. Macrogol, erforderlich. Die Behandlung einer erektilen Dysfunktion kann mit Sildenafil erfolgen, bei Sialorrhö kann Botulinumtoxin hilfreich sein.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Die Betreuung eines Patienten mit idiopathischem Parkinsonsyndrom ist besonders im Spätstadium aufgrund des Multisystemcharakters immer individuell zu gestalten; eine laufende Therapieanpassung ist erforderlich.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei der Verfasserin</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?
Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...
Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung
Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...
Fachperson für neurophysiologische Diagnostik – Zukunftsperspektiven eines (noch) unterschätzten Berufes
Die Aufgaben der Fachperson für neurophysiologische Diagnostik (FND) haben sich in den letzten Jahren verändert. Dies geht zum einen mit den erweiterten Diagnostikmöglichkeiten und zum ...


