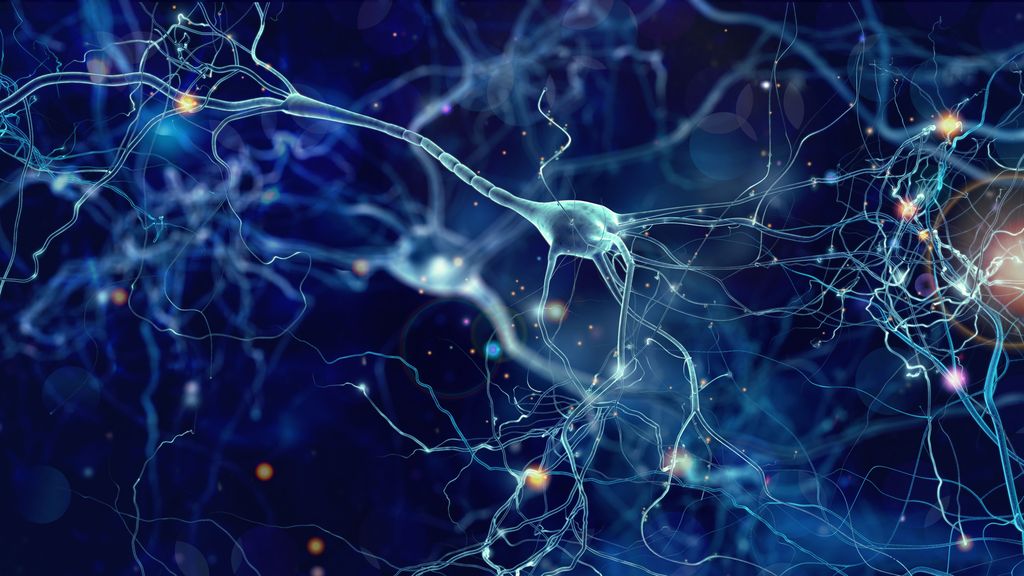
©
Getty Images/iStockphoto
Biomarkersuche, Demenzstrategie und Karriereplanung
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
30.11.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der Neurologie kommt für zahlreiche Erkrankungen der alternden Gesellschaft eine Schlüsselrolle zu. Dem trug auch das diesjährige Kongressprogramm der Schweizer Neurologischen Gesellschaft Rechnung. Neben Bewegungsstörungen, Demenz und Schlaganfall wurde aber auch über die Zukunftsperspektiven junger Neurologen diskutiert. Gastgesellschaft 2017 war die Schweizerische Gesellschaft für Verhaltensneurologie (SGVN).</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die häufigsten neurologischen Erkrankungen sind laut European Academy of Neurology (EAN) Kopfschmerzen, gefolgt von Schlafstörungen, Schlaganfall und neurodegenerativen Erkrankungen. Die teuersten Krankheiten sind Demenz und Schlaganfall. Ein wichtiges Ziel in diesem Szenarium ist die frühe Diagnose. Die Suche nach Biomarkern bei Morbus Parkinson und Demenzerkrankungen läuft auf Hochtouren. Fortbildungskongresse sind ein wichtiger Weg, um die Ergebnisse der Forschung schneller zum Patienten zu bringen. Beim SNG-Kongress in Interlaken unter Kongresspräsident Prof. Dr. med. Hans Jung, Vizepräsident der SNG, gab es neben Updates zum aktuellen Stand der Forschung auch reichlich Motivation für den «neurologischen Nachwuchs».</p> <h2>Swiss Young Neurologists</h2> <p>Sich für ein medizinisches Fach zu entscheiden, ist das eine. Die Karriere zu planen und im Berufsleben Zufriedenheit zu finden, das andere. In der Sitzung der Swiss Young Neurologists SYN erläuterte Dr. med. Hakan Sarikaya aus Bern, warum er lieber hauptberuflich in einer neurologischen Praxis tätig ist als am Universitätsspital. Die Forschungstätigkeit sei ihm zu weit weg von den Patienten gewesen und seine Familie zu kurz gekommen. Mit einer 80 % -Tätigkeit in einer Gemeinschaftspraxis und 20 % weiterhin in der Stroke-Präventionsforschung am Inselspital könne er nun seine Interessen für klinische Neurologie und für Forschung sehr zufriedenstellend vereinen. Dass die Arbeit in einer Praxis langweilig sei, widerlegte er mit einer langen Liste von seltenen Erkrankungen, bei denen er die Diagnose stellen konnte. Sein Rat an die jungen Kollegen: eine gesunde Portion Selbstkritik, Netzwerkdenken und Gelegenheiten als Chancen erkennen und nutzen.<br /> Prof. Philipp Ryvlin von der Neurologie am CHUV Lausanne stellte die Frage, ob «Neurowissenschaften glücklich machen». Eine Befragung von 437 Professoren zeigte auf, dass Befragte mit Kindern und Familie unzufriedener waren. Literatur zu dem Thema «Arbeiten im Gesundheitswesen und Glück» gebe es nur aus Fernost (Chinese Happiness Invention<sup>1</sup>). Der Faktencheck, ob wir uns glücklich fühlen, findet übrigens im linken Thalamus statt.<br /> Prof. Ryvlin forscht über epileptologische und technische Fragestellungen. Durch die Digitalisierung sei Forschung einfacher geworden und künstliche Intelligenz sei nicht mehr nur Fantasie, sondern in einigen Bereichen schon Realität. Als Beispiele nannte er intelligente Uhren, die bei Epilepsiepatienten Anfälle detektieren und aufzeichnen können. Oder es gebe bereits Chips in Pillen, um die Adhärenz prüfen zu können. Für die kommende Generation junger Ärzte werde es selbstverständlich sein, künstliche Intelligenz im Alltag zu nutzen.</p> <h2>Biomarker der Parkinson-Erkrankung</h2> <p>Die Pathologie, die der Parkinson-Erkrankung (PD) zugrunde liegt, beginnt lange vor der klinischen Diagnose. Immer mehr Untersuchungen zeigen, dass eine Reihe von Symptomen zum Teil bereits viele Jahre vor den typischen motorischen Störungen auftreten. Dazu gehören etwa Obstipation, ein gestörter Geruchssinn, Schmerzen, Depression, Herzrhythmusstörungen oder Blasenentleerungsstörungen. Auch die REM-Schlaf-assoziierte Verhaltensstörung («REM sleep behavior disorder», RBD) zählt dazu. Bei Gesunden ist in dieser Schlafphase die Motorik gehemmt, die von dieser Störung Betroffenen leben ihr Traumgeschehen jedoch körperlich aus.<sup>2</sup> RBD zählt inzwischen wie die Parkinson-Erkrankung oder die Multisystematrophie zu den Synukleopathien.<br /> «Die Diagnose einer Parkinson-Erkrankung ist in der Prodromalphase noch nicht machbar», räumte Prof. Dr. med. Pierre Burkhard aus Genf ein. Die Biomarkersuche laufe auf Hochtouren, wobei klinische (Krankheitsverlauf, Hypo- und Anosmie, RBD, kognitiver Abbau) und nicht klinische (Neuroimaging, autonome Funktionstests, biochemische Marker, Gewebeproben und genetische Untersuchungen) Biomarker verfolgt werden. Aktuelle Empfehlungen zur Diagnostik der prodromalen PD enthalten den DAT-Scan, eine olfaktorische Testung und eine Herzuntersuchung sowie einen Fragebogen zu Parasomnien.<sup>3</sup> Rund 96,7 % der PD-Patienten haben eine Hyposmie schon zu Beginn ihrer Erkrankung.<sup>4</sup> Bildgebende Verfahren und Gewebebiopsien sind aktuell die vielversprechendsten Biomarker, schloss Prof. Burkhard seine Ausführungen.</p> <h2>Biopsien als Fenster zum ZNS</h2> <p>Zentrales und peripheres Nervensystem sind bei PD von derselben Pathogenese betroffen. Welche Proteine und Aggregate als Biomarker für PD in anderen Geweben wie Darmbiopsien, Speicheldrüsen (Glandula submandibularis) und der Haut infrage kommen, erläuterte Prof. Alain Kaelin, Direktor des Neurozentrums der italienischen Schweiz, Lugano.<sup>5</sup> Seine Arbeitsgruppe arbeitet an Hautbiopsien und benutzt für den Nachweis der Neurodegeneration α-Syn, abnorme Aggregate, z.B. Oligomere und Phospho-Synuclein.<sup>6</sup> Dafür genügt ein Stanzbiopsie-Material von drei Millimetern Durchmesser. «Die Biopsie ist leicht durchzuführen, nahezu schmerzlos und gibt Informationen über die kleinen Nervenfasern», erläuterte Prof. Kaelin. PD-Patienten haben sehr früh eine milde Neuropathie der kleinen Nervenfasern. aSyn-Ablagerungen und phosphoryliertes α-Syn sind bei PD und verwandten Erkrankungen (RBD, LBD) erhöht. Mit Hautbiopsien könnte bereits eine präklinische Erkrankung aufgezeigt werden, Follow-up-Biopsien zum Nachweis von Progression und Therapieeffekt seien möglich.<sup>7</sup></p> <h2>Ocrelizumab bei MS</h2> <p>Bisher stand für die primär progrediente Multiple Sklerose (PPMS) kein spezifisches Medikament zur Verfügung. Mit Ocrelizumab gibt es nun eine Therapieoption, die das Fortschreiten nachweislich verlangsamt.<sup>8–11</sup> Wie Prof. Renaud de Pasquier in Interlaken erläuterte, ist Ocrelizumab ein gegen eine spezielle Untergruppe der B-Lymphozyten gerichteter monoklonaler Antikörper (Anti-CD20), wohingegen die meisten anderen MS-Medikamente sich gegen T-Zellen richten.<br /> Ocrelizumab reduziert die Zahl der neuen Läsionen im Gehirn und bremst die Krankheitsprogression, so die gepoolten Daten aus OPERA I und II sowie die aktuell veröffentlichten Ergebnisse der ORATORIO- Studie.<sup>9–11</sup> Prof. Adam Czaplinski diskutierte in Interlaken die Studiendaten von ORATORIO: 732 Patienten mit primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS) erhielten, randomisiert im Verhältnis 2:1, entweder Ocrelizumab (600mg) oder Placebo als Infusion. Die Behandlung erfolgte alle 24 Wochen über einen Zeitraum von mindestens 120 Wochen. Primärer Endpunkt war die Krankheitsprogression, gemessen auf der Standardskala EDSS (Expanded Disability Status Scale), welche MS-bedingte Behinderungen systematisch erfasst. In der Ocrelizumab-Gruppe verzeichneten die Forscher bei 32,9 % der Patienten eine Krankheitsprogression, in der Placebogruppe bei 39,3 % . Die Hazard Ratio, also das prozentuale Risiko fortschreitender Behinderung, lag bei 0,76 und sprach damit für eine Krankheitsstabilisierung (95 % -Konfidenzintervall: 0,59 bis 0,98). Unter Ocrelizumab verschlechterten sich nach 120 Wochen weniger Patienten im 25-Meter-Gehtest: 55,1 % versus 38,9 % , die Rollstuhlpflicht wurde später erreicht. Gering waren hingegen die Unterschiede in der Lebensqualität, die mittels SF36-Fragebogen erfasst wurden. Die Fatigue, ein häufiges Phänomen bei PPMS-Patienten, besserte sich interessanterweise auch bei Patienten mit «confirmed disability progression» (CDP) leicht. Ocrelizumab wurde gut vertragen, es traten keine schwerwiegenden Infektionen auf.<br /> Ocrelizumab sei zwar eine Innovation, aber es sei noch zu früh, um von einem Durchbruch zu sprechen, so die Experten. Die Indikation zu stellen sei schwierig, bei weit fortgeschrittener MS mit einem EDSS von 7–8 sieht Prof. Czaplinski sie nicht mehr, auch wenn gerade diese Patienten eine neue Therapie wünschen. Prof. Kappos wies darauf hin, dass er bei Hinweisen für Entzündungsaktivität oder Progression Ocrelizumab trotz hohem EDSS einsetzen würde. Sicherheitsbedenken bezüglich Allergien gebe es nicht, der humanisierte Antikörper könne ambulant verabreicht werden. Allerdings wurden in den Studien einige Fälle von Tumoren beschrieben. Diese traten häufiger in den Ocrelizumab- Armen auf. Durch die sorgfältige Beobachtung im Langzeitverlauf werde sich zeigen, was eine gezielte B-Zell-Depletion bewirkt.</p> <h2>Neurointensivmedizin</h2> <p>Ein Gebiet, in dem viele Themen noch kontrovers diskutiert werden, ist die Neurointensivmedizin. Prof. Werner Z’Graggen, Leiter der Neurointensivmedizin am Inselspital Bern, zeigte auf, wann die Autoregulation des zerebralen Blutflusses zu versagen droht, welche Messmöglichkeiten es gibt und wie Intensivmediziner, Neurochirurg und Neurologe interdisziplinär zusammenarbeiten.<br /> Das Gehirn hat eine sehr hohe oxydative Stoffwechselaktivität, einen daraus resultierenden hohen Sauerstoffbedarf und eine geringe Ischämietoleranz. Folglich ist das Gehirn in besonderem Masse auf einen ausreichenden Perfusionsdruck angewiesen. Unter physiologischen Bedingungen unterliegt das Gehirn einer Autoregulation, d.h., der zerebrale Blutfluss wird bei einem mittleren arteriellen Druck (MAP) von 60–160mmHg durch zerebrale Vasodilatation bzw. -konstriktion gleichmässig gehalten.<br /> Die Sauerstoffversorgung des Gehirns nach schweren traumatischen Hirnverletzungen, Subarachnoidalblutung, Hypoxie, Hirnschlag usw. funktioniert nicht mehr, wenn der zerebrale Perfusionsdruck (CPP) unter 60mmHg abfällt. Ein Anstieg des intrakraniellen Druckes kann vasogen, zytotoxisch oder interstitiell bedingt sein (zerebrales Ödem, gestörte Blut-Hirn- Schranke).<sup>12</sup> Ein intensives Neuromonitoring ist nötig, um möglichst früh sekundäre zerebrale Ischämien beim komatösen Patienten festzustellen. Die Messung des intrazerebralen Druckes kann intraventrikulär, intraparenchymal (fiberoptisch), subarachnoidal (Schraube, Katheter) oder subdural erfolgen. Allen Prozeduren gemeinsam ist die Gefahr der Blutung und der Infektion.<br /> Ob und wann die Dekompression bei einer Hirnblutung durch eine Kraniotomie erfolgen sollte, sei immer noch eine individuelle Entscheidung für ausgewählte Patienten in Studien, führte Oberarzt Christian Frug von der Neurochirurgie am Inselspital aus. Die Literatur sei bis dato nicht eindeutig. Das STITCH-Studienprogramm habe zu keinen Empfehlungen geführt.<sup>13</sup> Eine Dekompression bei Mediainfarkt werde zwar häufig gemacht, aber ohne Evidenz (MISITE surgical intervention). Auf «Notoperationen» für komatöse, sich rasch verschlechternde Patienten sollte man verzichten.</p> <h2>Gangstörungen als Biomarker?</h2> <p>In der Schweiz werden viele Demenzpatienten von Geriatern und Internisten betreut, zunehmend sind aber auch Neurologen eingebunden. Im Genfer Universitätsspital untersuchte Dr. med. Gilles Allali, ob die Untersuchung von Gangstörungen als differenzialdiagnostisches Kriterium bei Demenzen geeignet ist. Er entwickelte ein Protokoll zur Abklärung. Benutzt wird ein tragbares Gaitrite<sup>®</sup>- System. Die Patienten gehen auf einem Teppich auf und ab, Ganggeschwindigkeit, Schrittweite, -länge und deren Schwankungen werden gemessen sowie der Gangablauf, Fussstellung, Schwenkzeit und Schwankungen aufgezeichnet. Allali konnte zeigen, dass anhand unterschiedlicher Gangstörungen eine Differenzialdiagnose von Parkinson-Gangstörung versus frontobasale Demenz versus Normaldruckhydrozephalus versus Mimics möglich wird.<sup>14</sup></p> <h2>Frontotemporale Demenz</h2> <p>«Alle Ärzte, die verhaltensauffällige oder in ihrer Persönlichkeit stark veränderte Patienten vor sich haben, sollten an die Möglichkeit einer frontotemporalen Demenz als Ursache denken. Es dauert immer noch fünf bis sechs Jahre, bis diese Diagnose gestellt wird.» Darauf verwies Prof. Hans Förstl aus München in seinen Ausführungen zur frontotemporalen Demenz (FTD). Neurobiologisches Korrelat ist der Verlust einer Gruppe von besonderen Nervenzellen in der vorderen Inselrinde, die nach ihrem Entdecker Von-Economo- Neurone (VEN) oder aufgrund ihrer spindelartigen Zellkörper Spindelneurone genannt werden.<br /> Im Gegensatz zur Alzheimerdemenz zeichnet sich die FTD initial durch eine Veränderung von Verhalten und Persönlichkeit aus, während neuropsychologische Funktionen – mit Ausnahme der Aufmerksamkeits- und Exekutivfunktionen – längere Zeit erhalten bleiben.<sup>15</sup> Da die Krankheitseinsicht fehlt, sind Angehörige und Betreuer durch die fehlende Motivation der Patienten und das mangelnde Engagement in sozialen Beziehungen massiv überfordert. Einheitliche Therapiekonzepte gibt es aufgrund der Heterogenität der Erkrankungen nicht. Ein relativ neuer Ansatz ist die Gabe von Oxytocin. SSRI bessern die Impulskontrolle. Es werde wohl noch Jahrzehnte dauern, so Prof. Förstl, bis bessere Interventionen möglich werden.</p> <h2>Neuroimaging</h2> <p>PD Dr. med. Paul G. Unschuld ist Leiter der Forschungsgruppe Ageing Neuroscience and Neuroimaging an der Klinik für Alterspsychiatrie der Universität Zürich. Dort werden neue Diagnoseverfahren (Biomarker) und Medikamente wie Adacunumab im Zusammenhang mit der Alzheimerkrankheit untersucht. Die günstigen Effekte der Demenzfrühdiagnose liegen in der Chance, durch aktive Massnahmen den Verlauf positiv zu beeinflussen und die Zukunft zu planen.<br /> Zum jetzigen Zeitpunkt etablierte Biomarker sind in diesem Zusammenhang insbesondere die im Magnetresonanztomogramm (MRI) messbare Atrophie des gesamten Gehirns und des Hippocampus. Im Fluorodeoxyglukose-Positronen-Emissions- Tomogramm (FDG-PET) ist ein regionaler Hypometabolismus erkennbar. Die vermehrte Ablagerung von Beta-Amyloid im Gehirn ist mittels Amyloid-PET darstellbar. Die Liquorkonzentration von phosphoryliertem Tau-Protein ist erhöht, die von Amyloid-beta-42-Peptid (Ab42) erniedrigt.<sup>16</sup> Liegt eine bestimmte Konstellation der Biomarker der Alzheimerpathologie (auffälliges Amyloid-PET, tiefes Amyloid-beta-42-Peptid, erhöhtes phosphoryliertes Tau-Protein) vor, kann die Diagnose auch schon ohne das Vorliegen einer Demenz, also präsymptomatisch, gestellt werden. Ein Forschungsschwerpunkt liegt auch auf dem Eisenstoffwechsel im alternden Gehirn. Der Eisenverlust ist dank extrem verbesserter Bildgebung messbar und korreliert mit der Amyloidbeta- Plaquedichte.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Neuro_1706_Weblinks_lo_neuro_1706_s12_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="907" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Neuro_1706_Weblinks_lo_neuro_1706_s13_bild.jpg" alt="" width="1481" height="1328" /></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Jahrestagung 2017 der Schweizerischen Neurologischen
Gesellschaft. Gastgesellschaft: Schweizerische Gesellschaft
für Verhaltensneurologie, 28.–29. September
2017, Interlaken
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Luo Z et al.: Factors influencing the work passion of Chinese community health service workers: an investigation in five provinces. BMC Fam Pract 2014; 15: 77 <strong>2</strong> Kalia LV, Lang AE: Parkinson’s disease. Lancet 2015; 386(9996): 896-912 <strong>3</strong> Postuma RB, Montplaisir JY: Large-scale population screening for prodromal PD: a way forward becomes clear. Sleep Med 2016; 24: 148 <strong>4</strong> Chen H et al.: Olfaction and incident Parkinson disease in US white and black older adults. Neurology 2017; 89(14): 1441-7 <strong>5</strong> Borghammer P: How does Parkinson’s disease begin? Perspectives on neuroanatomical pathways, prions, and histology. Mov Disord 2017; doi: 10.1002/mds.27138 <strong>6</strong> Donadio V et al.: A new potential biomarker for dementia with Lewy bodies: skin nerve α-synuclein deposits. Neurology 2017; 89(4): 318-26 <strong>7</strong> Lee JM et al.: The search for a peripheral biopsy indicator of α-synuclein pathology for parkinson disease. J Neuropathol Exp Neurol 2017; 76(1): 2-15 <strong>8</strong> Arzneimittelkompendium <strong>9</strong> Montalban X et al.: Ocrelizumab versus placebo in primary progressive multiple sclerosis. N Engl J Med 2017; 376(3): 209-20 <strong>10</strong> Hauser SL et al.: Ocrelizumab versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2017; 376(3): 221-34 <strong>11</strong> Hauser SL et al.: Ocrelizumab in primary progressive and relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2017; 376(17): 1694 <strong>12</strong> Klatzo I: Pathophysiological aspects of brain edema. Acta Neuropathologica 1987; 72(3): 236-9 <strong>13</strong> Gregson BA et al.; STITCH(TRAUMA) investigators: Surgical Trial In Traumatic intraCerebral Haemorrhage (STITCH): a randomised controlled trial of early surgery compared with initial conservative Treatment. Health Technol Assess 2015; 19(70): 1-138 <strong>14</strong> Allali G, Verghese J: Management of gait changes and fall risk in MCI and dementia. Curr Treat Options Neurol 2017; 19(9): 29 <strong>15</strong> DC Perry et al.: Clinicopathological correlations in behavioural variant frontotemporal dementia. Brain 2017; doi:10.1093/brain/awx254 <strong>16</strong> Kulic L, Unschuld PG: Recent advances in cerebrospinal fluid biomarkers for the detection of preclinical Alzheimer’s disease. Curr Opin Neurol 2016; 29(6): 749-55 <strong>17</strong> Katan M et al.: Procalcitonin and midregional proatrial natriuretic peptide as biomarkers of subclinical cerebrovascular damage: the Northern Manhattan study. Stroke 2017; 48(3): 604-10</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?
Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...
Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung
Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...
Fachperson für neurophysiologische Diagnostik – Zukunftsperspektiven eines (noch) unterschätzten Berufes
Die Aufgaben der Fachperson für neurophysiologische Diagnostik (FND) haben sich in den letzten Jahren verändert. Dies geht zum einen mit den erweiterten Diagnostikmöglichkeiten und zum ...


