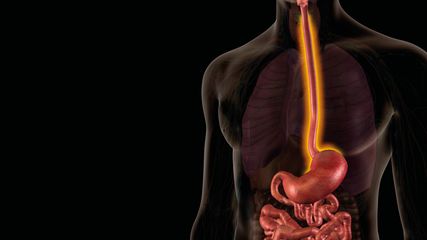.jpg)
©
Getty Images/iStockphoto
Langzeitfolgen von parenteraler Ernährung
Jatros
Autor:
Priv.-Doz. Dr. Gunda Millonig
Ordination für Gastroenterologie & innere Medizin<br> E-Mail: gunda.millonig@sanatorium-kettenbruecke.at<br> Web: www.magen-darm-leber.at
30
Min. Lesezeit
12.06.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Parenterale Ernährung bei vorübergehender Einschränkung der Nahrungsaufnahme ist heutzutage im klinischen Alltag Routine geworden. Nur wenige Patienten benötigen langfristig eine totale parenterale Ernährung (TPE), wenn Krankheiten des Verdauungstraktes eine enterale Ernährung unmöglich machen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Patienten, die über lange Zeit ­parenteral ernährt werden, sind permanent von einer Kathetersepsis bedroht. Steriles Arbeiten beim Beutelwechsel und eine ­adäquate Pflege des Kathetersystems sollten daher selbst­verständlich sein.</li> <li>Für eine optimale Betreuung von TPE-Patienten ist ein interdizi­plinäres professionelles Team notwendig, welches Zusammensetzung der Nahrung, Applikation und regelmäßiges Monitoring (klinisch, ­laborchemisch) ­koordiniert.</li> <li>Unter Langzeit-TPE ist ein regelmäßiges und strukturiertes Monitoring notwendig, um frühzeitige Korrekturen der TPE vorzunehmen zu können und Komplikationen zu verhindern bzw. frühzeitig zu erkennen.</li> </ul> </div> <p>Typische Krankheiten, die zur langfristigen totalen parenteralen Ernährung (TPE) führen, sind komplizierte Verläufe eines Morbus Crohn (MC) mit enterokutanen Fisteln oder therapierefraktärem chronisch-aktivem Verlauf und das Kurzdarmsyndrom nach extensiver Darmresektion (ebenfalls im Rahmen eines MC, durch Mesenterialischämie, bei Kindern nach einer nekrotisierenden Enterokolitis im Neugeborenenalter oder im Rahmen von anderen komplikativ verlaufenden Darmresektionen). Bei diesen Patienten ist eine besonders sorgfältige Überwachung notwendig, um Komplikationen zu verhindern bzw. erste Anzeichen von solchen rechtzeitig zu erkennen. Wesentliche Komplikationen bei langfristiger TPE betreffen Gefäßzugänge, die metabolische Dysbalance und die daraus folgenden Organschädigungen.<sup>1</sup></p> <h2>Katheter-assoziierte Komplikationen</h2> <p>Für eine Langzeit-TPE ist ein zentralvenöses Kathetersystem bzw. ein Portsystem für die Infusion notwendig. Eine der häufigsten Komplikationen im Rahmen einer TPE sind thrombotische und infektiöse Ereignisse. Aus einer Metaanalyse ist bekannt, dass 0,34 Episoden einer Kathetersepsis pro Katheter und Jahr zu erwarten sind (das bedeutet für einen Patienten mit TPE über 3 Jahre statistisch eine 100 % ige Wahrscheinlichkeit für eine Kathetersepsis).<sup>1, 2</sup> Die zweithäufigste Komplikation ist der thrombotische Katheterverschluss (0,071 Episoden pro Katheter und Jahr),<sup>1, 2</sup> am seltensten kommt es zu einer zentralvenösen Thrombose (0,027 Episoden pro Katheter und Jahr).<sup>1, 2</sup> Aus diesen Zahlen ergibt sich auch die notwendige Konsequenz: die sorgfältige Pflege des Kathetersystems unter strenger Einhaltung hygienischer Prinzipien. Prinzipiell ist für die langfristige TPE ein einlumiger Broviac-Katheter am günstigsten,<sup>3</sup> da hierbei eine laminare Strömung herrscht und er kein Reservoir wie die Portsysteme besitzt. Sollte ein Portsystem verwendet werden, ist ein Nadelwechsel alle 3–7 Tage empfohlen (im Gegensatz zur reinen Applikation von Medikamenten, wo ein 14-täglicher Nadelwechsel ausreicht). Zur Prophylaxe eines Katheterverschlusses wird die Spülung mit isotoner NaCl-Lösung (nicht Heparin) empfohlen. Ein antiseptischer Taurolidin-Block ist nach derzeitiger Datenlage nicht der Standard, kann aber bei Problempatienten erwogen werden.<sup>4, 5</sup></p> <p>Eine Selbstverständlichkeit sollte die Einweisung in steriles Arbeiten für alle am Beutelwechsel beteiligten Personen sein. Die Verwendung von Dreikammerbeuteln ist mit einer geringeren Infektionsrate im Vergleich zum früheren Zusammenmischen von Einzelnährstofflösungen assoziiert.<sup>5</sup></p> <h2>Mangelernährung und metabolische Dysbalancen</h2> <p>Grundsätzlich müssen bei einer langfristigen TPE der Energiebedarf und der Bedarf an einzelnen Nahrungsbestandteilen (Proteine, Kohlehydrate, Fette) ausreichend gedeckt werden, damit es nicht zu Unterernährung kommt. Damit die TPE-Menge an das aktuelle Gewicht (bzw. Zielgewicht), den Proteinbedarf, den Energiebedarf unter Berücksichtigung von körperlicher Betätigung oder Wachstum bei Kindern angepasst werden kann, sollte der Bedarf regelmäßig berechnet werden.<sup>5</sup> Hier helfen Kalkulatorprogramme wie z.B. der Online-Rechner unter www.globalrph.com/tpn.htm.</p> <p>Gerade bei langfristiger TPE ist eine strenge Kontrolle von Blutzuckerspiegel, Triglyzeriden und Elektrolyten essenziell, da es sonst rasch vor allem zu hepatischen Komplikationen kommt. Die übliche Glukosezufuhr sollte 2–4g/kg Körpergewicht nicht übersteigen. Hyperglykämien (Blutzucker >180mg/dl) sollten unbedingt verhindert werden. Hier helfen regelmäßige Blutzuckerkontrollen unter laufender Infusion und die Verwendung von Pumpen, die eine kontrollierte Infusionsrate erlauben. Blutfette (0,8–1,5g/kg Körpergewicht) sollten ebenfalls unter laufender Infusion kontrolliert werden. Der Triglyzeridwert sollte nicht über 265mg/dl liegen, sonst muss die Laufrate oder die Fettzufuhr reduziert werden.<sup>5</sup></p> <p>Die Elektrolyte sind regelmäßig zu kontrollieren, wobei im Allgemeinen die Zufuhr in den üblichen Dreikammerbeuteln unkompliziert ist, sofern sich der Patient hinsichtlich seiner Ernährung in einem stabilen Zustand befindet. Als Alternative kommt ein „individual compounding“ zum Einsatz, bei dem die Zusammensetzung der Mischbeutel an die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst wird. Dies ist z.B. bei Kurzdarmpatienten mit hohen intestinalen Elektrolytverlusten, bei Patienten mit gleichzeitiger dialysepflichtiger Niereninsuffizienz und Flüssigkeitsrestriktion oder mit Patienten mit schwerer Leberschädigung notwendig.</p> <p>Um Vitaminmangelzustände zu verhindern, ist die tägliche Zugabe einer Mischung aus fett- und wasserlöslichen Vitaminen sowie Spurenelementen wichtig. Hierbei ist zu bedenken, dass die meisten kommerziell erhältlichen Vitaminfertig­mischungen kein Vitamin K enthalten, sodass dieses monatlich zusätzlich verabreicht werden muss.</p> <p>Sehr gute und praxisnahe Leitlinien für die TPE und das Labor-Monitoring sind von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM)<sup>4, 5</sup> herausgegeben worden (abrufbar unter: <a href="http://www.dgem.de)">www.dgem.de)</a>.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Infekt_1802_Weblinks__s36.jpg" alt="" width="1458" height="1706" /></p> <h2>Organschädigungen</h2> <p><strong><strong>Gallenblase</strong></strong></p> <p>Auch unter Kontrolle aller oben genannten metabolischen Einzelparameter kann es bei Langzeit-TPE zu Organschädigungen kommen. Fast alle TPE-Patienten entwickeln Gallenblasen-Sludge/Gallensteine.<sup>6</sup> Hier wirkt eine zumindest teilweise orale Ernährung, die auch Fett enthält, prophylaktisch, da die Gallenblase sich dabei kontrahiert und entleert. Auch eine Gabe von Ursodeoxycholsäure kann erwogen werden.<sup>7</sup></p> <p><strong><strong>Leber</strong></strong></p> <p>Etwas seltener, dafür allerdings bedrohlicher sind Leberkomplikationen. Die mildeste Form ist ein vorübergehender Anstieg von Transaminasen nach Einführung der TPE. In ungünstiger verlaufenden Fällen kommt es zu einer progredienten Lebererkrankung bis hin zur Leberzirrhose und zum Leberversagen.<sup>8</sup> Während es bei Säuglingen am häufigsten zum cholestatischen Verlauf der TPE-assoziierten Lebererkrankung („parenteral nutrition-associated liver disease“, PNALD) kommt, sind bei Kindern und Erwachsenen in erster Linie steatohepatitische Verläufe dokumentiert. Die Genese der Erkrankung ist multifaktoriell: Die Zusammensetzung der TPE spielt eine Rolle, insbesondere zu viel Sojaöl, welches hohe Anteile an Omega-6-Fettsäuren sowie Phytosterole enthält, und ein Mangel an Cholin und antioxidativ wirkenden Substanzen (insbesondere Alpha-Tocopherol) scheinen relevant zu sein.<sup>9</sup> Daneben spielen bakterielle Infekte eine Rolle, und zwar sowohl systemisch durch die Gefahr einer Kathetersepsis als auch intestinal durch bakterielle Dünndarmüberwucherung. Auch ein verminderter Gallensäurepool und möglicherweise zu hohe Manganspiegel spielen eine Rolle. Als besonders empfindlich in Bezug auf eine PNALD gelten Neugeborene und Kleinkinder sowie Patienten, die überhaupt keine enterale Ernährung zu sich nehmen.<sup>10</sup> Bei größeren Kindern und Erwachsenen ist auch ein Überangebot an intravenösen Fetten und Glukose einer der Trigger für die Entwicklung einer PNALD.<sup>5</sup> Insgesamt ist der wichtigste Faktor zur Verhinderung einer irreversiblen Leberschädigung unter TPE die Wachsamkeit bezüglich steigender Leberwerte mit Anpassung der TPE-Zusammensetzung, konsequenter antibiotischer Therapie intestinal und/oder systemisch und der Gabe von Ursodeoxycholsäure (ein gutes Review zur PNALD geben Buchman et al. 2006<sup>11</sup>). Als Vorbeugung ist eine Maximierung der enteralen Ernährung notwendig. Hier sollte eine operative Wiederherstellung der intestinalen Kontinuität geplant bzw. nach Ausschluss von Kontraindikationen die Gabe von GLP-2-Analoga erwogen werden.<sup>12, 13</sup> Bei Progression der Leberschädigung ist rechtzeitig eine Dünndarmtransplantation zu erwägen. Als Ulti­ma Ratio – allerdings verbunden mit hoher Mortalität – ist eine kombinierte Dünndarm-Leber-Transplantation möglich.<sup>7</sup></p> <p><strong><strong>Knochen</strong></strong></p> <p>Patienten unter TPE haben ein deutlich erhöhtes Risiko für Osteomalazie und Osteoporose (>40 % der TPE-Patienten haben eine Osteoporose).<sup>14</sup> Dies ist vermutlich Ausdruck eines nicht optimalen Kalzium-Phosphat-Vitamin-D-Stoffwechsels kombiniert mit geringer körperlicher Betätigung. Hier sind eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung sowie die Knochendichtemessung und anschließend Therapie entsprechend den Osteoporoseleitlinien indiziert.<sup>4, 5</sup></p> <h2>Kosten</h2> <p>Eine Langzeit-TPE ist nicht nur komplikationsträchtig, sondern auch kostenintensiv. Rezente Daten aus Belgien zeigen, dass im Langzeitverlauf der Kostenfaktor der TPE den Kostenfaktor der zugrunde liegenden Erkrankung der Patienten bei Weitem übersteigt (Abb.).<sup>15</sup> Neben den gesundheitlich relevanten Gründen für die Optimierung einer enteralen Ernährung sollten auch die Kosten einer Langzeit-TPE im Auge behalten werden.</p> <h2>Fazit</h2> <p>Die Langzeit-TPE ermöglicht vielen Patienten mit intestinalem Versagen ein Überleben. Gleichzeitig sind multiple Komplikationen unter TPE möglich. Am wichtigsten sind daher zwei Dinge:</p> <p>1. die Versorgung durch ein professionelles interdisziplinäres Netzwerk, mit dem Ziel, den Ernährungszustand des Patienten zu optimieren und nutritive wie vaskuläre/septische Komplikationen zu vermeiden.</p> <p>2. jede Möglichkeit der Förderung einer enteralen Ernährung zur Verminderung von hepatischen Komplikationen der TPE. Hier sollte bei vorhandenem Colon unbedingt eine operative Wiederherstellung der intestinalen Kontinuität angestrebt werden. Außerdem sollten medikamentöse Möglichkeiten (GLP-2-Analoga) und als Ultima Ratio eine Dünndarmtransplantation erwogen werden.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Howard L, Ashley C: Gastroenterol 2003; 124: 1651-61 <strong>2</strong> Richards DM et al.: Health Technol Assess 1997; 1(1): i-iii, 1-59 <strong>3</strong> Santarpia L et al.: Clin Nutr 2002; 21(3): 207-11 <strong>4</strong> Lamprecht G et al.: S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. in Zusammenarbeit mit der AKE, der GESKES und der DGVS. Klinische Ernährung in der Gastroenterologie (Teil 3) – chronisches Darmversagen. Aktuel Ernährungsmed 2014; 39: e57-e71 <strong>5</strong> Bischoff SC et al.: S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) in Zusammenarbeit mit der GESKES und der AKE. Künstliche Ernährung im ambulanten Bereich. Aktuel Ernährungsmed 2013; 38: e101-e154 <strong>6</strong> Manji N et al.: J Parenter Enteral Nutr 1989; 13(5): 461-4 <strong>7 </strong>Payne-James J et al.: Artificial Nutrition and Support in Clinical Practice. Zweite Auflage 2012. 818 Seiten. Cambridge University Press. ISBN: 97811076096555 <strong>8 </strong>Mitra A, Ahn J: Liver disease in patients on total parenteral nutrition. Clin Liver Dis 2017; 21(4): 687-95 <strong>9 </strong>Nandivada P et al.: Treatment of parenteral nutrition-associated liver disease: the role of lipid emulsions. Adv Nutr 2013; 4(6): 711-7 <strong>10 </strong>Orso G et al.: Pediatric parenteral nutrition-associated liver disease and cholestasis: novel advances in pathomechanisms-based prevention and treatment. Dig Liver Dis 2016; 48(3): 215-22 <strong>11</strong> Buchman AL: Hepatology 2006; 43: 9-19 <strong>12</strong> Jeppesen PB et al.: Gut 2005; 54(9): 1224-31 <strong>13</strong> Jeppesen PB et al.: Gut 2011; 60(7): 902-14 <strong>14</strong> Cohen-Solal M et al.: J Bone Miner Res 2003; 18: 1989-94 <strong>15</strong> Canovai E et al.: Transplantation 2017; 101: s6-2</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieoption für die eosinophile Ösophagitis
Am Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Gastroenterologie (SGG) in Interlaken stellte Prof. Dr. med. Luc Biedermann, Leitender Arzt an der Klinik für Gastroenterologie und ...
Nobelpreisträger hält Keynote-Rede
1984 zeigten Barry Marshall und Robin Warren in einer bahnbrechenden Publikation in The Lancet, dass sich bei fast allen Patient:innen mit Gastritis, Magen- oder Duodenalulkus ein ...
Update im therapeutischen Management der Helicobacter-pylori-Infektion
Die H.-pylori-Infektion ist entscheidender Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Magenkarzinoms. Diese Entwicklung kann durch eine frühzeitige Eradikation von H.pylori verhindert ...