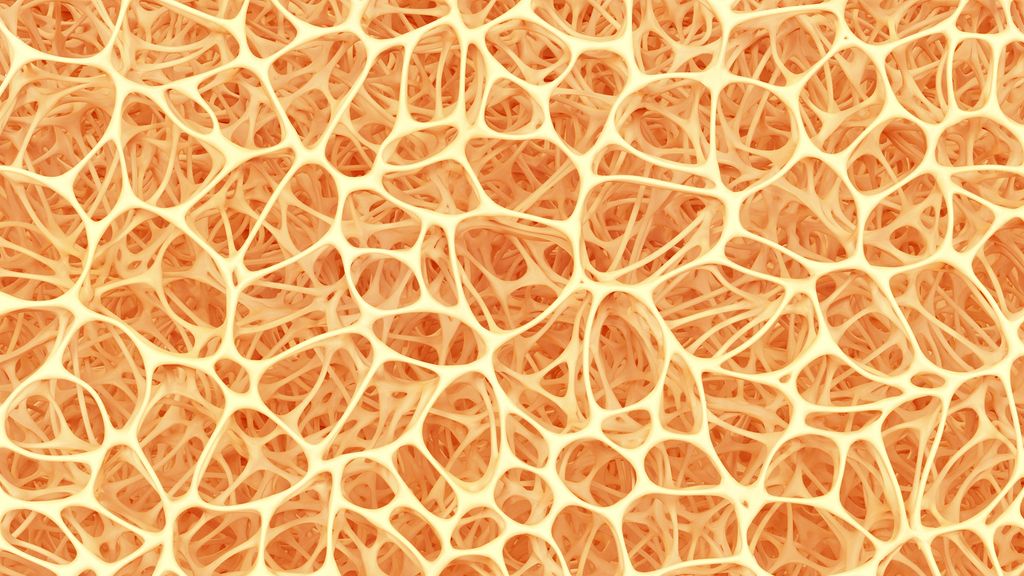
©
Getty Images/iStockphoto
Der Fehlschlag in der Knorpeltherapie: Ursachenanalyse und Behandlung
Jatros
Autor:
Prof. Dr. Stefan Nehrer
Zentrum für Regenerative Medizin und Orthopädie, Donau-Universität Krems<br> E-Mail: stefan.nehrer@donau-uni.ac.at
30
Min. Lesezeit
23.02.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Behandlung von Knorpeldefekten hat in den letzten 20 Jahren mit der Entwicklung der Mikrofrakturierung, der osteochondralen Transplantation und der autologen Knorpelzelltransplantation sowie mit neueren Verfahren, die mit Biomaterialien, Stammzellen und Knochenmarkaspiratkonzentrat arbeiten, große Fortschritte gemacht. Trotzdem zeigt die Analyse von Studien, dass 20–30 % dieser Knorpeloperationen nicht funktionieren und zu einem klinischen Versagen führen. Wichtig erscheint, eine Analyse des Fehlschlages durchzuführen und dann entsprechende Revisionsmöglichkeiten zu planen, die zu einer langfristigen Erhaltung des Gelenkes führen. </p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Der Knorpeldefekt</h2> <p>Knorpeldefekte kommen in bis zu 60 % der arthroskopierten Kniegelenke vor, wobei in 20 % Defekte 3. und 4. Grades gesehen werden, die aber nicht immer symptomatisch sind, sodass Prognose und Planung der Therapie problematisch sein können. Der chronische symptomatische Knorpeldefekt ist die Diagnose, die den Patienten zum Arzt führt und einer genauen Analyse der Hintergrundfaktoren bedarf. Prinzipiell können Knorpeldefekte traumatisch oder chronisch-degenerativ verursacht sein oder auch – wie bei der Osteochondrosis dissecans – einen vaskulären Hintergrund haben. Um eine therapeutische Entscheidung zu treffen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen, die mit einer erhöhten Fehlschlagsquote im Bereich der Knorpeltherapie verbunden sind.</p> <p><strong>Alter</strong><br /> Mit zunehmender Alterung des Knorpels ist eine Verminderung des Wassergehaltes wie auch eine Ausdünnung vorhanden, wobei knorpelspezifische Proteine mit verminderten Syntheseleistungen der Chondrozyten hergestellt werden, was auch mit einer verminderten Stimulierung der regenerativen Vorgänge verbunden ist. Weiters ändern biochemische und biologische Funktionen von Wachstumsfaktoren oder Zytokinen das Milieu des alternden Knorpels, sodass eine verminderte Belastbarkeit des Knorpels vorliegt. Bei den vorliegenden Studien zur Knorpelzelltransplantation zeigt sich eindeutig eine Verschlechterung der Prognose ab dem 35. Lebensjahr.</p> <p><strong>Gewicht</strong><br /> Die Erhöhung des Body-Mass-Index über 30 ist in vielen Studien mit einer Verschlechterung des funktionellen Outcomes verbunden. Bei höherem Gewicht wirken höhere Kräfte im Alltag ein. Gemäßigte physische Aktivität und eine Verbesserung des muskulären Trainingszustandes können aber das Outcome in jeder Gewichtsklasse verbessern.</p> <p><strong>Aktivitätslevel</strong> <br />Nachuntersuchungen nach Knorpelzelltransplantationen haben gezeigt, dass die körperlich aktiveren Gruppen ein deutlich verbessertes Outcome bei Knorpeloperationen zeigen. Dies ist wahrscheinlich mit einer besseren Muskelstabilisierung und Koordinationsfähigkeit z.B. bei Sportlern verbunden. Besonders hochfrequente Trainingsinhalte mit hohen Impactbelastungen können aber dem Knorpel durchaus zusetzen. Zyklische Sportarten mit wechselnder Belastungscharakteristik im Umfang von 5–6 Wochenstunden sind jedoch mit keiner erhöhten Arthroseinzidenz verbunden.</p> <p><strong>Entzündung</strong><br />Inflammatorische Prozesse, Reizzustände des Gelenkes oder Entzündungsreaktionen, wie sie bei rheumatoiden Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen vorkommen, verschlechtern immer die Prognose von Knorpelbehandlungen. Weiters ist auch die inflammatorische Komponente bei einer Osteoarthritis limitierender Faktor für jegliche Zellbehandlung. Höhergradige degenerative Erkrankungen sind daher von solchen Behandlungen ausgeschlossen.</p> <p><strong>Rauchen</strong><br />Rauchen hat in vielerlei Hinsicht einen negativen Einfluss auf orthopädisch-traumatologische Erkrankungen, z.B. auf die Knochenheilung nach Osteotomien. Für den Knorpel gilt, dass Rauchen knorpelregenerative Vorgänge und Prozesse verhindert oder schwächt.</p> <h2>Gelenkspezifische Faktoren</h2> <p><strong>Gelenkachse</strong><br />Die biomechanische Einwirkung auf Knorpelläsionen bei Abweichungen von der physiologischen Gelenkachse ist mit Überlastungsreaktionen und deutlich vermehrter Progression von Knorpeldefekten auf der überlasteten Seite verbunden. Die Durchführung eines Ganzbeinröntgens zur Analyse der Achsverhältnisse des Gelenkes ist daher insbesondere beim Kniegelenk für eine Knorpeltherapie unerlässlich. Knorpeltherapeutische Maßnahmen bei einer Achsabweichung von mehr als 5° sind kontraindiziert und sollten nicht isoliert durchgeführt werden. Hier ist eine Beratung des Patienten angezeigt und die dringende Indikation zur gleichzeitigen Umstellungsosteotomie gegeben. Insgesamt werden diese Kombinationseingriffe bei operativer Knorpeltherapie zunehmend empfohlen und sind wichtiger Bestandteil in der Behandlung von Knorpeldefekten geworden.</p> <p><strong>Meniskusverletzungen</strong> <br />Verlust von Meniskusgewebe oder Meniskusrisse sind mit einer deutlich erhöhten Inzidenz degenerativer Knorpelabnützungen verbunden. Besonders wenn mehr als 50 % des Meniskus reseziert werden müssen oder radiäre Risse bis an die Basis auftreten, ist die Funktionalität des Meniskus praktisch außer Kraft gesetzt. Dies führt zur Induktion von knorpeldegenerativen Prozessen und beeinflusst die Heilung von lokalen Knorpeldefekten signifikant. So konnte auch gezeigt werden, dass sich Kontaktkräfte bei Verlust von 75 % des Meniskus über 95 % erhöhen; eine komplette Meniskektomie führt zu einer über 130 % igen Erhöhung der einwirkenden Kräfte. Daher ist bei einem kompletten Meniskusverlust abzuwägen, ob nicht ein Meniskusersatz mit einem Allograft als erste Maßnahme zielführender ist als die Knorpelbehandlung und am besten ein kombiniertes Vorgehen angestrebt wird.</p> <p><strong>Instabilität</strong><br />Da Knorpelverletzungen auch oft auch mit Bandinstabilitäten nach Kreuzbandläsion – besonders vorderer Kreuzbandruptur – verbunden sind, stellt sich therapeutisch oft das Problem der gemeinsamen Behandlung beider Pathologien. Bei einer bestehenden Instabilität mit „Giving way“-Symptomen ist eine isolierte Knorpelbehandlung nicht zielführend, sondern es ist auch hier ein kombiniertes Vorgehen anzuraten. Bei kleinen Defekten kann das gleichzeitig mit einer Mikrofrakturierung gemacht werden, größere Defekte sollten getrennt behandelt werden. Kombinationseingriffe mit Kreuzbandplastik und Zelltransplantation überfordern leider oft das Knie, eine erhöhte Arthrofibroseinzidenz wird diskutiert. Auf jeden Fall erscheint die Stabilisierung des Kniegelenkes vorrangig und erst dann ist die Revision des Knorpeldefektes entsprechend zu planen.</p> <p><strong>Gelenkdysplasien</strong> <br /> Beim Auftreten von Gelenkdysplasien steht sicher die biomechanische Rekonstruktion des Gelenkes im Vordergrund, besonders stellt sich das Problem bei patellofemoralen Pathologien. Hier ist die Fehlform im Bereich des patellofemoralen Gelenkes zunächst anatomisch ja nach Ausprägung der Dysplasie zu beheben, z.B. durch Versetzung der Tuberositas oder Durchführung einer Trochlea- oder MPFL-Plastik, vor allem, wenn die Dysplasie mit einer rezidivierenden Patellaluxation verbunden ist. Die Ergebnisse der Knorpeloperationen haben sich nach konsequenter Durchführung dieser kombinierten Eingriffe deutlich verbessert. Eine Revision eines patellofemoralen Knorpeldefekts, ohne diese Faktoren zu adressieren, ist sicher nicht sinnvoll.</p> <p><strong>Gelenkdegeneration</strong><br />Einer der wichtigsten gelenkspezifischen Faktoren im Bereich der Knorpeldefektbehandlung ist sicher das Auftreten von allgemeinen degenerativen Erkrankungen, wie der Osteoarthrose. Umschriebene Arthroseareale können – wenn sie deutlich abgrenzbar sind – durchaus noch mit Defektbehandlungen, wie einer Zelltransplantation, erfolgreich behandelt werden. Ist es aber bereits zu einer generalisierten Osteoarthritis mit Reizzustand und entsprechender Zytokinaktivierung gekommen, verschlechtert sich die Prognose von regenerativen Maßnahmen deutlich.</p> <h2>Defektspezifische Faktoren</h2> <p><strong>Vorhergegangene Chirurgie</strong><br /> Jede operative Vorbehandlung eines Knorpeldefektes verschlechtert die Prognose der nachfolgenden Behandlung; dies gilt auch für die Mikrofrakturierung. Leider werden oft auch große Defekte initial mikrofrakturiert, obwohl die Hoffnung auf ein langfristiges gutes Ergebnis bei einer Defektgröße von über 4cm² gering ist, weil das sich bildende fibrokartilaginäre Gewebe nicht in der Lage ist, langfristig biomechanisch zu überleben. Weiters führen die Ausbildung von intrakartilaginären Osteophyten sowie Zystenbildung und Störung der subchondralen Architektur nach der Mikrofrakturierung zu einer verkürzten Überlebenszeit des Reparaturgewebes. Daher erscheint es sinnvoll, große Knorpeldefekte gleich initial einer Zelltransplantation zuzu­führen.</p> <p><strong>Umschriebener Knorpeldefekt</strong><br />Ein gut überschulterter Knorpeldefekt mit deutlichen Grenzen und normalem angrenzendem Knorpel hat eine deutlich bessere Prognose als Knorpeldefekte, die nicht umschrieben sind und ausgewalzte Ränder haben oder offen sind. Vor allem wenn es nicht mehr gelingt, einen entsprechenden Rand des Knorpeldefektes zu präparieren, ist die Überlebenschance des regenerierten Gewebes deutlich vermindert.</p> <p><strong>Subchondraler Knochen</strong> <br /> Das Auftreten von subchondralen Veränderungen, wie Zysten, Osteonekrosen oder ausgeprägten Sklerosen mit Verdickung der subchondralen Lamelle, ist ebenfalls ein prognostisch ungünstiges Zeichen und erlaubt keine erfolgreiche Knorpelbehandlung. Die Wiederherstellung eines intakten subchondralen funktionalen Knochens erscheint als wichtige Voraussetzung, um das neu gebildete Gewebe zu verankern. Daher muss bei rekonstruktiven Methoden eine Transplantation von Knochen aus dem Beckenkamm durchgeführt werden, um hier eine gesunde Basis für die Knorpelregeneration herzustellen.</p> <p><strong>Defektgröße</strong> <br /> Bei Defektgrößen unter 2cm², die eine gute Überschulterung haben und sehr gut abgegrenzt werden können, besteht eine sehr gute Prognose für ein langfristig gutes Ergebnis. Defekte, die größer sind, bedürfen anderer Maßnahmen, da hier tangentiale Kräfte auf das Reparaturgewebe einwirken und oft keine komplette Füllung des Defektes mit Gewebe mehr erreicht werden kann.</p> <p><strong>Lokalisation des Defektes</strong><br /> Die Behandlung von Knorpeldefekten am medialen und lateralen Femurkondylus ist in klinischen Studien sehr gut abgesichert, es handelt sich dabei sicher um die am meisten Erfolg versprechende Lokalisation. Die Behandlung von patellofemoralen Defekten wurde immer sehr kritisch gesehen und hat langfristig keine sehr guten Ergebnisse gezeigt. Erst durch die Einführung von Kombinationseingriffen, die das Gleitlager und die Funktionalität des patellofemoralen Gelenkes wiederherstellen, wurde die Prognose deutlich verbessert. In klinischen Studien wird angegeben, dass über 50 % der patellofemoralen Knorpeldefekte mit entsprechenden Kombinationseingriffen behandelt wurden.</p> <p><strong>Anzahl der Defekte</strong> <br />Die Anzahl der Defekte zeigt in vielen klinischen Studien einen Zusammenhang mit dem klinischen Outcome, wobei vor allem Defekte, die einander gegenüberliegen, sogenannte „kissing lesions“, nicht Erfolg versprechend in der Behandlung sind. Am besten sind isolierte, umschriebene Defekte in den Gelenken zu behandeln.</p> <p><strong>Alter der Defekte</strong> <br /> Da Knorpel keine nervale Versorgung besitzt, können Knorpeldefekte sehr lange asymptomatisch im Gelenk bestehen. Daher ist es nicht immer möglich, das exakte Alter des Defektes anamnestisch zu erheben. Bei traumatischen Knorpeldefekten zeigt sich, dass eine Behandlung innerhalb von 12 Monaten zu einem deutlich besseren Ergebnis führt, als wenn länger zugewartet wird. Je länger ein Defekt besteht, desto mehr kommt es auch zu sekundären Veränderungen im Bereich der subchondralen Lamelle und im angrenzenden Knorpel, sodass unmittelbar bei Diagnose eines Knorpeldefektes mit dem Patienten ein konkreter Behandlungsplan erstellt werden soll.</p> <h2>Fehlschläge der Knorpelreparatur mit biologischer Ursache</h2> <p>Knorpeldefekte können nach erfolgter Behandlung – z.B. mit Mikrofrakturierung oder Knorpelzelltransplantation – unterschiedliche Muster in der Pathomorphologie des Fehlschlages zeigen.</p> <p><strong>Inadäquates Reparaturgewebe</strong><br /> Die Ausprägung eines fibrösen oder fibrokartilaginären Gewebes ist biomechanisch nicht adäquat, um langfristig einen Knorpeldefekt zu heilen. Das narbenartige Gewebe wird meist zerrieben und führt zu einer inadäquaten Deckung des Defektes mit Zunahme der Symp­tome.</p> <p><strong>Inadäquate Füllung</strong> <br /> Speziell nach Methoden wie Mikrofrakturierung zeigt sich, dass die Füllung des Defektes nicht immer vollständig gelingt, was in vielen Fällen auch mit einer geringeren klinischen Performance dieses Defektes verbunden ist.</p> <p><strong>Inadäquate Integration des Reparaturgewebes</strong><br />Die Anbindung des Reparaturgewebes an den umgebenden Knorpel ist ganz entscheidend für die langfristige klinische Entwicklung des Knorpeldefektes. Hier werden mit Methoden der Zelltransplantation die besten Ergebnisse erzielt, da das Gewebe direkt angrenzend an das gesunde Gewebe regeneriert und hier meist einen fließenden Übergang aufbauen kann.</p> <p><strong>Veränderung der subchondralen Lamelle</strong><br /> Besonders durch die Mikrofrakturierung kommt es durch vermehrte Knochenbildung zur Elevation der subchondralen Lamelle und Ausprägung von interkartilaginären Osteophyten. Dies führt zur Ausdünnung der darüber liegenden Gewebeschicht, die dann biomechanisch gestresst ist und in der Folge auch rasch degeneriert. Im Weiteren können sich subchondral auch Zysten ausbilden. Subchondrale Veränderungen sind allgemein meist in Form von partiellen Knochenödemen und Knochennekrosen im MRT zu sehen. Das Vorhandensein von subchondralen Ödemen bis zu 1–2 Jahre nach Knorpeloperationen kann durchaus normal sein und ist oft nicht mit Schmerzen oder anderen Symptomen verbunden.</p> <p><strong>Degenerationsprogression</strong> <br /> Als letzter Punkt ist sicher das Gelenk als Organ zu betrachten. Kommt es zu inflammatorischen Reaktionen, die nicht wieder gestoppt werden können, und zu zunehmender Degeneration, die diese Inflammation unterhält, wird die Progression der degenerativen Erkrankung auch durch eine adäquate Knorpeltherapie nicht zu stoppen sein. Eine bestehende höhergradige Arthrose gilt noch immer als Kontraindikation für knorpelplastische Maßnahmen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1701_Weblinks_s56.jpg" alt="" width="2480" height="3508" /></p> <h2>Beurteilung des Fehlschlages der Knorpelbehandlung</h2> <p>Der Verlauf von Knorpeldefekten und die Ausbildung von Reparaturgewebe sind im MR oft schwierig beurteilbar und können erst 1–2 Jahre nach der Operation definitiv beurteilt werden. Problematisch erscheint, dass morphologisch nicht gut geheilte Knorpeldefekte durchaus ein gutes klinisches Ergebnis zeigen können und auch umgekehrt sehr schöne MRT-Befunde nicht immer mit Symptomfreiheit des Patienten verbunden sind. So können wir einerseits feststellen, dass es einen strukturellen Fehlschlag gibt, wo sich im MR oder bei einer Kontrollarthroskopie zeigt, dass sich inadäquates Gewebe gebildet hat, aber der Patient trotzdem schmerzfrei ist. Andererseits können sich chronische Symptome einschleichen und vor allem Belastungsschmerzen, die auch nicht immer mit dem morphologischen Substrat des MRT-Ergebnisses nach Zelltransplantation oder anderen knorpelplastischen Operationsmaßnahmen übereinstimmen.<br />Im Falle eines symptomatischen Fehlschlages ist mit dem Patienten zu diskutieren, wie weiter vorzugehen ist und welche prognostischen Faktoren er zu erwarten hat. Wichtig erscheint, die Compliance des Patienten abzuschätzen, da knorpelplastische Maßnahmen immer eine lange Rehabilitation nach sich ziehen, die einen sehr disziplinierten Belastungsaufbau verlangt und damit auch einen sehr disziplinierten Patienten voraussetzt. Wenn das Verständnis des Pa­tienten für die durchgeführte Methode nicht gegeben ist, erscheint der Fehlschlag oft schon mitprogrammiert. Bei höherem Alter und fortgeschrittener degenerativer Erkrankung ist die Option von partiellen oder fokalen Gelenkersätzen in Erwägung zu ziehen, da sie mit deutlich geringeren Rehabilitationszeiten verbunden sind und oft als Bridging-Operation bis zum totalen Gelenkersatz durchgeführt werden können. <br />Eine Mikrofrakturierung bei einem Alter über 40 Jahre, eine Defektgröße über 2cm² sowie jegliche Art von Instabilität oder Malalignment sind mit einer deutlich schlechteren Prognose verbunden. Eine mehrfache Durchführung von Mikrofrakturierung erscheint nicht sinnvoll, da die subchondrale Lamelle nachhaltig verändert wird und auch langfristig die Brücken für andere Methoden verbrannt werden. <br />Die Mosaikplastik kann als Revisionsoperation bei umschriebenen Knorpeldefekten durchaus eingesetzt werden, wenn es subchondral zu Veränderungen gekommen ist, aber der Defekt nicht größer als 2cm² ist, da ja eigenständiger gesunder Knorpel verpflanzt wird und gleichzeitig der subchondrale Knochendefekt adressiert werden kann. Insgesamt erscheint aber die Transplantation von mehr als 2 bis maximal 3 Zylindern in einer Größe von 6–8mm Durchmesser nicht sinnvoll.<br />Ob die Einsetzung von artifiziellen mosaikplastikartigen Zylindern aus Biomaterial sinnvoll ist, kann derzeit noch nicht beantwortet werden. Zudem ist es auch derzeit nicht absehbar, ob eine Wiederholung der Mikrofrakturierung mit Biomaterial (die sogenannte AMIC-Methode) die Prognose der Revisionsmikrofrakturierung verbessert. Insgesamt gibt es Hinweise darauf, dass die Füllung des Defektes durch solche Biomaterialien unterstützt werden kann. <br />Die autologe Chondrozytentransplantation kann gegebenenfalls wiederholt werden. Die Fehlschläge der Chondrozytentransplantation passieren meist innerhalb der ersten 2 Jahre, wobei danach bei erfolgreicher Knorpelregeneration die klinischen Ergebnisse stabil bleiben. Durchschnittlich kommt es bei ungefähr 25 % zu einem Fehlschlag der Methode. Ob eine Rechondrozytentransplantation sinnvoll ist, hängt davon ab, ob das osteochondrale Bett die entsprechenden Voraussetzungen – besonders hinsichtlich der Knochenqualität – bringt. Unter Umständen muss der Knochen neu aufgebaut werden; dies gelingt meist durch Verpflanzung von Knochenzylindern aus dem Beckenkamm oder auch durch Einbringen eines trikortikalen Knochenspa­nes aus dem Beckenkamm, um die subchondrale Lamelle wiederherzustellen. Ohne eine solche Knochenrekonstruktion ist eine Wiederholung der Zelltransplantation nicht sinnvoll. <br />Bei Patienten unter 40 Jahren erscheint eine Revision mit derselben Methode durchaus richtig, vor allem wenn es aufgrund von traumatischen Verletzungen zu einem Abscheren oder zur Delamination des Grafts gekommen ist. Kommt es langfristig frühzeitig über 3–4 Jahre zur Degeneration des Areals, ist eine Revision mit derselben Methode nicht sinnvoll. In so einem Fall sind bei einer lokal umschriebenen Arthrose partielle Gelenkersätze, vor allem bei einem Alter ab 50 Jahren, anzudenken, da sie meistens noch eine sehr gute Funktionalität erlauben und den totalen Gelenkersatz hinauszögern. <br />Abschließend erscheint es wichtig, die Gelenkachsen, den Meniskuszustand und die Kreuzbandstabilität bei jedem Gelenk individuell abzuschätzen und unbedingt entsprechende Begleitoperationen durchzuführen, da die Biomechanik der übergeordnete Parameter ist, der den Erfolg solcher Zelltransplantationen beeinflusst. Die Kenntnis der Hintergrundfaktoren und eine genaue Analyse der Gelenksituation sind Voraussetzung für eine erfolgreiche operative Knorpelbehandlung und vor allem beim Fehlschlag eine unverzichtbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Revision.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»
Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...
Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk
Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...
Patellofemorale Instabilität
In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.


