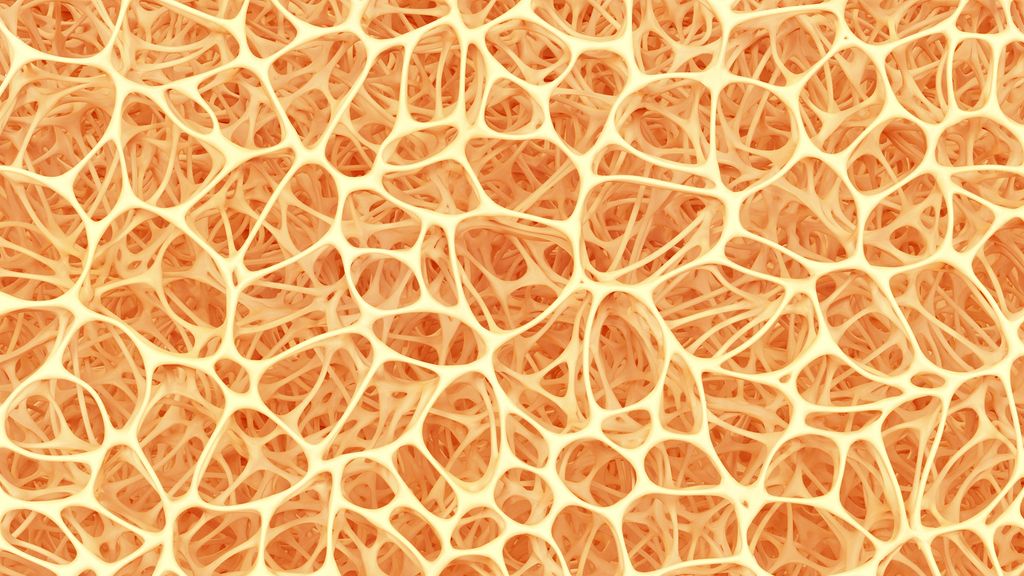
©
Getty Images/iStockphoto
Die chirurgische Behandlung der Ellbogenarthrose
Leading Opinions
Autor:
PD Dr. med. Patrick Vavken
alphaclinic Zürich<br> ADUS Klinik, Dielsdorf<br> Harvard Medical School, Boston (USA)<br> E-Mail: vavken@alphaclinic.ch
30
Min. Lesezeit
26.09.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Arthrose des Ellbogens grenzt sich in wichtigen Punkten von der Arthrose anderer Gelenke ab, speziell was die Progression der Erkrankung betrifft. So entstehen bei der Ellbogenarthrose schon früher Osteophyten, die die endgradige Bewegung schmerzhaft blockieren, während die Knorpelschicht lange erhalten bleibt und eine verhältnismässig normale «Mid-range»-Funktion ermöglicht. Das ist der Grund, warum die typischen konservativen Behandlungsoptionen, die auf die «Mid-range»-Funktion abzielen, nicht greifen, aber die Arthrolyse und die Osteochondroplastik sehr gute Ergebnisse zeigen. Die Endoprothetik des Ellbogens sollte ausser für «Low demand»-Patienten als «salvage procedure» angesehen werden.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Ellbogenarthrose äussert sich klinisch als eine schmerzarme bis schmerzfreie endgradige Bewegungseinschränkung mit einer meist recht guten «Mid-range»- Funktion und radiologisch als osteophytäre Anbauten mit lange gut erhaltenem Knorpel.</li> <li>Seit der Entwicklung der rheumatologischen Biologika ist die rheumatische Arthrose des Ellbogens in der chirurgischen Praxis selten geworden, primäre und posttraumatische Arthrosen nehmen aber etwas an Häufigkeit zu.</li> <li>Die Ellbogenarthrose ist eine progressive Erkrankung, die eigentlich nur durch eine Prothese definitiv gestoppt werden kann.</li> <li>Die Ellbogenprothese ist trotz aller technischen Fortschritte als «salvage procedure» anzusehen und es empfiehlt sich, diese so lange wie möglich zu verzögern, speziell bei jungen Patienten (< 50 Jahren), Männern, bei Infekt oder Traumaanamnese und multiplen Voroperationen.</li> <li>Die arthroskopische Arthrolyse und Osteochondroplastik entwickeln sich zu den wertvollsten Therapieoptionen bei erhaltenem Knorpel. Bei hälftigem Knorpelverlust gibt es verschiedene andere Therapieoptionen, aber fast alle mit möglichen sekundären Problemen.</li> </ul> </div> <h2>Die Arthrose des Ellbogens ist anders als in Hüfte und Knie</h2> <p>Wie bei vielen Dingen tanzt der Ellbogen auch gerne bei der Arthrose aus der Reihe. Die Ursachen sind zwar ähnlich wie bei den weitaus häufigeren Arthrosen von Knie und Hüfte, aber der Krankheitsverlauf ist deutlich anders, mit wichtigen Auswirkungen auf Klinik, Diagnose und Behandlung. Denn der Ellbogen neigt in der Arthrose zu einer sehr frühen und recht starken Osteophytenbildung, was zu einer zunehmenden Bewegungseinschränkung führt, während der Knorpel relativ lange erhalten bleibt (Abb. 1). Das führt zu schmerzhaftem Einklemmen bei maximaler Streckung und Beugung bei gleichzeitig guter Funktion in der «mid-range» ohne Ruheschmerz. Erst bei fortgeschrittener Ellbogenarthrose ist der Knorpel so weit degeneriert, dass es zu Schmerzen im gesamten Bewegungsumfang kommt. Ruheschmerz und frühzeitiger Schmerz in der ganzen Bewegung können auch auf eine rheumatische Arthritis des Ellbogens hindeuten, aber seit Einführung der Biologika sind diese ursprünglich häufigen Beschwerden nur noch selten in orthopädischen/ ellbogenchirurgischen Praxen zu sehen. <br />Diese Umstände haben einige wichtige Implikationen. Der mangelnde Schmerz in der Mitte der Bewegung führt dazu, dass die Ellbogenarthrose oft übersehen oder als Impingement oder dergleichen interpretiert wird. Der Schmerz in der Mitte der Bewegung, der eben bei der Ellbogenarthrose nicht vorkommt, ist auch im Fokus vieler gängiger konservativer Arthrosebehandlungen wie z. B. Hyaluronsäure. Es ist daher wenig verwunderlich, dass diese bei der Ellbogenarthrose nicht anschlagen. Zuletzt hat auch der epidemiologische Wechsel von rheumatoider Arthritis zu posttraumatischer Arthrose wichtige Folgen. So ist die gesamte Ellbogenprothetik aus der Rheumabehandlung entstanden und zielt auf typische «Low demand»-Populationen ab, die die postoperative Limite von 5 kg Belastungsgrenze tolerieren und einhalten können. Bei den typischerweise jüngeren und aktiveren Patienten mit posttraumatischer Arthrose kommt es meist recht rasch zu Prothesenversagen. Bei diesen Patienten sollte die Prothese so lange wie möglich verzögert werden und chirurgische Optionen, um dies zu erreichen, werden hier vorgestellt. <br />Zuletzt soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass nicht alle posttraumatischen Ellbogenarthrosen durch grosse Unfälle entstehen. Auch einfache Mason-I-Radiuskopffrakturen werden oft von Knorpelschäden am Capitellum begleitet. Kleine intraartikuläre Verletzungen führen zu Blutungen, die den Knorpel biochemisch schädigen und dauerhafte Veränderungen an der Gelenkskapsel verursachen. Letztere sind ein wichtiger Unterschied zwischen der primären und posttraumatisch-sekundären Arthrose. Ebenso können anhaltend ignorierte oder als Tennisarm missinterpretierte Instabilitäten den Knorpel abscheren. Hier hat es eine Dunkelziffer an eventuell vermeidbaren Arthrosen, weshalb die Hemmschwelle, radiologischen Hinweisen auf Einblutung ins Gelenk oder anhaltendem Schmerz nach einem Unfall (mittels CT oder MRT) nachzugehen, gering sein sollte.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1903_Weblinks_lo_ortho_1903_s36_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1253" /></p> <h2>Konservative Behandlung</h2> <p>Wie bei jeder anderen Arthrose empfiehlt sich auch beim Ellbogen initial zumindest der Versuch einer konservativen Therapie. Hier steht die Aktivitätsmodifikation in Beruf und Freizeit an erster Stelle. Gerade bei manuell tätigen Patienten oder Personen mit hohem sportlichem Anspruch ist dies aber meist sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Analgetika können schmerzlindernd wirken. Die konservative Therapie ist aber durch die Natur der Ellbogenarthrose, sprich die gute «Mid-range»-Funktion, eingeschränkt, da die meisten Therapien auf genau diese abzielen. So hat eine Studie von van Brakel aus dem Jahr 2006 gezeigt, dass Hyaluronsäure kaum bessere Ergebnisse als Placebo bei Ellbogenarthrose bewirkt. Wiederholte Kortisoninfiltrationen haben Gewebeschäden und ein erhöhtes Infektrisiko gezeigt. Wenn die konservative Therapie ausgeschöpft ist, sollte eine stufenweise eskalierende chirurgische Strategie verfolgt werden. Ziel dabei ist es, bei wenig Schmerz eine gute Funktion zu erreichen und die prothetische Versorgung so lange wie möglich/ nötig hinauszuzögern.</p> <h2>Synovektomie und/oder Débridement</h2> <p>Die wahrscheinlich bekannteste chirurgische Behandlung der Arthrose am Ellbogen ist die Synovektomie, mit oder ohne Resektion des Radiuskopfes. Vor der Entwicklung der Biologika war sie eine häufige Standardoperation für die rheumatische Arthritis (RA) des Ellbogens. Für Patienten mit RA wurden gute Ergebnisse (66–78 % Erfolgsrate) berichtet, obschon Revisionen mit Resynovektomie nicht selten waren. Tanaka et al. berichteten 2006 im «JBJS» eine bessere Visualisierung und gründlichere Synovektomie und daraus resultierend bessere Ergebnisse im Sinne von Schmerzauslöschung nach arthroskopischer Synovektomie (16/23) im Vergleich zu noch offener Behandlung (11/23). Mit der besseren Behandelbarkeit der RA dank neuerer Medikamente ist die Indikation für die Synovektomie mehr und mehr verschwunden. Parallel wurde aber versucht, die gleiche Strategie für die primäre oder posttraumatische Arthrose zu nutzen. McLaughlin et al. haben in «Arthroscopy» schon 2006 von der arthroskopischen Radiuskopfresektion für die radiokapitelläre, nicht entzündliche Arthrose berichtet und fanden zwar gute Ergebnisse, aber eine deutliche, mittel- bis langfristig relevante Veränderung der Mechanik des Ellbogens. So ist speziell die Resektion des Radiuskopfes ein wichtiger Risikofaktor für spätere Instabilität und Verschlechterung des Ellbogens und sollte gut überlegt werden.</p> <h2>Arthroskopische Arthrolyse und Osteochondroplastik</h2> <p>Zwei der wichtigsten «landmark papers» über die Behandlung der Ellbogenarthrose wurden 1999 und 2006 im Wechsel von Savoie und Field publiziert und berichten über Indikation, Technik und Ergebnisse der arthroskopischen Arthrolyse und Osteochondroplastik des arthritischen Ellbogens. Die Technik ist die Weiterentwicklung der offenen Arthrolyse im Sinne der (verschiedenartig modifizierten) «lateral column procedure» (Abb. 2). Während die «lateral column procedure» immer noch eine wertvolle Behandlungsoption, speziell für arthroskopisch weniger routinierte Ellbogenchirurgen, ist, hat die arthroskopische Behandlung eine Reihe von Vorteilen, allen voran das geringe iatrogene Gewebetrauma und die (theoretisch) bessere Visualisierung und Exploration der Binnenschäden des Gelenks. Letztere ist aber relativ, da mit fortgeschrittener Arthrose die Landmarken verschwimmen und die Kapsel sehr eng wird, sodass zu Beginn der Operation die Darstellung und die Orientierung mitunter sehr schwierig sein können. Das ist auch der grösste Nachteil der arthroskopischen Behandlung, nämlich die hohe technische Schwierigkeit. Katastrophale Komplikationen, wie die komplette Transsektion mehrerer Nerven, sind beschrieben. Weitere Nachteile sind die beschränkte Behandelbarkeit von Ossifikationen in den periartikulären Weichteilen und der Umgang mit störenden Platten/Implantaten, die nicht durch arthroskopische Portale entfernt werden können. Hier kommt wieder die offene Behandlung zum Tragen. Die Indikation für die arthroskopische oder die offene Arthrolyse und die Osteochondroplastik ist aber in den allermeisten Fällen eine arthritische (1) Bewegungseinschränkung mit (2) endlagigem Schmerz und (3) weitgehend erhaltenen Knorpelflächen.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1903_Weblinks_lo_ortho_1903_s36_abb2.jpg" alt="" width="300" height="711" /></p> <h2>Gelenkserhaltende offene Eingriffe</h2> <p>Die arthroskopische oder offene Arthrolyse und die Osteochondroplastik sind sehr erfolgreiche Operationen, um die Beweglichkeit wiederherzustellen und Osteophyten und freie Gelenkskörper zu entfernen. Was aber fehlt, ist eine gewisse Nachhaltigkeit durch Verbesserung des eigentlichen Problems bzw. Entschleunigung der weiteren Abnutzung. Als Faustregel kann gelten, dass ein mehr als hälftiger Knorpelverlust durch die veränderte Biomechanik rasch zu einem Rückfall führt, sodass eigentlich eine Prothese zu diskutieren wäre. Dies ist aber aktuell ein sehr aktives Feld mit vielen neuen Entwicklungen. Eine davon ist z. B. die Korrekturosteotomie des Radius zur Entlastung des radiokapitellären Gelenks. Hackl et al. konnten in einer In-vitro-Studie eine signifikante Reduktion des Anpressdrucks des radiokapitellären Gelenks durch eine Verkürzungsosteotomie des Radius sehen – ohne dabei die Stabilität des Gelenks zu verändern. In einer eigenen Serie von 5 Patienten mit einer verkürzenden Korrekturosteotomie des Radius, mit Korrektur der Achse und Rotation ähnlich einer Tibiaumstellung, konnten wir eine signifikante Verbesserung der subjektiven Schmerzen und Zufriedenheit und auch des MEPS sehen. Die Indikation für die Osteotomie ist zurzeit noch nicht genau beschrieben, sollte aber bei Fällen mit (1) radiokapitellärer Arthrose mit (2) teilweise erhaltenem Knorpelbezug und (3) zumindest strukturell intaktem Capitellum überlegt werden. In der eigenen Serie wurden alle Osteotomien mit Weichteileingriffen (3 Bandplastiken, 2 Arthrolysen) kombiniert (Abb. 3).</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1903_Weblinks_lo_ortho_1903_s37_abb3.jpg" alt="" width="1417" height="1103" /></p> <h2>Interpositionsarthroplastik</h2> <p>Eine erfolgreiche Osteotomie bedarf aber zumindest teilweise erhaltener Knorpelflächen, um die Gelenksfunktion erhalten zu können. Im Falle eines kompletten Verlusts der Gelenkfläche bei Patienten mit Kontraindikation für den prothetischen Ersatz (hoher körperlicher Anspruch, hoher Funktionsanspruch) ist die Interpositionsarthroplastik eine mögliche Alternative.<br /> Die Anconeusinterposition wird bei Defekten des radiokapitellären Gelenks angewandt. Hierbei wird der Radiuskopf reseziert und der mobilisierte M. anconeus in das Gelenk eingeschlagen. Da der Muskel von proximal innerviert und vaskularisiert ist, bleibt er vital und kann den lateralen Ellbogen abstützen. Bei ausgedehnteren Defekten kann auch das ganze Gelenk mit einem Achillessehnenallograft, autologer Fascia lata oder Ähnlichem überzogen werden. Dafür braucht es aber meistens recht ausgedehnte Zugänge mit dem Risiko von relevantem Flurschaden. Besonders eine kompromittierte Gelenksstabilität ist ein wichtiger Risikofaktor für das Versagen einer Interpositionsarthroplastik. In der Literatur werden Ergebnisse mit Erfolgsraten um die 70 % angegeben, aber das sind vor allem kleine Studien mit selektierten Populationen. Die Erfahrungswerte im klinischen Einsatz zeigen eine relevante Schmerzreduktion, aber eine dauerhaft eingeschränkte Funktion und Belastbarkeit. Da die Interpositionsarthroplastik v. a. bei fortgeschrittener Zerstörung des Ellbogens (und wichtigen Argumenten gegen eine Prothese) eingesetzt wird, sind die Patienten aber fast immer stark leidgeplagt und schmerzgeprüft. Bei richtiger Aufklärung und Besprechung der zu erwartenden Ergebnisse sind viele Patienten trotz oft bescheidenen Erfolgs mittelfristig zufrieden. Eine Revision der Interposition zur Prothese ist gut möglich. Somit sollte gerade bei jüngeren Patienten mit fortgeschrittener Arthrose die Interposition «zum Zeitgewinnen» diskutiert werden.</p> <h2>Prothetik</h2> <p>Bei der hochgradigen Arthrose des Ellbogens mit aufgebrauchtem Knorpel und strukturellen Schäden ist eine Prothese zu diskutieren. Die Ellbogenprothetik hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und deutlich ausgereiftere Implantate und Operationstechniken stehen heute zur Verfügung. Im chirurgischen Alltag kommen v. a. zwei Prothesentypen zum Einsatz, die Radiuskopfprothese und die Totalendoprothese.<br />Da die Ellbogenarthrose meist lateral betont ist, kann ein isolierter Gelenksersatz lateral versucht werden. Bereits seit den 1940ern gibt es Radiuskopfprothesen, die aber ursprünglich als Ersatz des Radiuskopfes nach einer Zertrümmerung (Mason-III-Fraktur) gedacht waren, um die Valgusabstützung zu erhalten (Abb. 4). Über die Jahre wurde das Design dieser Implantate stetig verbessert, was sich in den Ergebnissen nach Implantation widerspiegelt. Die Radiuskopfprothese ist bei der Arthrose aber auch vom Zustand des Knorpels am Capitellum abhängig, wobei es unklar ist, wie viel Knorpel man braucht bzw. wie viel Schaden toleriert werden kann. Es erscheint jedoch plausibel, dass die Hemiprothese des lateralen Ellbogens den gleichen Limitationen wie die Hemiprothese der Schulter oder der Hüfte unterliegt. Es wurden in der Vergangenheit daher mehrere radiokapitelläre Teilprothesen entwickelt, die den lateralen Ellbogen an beiden Gelenkspartnern ersetzten. Diese Prothesen haben aber bis anhin wenig Fuss gefasst, und die Ergebnisse sind, wenn auch trendweise gut, nicht nachhaltig dokumentiert und erforscht.<br /> Die verschiedenen Totalendoprothesen bauen zumeist auf einem («semi-constraint») wackelstabilen, achsgeführten Ersatz des Ulnohumeralgelenks mit oder ohne Ersatz des radiokapitellären Gelenks auf. Die typische Zielgruppe sind Patienten mit niedrigem körperlichem Anspruch, da die Prothese nicht mit mehr als 5 kg belastet werden darf. In dieser Population zeigt die Ellbogenprothetik gute Ergebnisse, aber relativ viele Komplikationen (11–38 %).<br /> Die häufigste Komplikation ist die Prothesenlockerung (ca. 7–10 %), meist durch Überbelastung bedingt, gefolgt von Infekt, Fraktur und Nervenschäden. Einige Risikofaktoren haben sich wiederholt als besonders massgeblich für das Prothesenversagen herausgestellt, nämlich ein Alter unter 50 Jahren, männliches Geschlecht, eine Trauma- oder Infektanamnese und mehrere (≥ 2) Voroperationen. Eine Metaanalyse im «JBJS» von 2017 berichtet von einer Revisionsrate von 14 % von knapp 9400 Ellbogenprothesen. In der gleichen Studie wurde eine durchschnittliche 10-Jahres-Überlebensrate von 79,2 % berichtet. Im Vergleich haben Knieprothesen 10-Jahres-Überlebensraten zwischen 94,3 % und 97,04 %, inverse Schulterprothesen von 93 %. Diese Zahlen unterstreichen noch einmal, warum die Totalendoprothese des Ellbogens als «salvage procedure» angesehen werden sollte und dass eine eskalierende Strategie, die die klinische Funktion erhält und die Prothese hinauszögert, gerechtfertigt ist. Eine aktuelle Studie der Mayo Clinic zu 10-Jahres-Ergebnissen nach Totalendoprothese aufgrund von Trümmerfrakturen des distalen Humerus hat ebenso gezeigt, dass auch hier die Überlebensraten der Prothese und die häufigen Komplikationen vorsichtig gegen eine schwierige Osteosynthese abgewogen werden müssen.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1903_Weblinks_lo_ortho_1903_s38_abb4.jpg" alt="" width="400" height="551" /></p> <h2>Drei verwandte Themen</h2> <p>Drei Themen sind mit der Arthrose des Ellbogens eng verwandt und sollen hier auch mitdiskutiert werden.<br /> Zunächst sind die Nervenstrukturen rund um den Ellbogen, speziell der Nervus ulnaris, zu nennen. Im Rahmen der Vernarbung der Kapsel und der zunehmenden Bewegungseinschränkung des Gelenks und durch Druck von Osteophyten ist der Ulnaris oft mitbetroffen. Bei präoperativen Symptomen sollte eine sorgfältige Dekompression des Nervs (inkl. Entfernung von Osteophyten am posteromedialen Ellbogen) durchgeführt werden, ebenso, wenn vor der Operation eine Flexionskontraktur von > 100° besteht oder mit mehr als 30° Bewegungszugewinn gerechnet wird. Ist der Nerv in Flexion instabil, so sollte er verlagert werden. Bei der Resektion der ventralen Kapsel kann der Nervus radialis ebenso dargestellt und (limitiert) neurolysiert werden, aber es gibt keine evidenzbasierte Empfehlung, dies routinemässig durchzuführen (Abb. 2). Die Vorteile der Neurolyse müssen gegen die mögliche Gefahr einer Nervenverletzung abgewogen werden.<br /> Per se keine eigentliche Arthrose ist die Osteochondritis dissecans (OCD) des Ellbogens dennoch eine wichtige mögliche Präarthrose des Ellbogens. Das häufigste Problem der OCD ist, dass man sie gerne überoder unterbehandelt. In den frühen Phasen muss der Ellbogen lediglich vor (Über-)Belastung bewahrt, er darf aber normal bewegt werden. Hier wird oft mit Schienen, Gipsen etc. überbehandelt. In späteren Phasen darf aber nicht gezögert werden, eine adäquate chirurgische Therapie anzugehen, bevor es zu dauerhaften Schäden am Gelenk kommt (Abb. 5).<br /> Zuletzt ist die Arthrose des Ellbogens immer noch eine kontroversiell diskutierte und verschiedenartig behandelte Erkrankung. So ist die Arthrodese des Ellbogens immer noch eine relevante Therapie der Ellbogenarthrose, wenngleich auch mit sehr bescheidenem funktionellem Ergebnis. Ähnliches gilt für auf dem Markt nicht flächendeckend erhältliche Systeme für Hemi- und Teilprothesen oder nicht achsgeführte Prothesen. Auf der anderen Seite kann eine rein weichteilige Bewegungseinschränkung der frühen Arthrose – sofern ohne Verknöcherung und relevante Osteophyten – auch gut mit einer statisch-progressiven Quengelschiene behandelt werden.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1903_Weblinks_lo_ortho_1903_s38_abb5.jpg" alt="" width="400" height="711" /></p> <h2>Fazit</h2> <p>Die Arthrose des Ellbogens grenzt sich in wichtigen Punkten von der Arthrose anderer Gelenke ab, speziell was die Progression der Erkrankung betrifft. So entstehen bei der Ellbogenarthrose schon früher Osteophyten, die die Bewegung blockieren, während die Knorpelschicht lange erhalten bleibt und eine verhältnismässig normale «Mid-range»-Funktion ermöglicht. Das ist der Grund, warum die typischen konservativen Behandlungsoptionen, die auf die «Mid-range»-Funktion abzielen, nicht greifen, aber die Arthrolyse mit Osteochondroplastik sehr gute Ergebnisse zeigt. Die technische Schwierigkeit ist jedoch gross. Die Endoprothetik des Ellbogens hat trotz der rezenten technischen Weiterentwicklung noch immer starke Limitationen und hohe Komplikationsraten. Ausser für «Low demand»-Patienten sollte sie daher als «salvage procedure» angesehen werden. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen chirurgischen Therapien sollten genau studiert und in die Entscheidungsmatrix aufgenommen werden (Abb. 6).</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1903_Weblinks_lo_ortho_1903_s39_abb6.jpg" alt="" width="2150" height="1144" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»
Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...
Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk
Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...
Patellofemorale Instabilität
In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.


