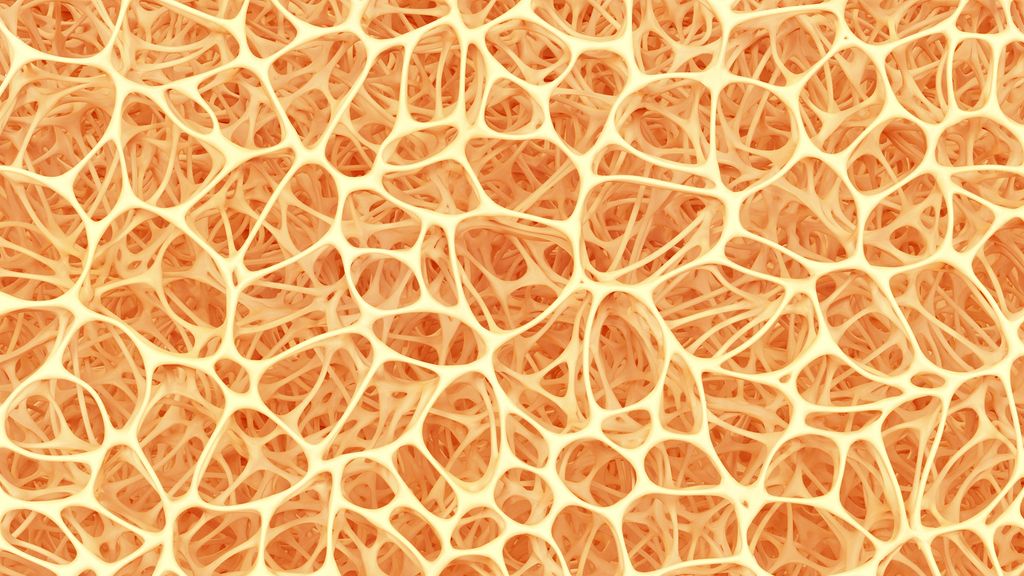
©
Getty Images/iStockphoto
Endoprothetische Versorgung der sekundären Dysplasiecoxarthrose bei kongenitaler Hüftluxation
Jatros
Autor:
Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Dominkus
II. Orthopädische Abteilung, Orthopädisches Spital Speising, Wien
Autor:
Priv.-Doz. Dr. Jochen Hofstätter
II. Orthopädische Abteilung, Orthopädisches Spital Speising, Wien<br> E-Mail: jochen.hofstaetter@oss.at
30
Min. Lesezeit
21.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die endoprothetische Versorgung einer hohen Hüftluxation stellt eine operative Herausforderung dar. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die anatomische Problemstellung zu beleuchten und die häufigsten OP-Methoden kurz zu betrachten. Weiters werden die wichtigsten OP-Schritte der zementfreien Versorgung mittels subtrochantärer Verkürzungsosteotomie und Geradschaft erläutert.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die Klassifikation einer kongenitalen Hüftdysplasie im Erwachsenenalter erfolgt nach Hartofilakidis bzw. Crowe. Die Klassifikation nach Hartofilakidis unterscheidet Typ A bis C, wobei der Typ A die Dysplasie, der Typ B eine niedrige Hüftluxation mit Kranialmigration des Drehzentrums und der Typ C eine hohe Hüftluxation darstellt. Weiters werden noch der Typ B und C in jeweils zwei Untertypen eingeteilt. Nach Crowe unterscheiden wir 4 Typen mit 2 Untertypen bei der hohen Hüftluxation (Abb. 1). Folgende pathologische anatomische Besonderheiten, acetabulär als auch femoral, sind bei der hohen Hüftluxation neben der ausgeprägten Beinlängendifferenz zu berücksichtigen:</p> <ul> <li>kontrakte und atrophe Weichteilverhältnisse,</li> <li>sehr kleines dyplastisches Acetabulum mit geringer Tiefe bzw. geringem Bone- Stock und schlechter Knochenqualität,</li> <li>häufig deutliche Ante- bzw. auch Retroversion des Acetabulums,</li> <li>verstärkte Antetorsion des Schenkelhalses mit häufiger pathologischer Torsion der proximalen Metaphyse,</li> <li>enger, nicht konisch verlaufender, sondern zylindrischer Markraum femoral metadiaphysär.</li> </ul> <h2>Operationsmethoden</h2> <p>Es können grundsätzlich alle Zugangswege zum Hüftgelenk gewählt werden. Aufgrund der Komplexität des Eingriffes und der kontrakten Weichteilverhältnisse sind Eingriffe, die eine gute Exposition zulassen und einen Weichteilrelease leicht ermöglichen, von Vorteil. Der modifizierte transgluteale, der posteriore und der transtrochantäre Zugang ermöglichen dies. Das Risiko eines Traktionsschadens, v.a. des N. ischiadicus, aber auch des N. femoralis und N. obturatorius, steigt bei akuten Beinverlängerungen über 3,5cm stark an. Um eine geringere Verlängerung sowie weniger straffe Weichteilverhältnisse bzw. eine langsamere Verlängerung zu erzielen, wurde in der Literatur eine Vielzahl von Operationsmethoden am Femur beschrieben. Hier die wichtigsten:</p> <p><strong>Subtrochantäre Verkürzungsosteotomie</strong><br /> Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen subtrochantären Osteotomiearten (gerade, schräg, „double-chevron“, „step-cut“ etc). Ziel einer komplexeren Osteotomie, wie z.B. der Step-cut-Osteotomie, sollte eine erhöhte primäre Rotationsstabilität der beiden Fragmente sein. Entwickelt haben sich diese Osteotomien, weil vor allem in angloamerikanischen Ländern der modulare S-ROM (DePuy Synthes) verwendet worden ist, welcher aufgrund seines runden Schaftes eine geringere Rotationsstabilität diaphysär aufweist als z.B. rechteckige Schäfte. Biomechanische Studien haben aber gezeigt, dass komplexe Osteotomien keinen signifikanten Vorteil zeigen. Die gerade Osteotomie hat drei Vorteile gegenüber komplexen Osteotomien: 1. Rotationsfehlstellungen können leicht korrigiert werden. 2. Der Eingriff ist relativ weichteilschonend. Das Risiko einer Devaskularisierung des Knochens mit Heilungsstörung ist geringer. 3. Der Eingriff ist technisch am einfachsten.</p> <p><strong>Diaphysäre bzw. distale metaphysäre Verkürzungsosteotomie</strong><br /> Diese OP-Methode ist indiziert, wenn gleichzeitig ein ausgeprägtes hochgradiges Genu valgum besteht, sodass hier eine gleichzeitige Normalisierung der mechanischen Achse des Kniegelenkes erzielt werden kann.</p> <p><strong>Benützung eines Fixateur externe zur Distalisierung des Femurs</strong><br /> Dieser Eingriff wurde zwar erstmals ohne Kopfresektion und Kapselrelease beschrieben, aber eine leichtere Verlängerung kann sicherlich nach Kopf- und Kapselresektion erzielt werden. Der große Nachteil dieser OP-Methode, neben der Notwendigkeit eines zweiten Eingriffs, ist die schwierige mehrwöchige Interimsphase mit Becken-Femur-Fixateur. Der Vorteil ist, dass keine Verkürzungsosteotomie notwendig ist.</p> <p>Im Bereich des Acetabulums ist in erster Linie das Ziel, die Hüftgelenkspfanne anatomisch zu positionieren. Dies ist häufig nur mit einer Pfannendachplastik zu erzielen. Um für zu erwartende zukünftige Revisionsoperationen einen maximalen Bone-Stock zu erreichen, ist es wichtig, das Drehzentrum zu distalisieren und den autologen Femurkopf als Graft zu verwenden. Ziel ist eine zementfreie Versorgung der Hüftgelenkspfanne mit entweder einer kleinen Pfanne mit hoher Primärstabilität (z.B. Schraubpfanne Variall, Fa. Zimmer) oder einer verschraubbaren Pressfit-Pfanne (Pinnacle-Bantam, DePuy Synthes). Sollte die Knochenqualität des Femurkopfes nicht für ein strukturelles Autograft verwendet werden können und sollten so kleine Verhältnisse vorliegen, dass auch die kleinste Pfanne zu groß ist, besteht die Möglichkeit einer medialen Protrusionstechnik („cotyloplasty“). „Trabecular metal“-Augmente sollten nur im Ausnahmefall verwendet werden.<br /> Leider haben alle in der Literatur beschriebenen OP-Methoden eine deutlich höhere Rate an Früh- und Spätkomplikationen bei der Versorgung einer hohen Hüftluxation im Vergleich zur normalen Coxarthrose. Revisionsraten bis zu 25 % sind beschrieben. Zu den häufigsten Komplikationen gehören die Früh- und Spätlockerung der Pfanne, die Post-OP-Luxation, die Fraktur, Nervenläsionen und Pseudarthrosen im Falle einer Osteotomie.<br /> Die meisten Patienten kommen nicht aus Österreich, sondern aus südlichen Nachbarländern bzw. dem arabischen Raum. Bei diesen Patienten ist es obligat, präoperativ den 25OH-Vitamin-D3-Status zu erheben. Fast alle Patienten aus diesen Ländern benötigen präoperativ eine Substitution von Vitamin D3.</p> <h2>OP-Technik</h2> <p>Eine digitale OP-Planung ist obligat. Wir verwenden meistens den modifizierten transglutealen Zugang. Die Schenkelhalsosteotomie sollte unüblich basisnahe am Kopf durchgeführt werden, sodass ein relativ langes Stück am Calcar stehen bleibt, welches für die spätere Rotationsstabilität des proximalen Fragmentes essenziell ist. Danach wird die Primärpfanne dargestellt. Unter Bildwandlerkontrolle erfolgt das Anfräsen mit der kleinstmöglichen Pfanne (Variall, Fa. Zimmer). Im Rahmen dieses Schrittes wird bestimmt, ob eine zusätzliche Pfannendachplastik notwendig ist. Danach wird die Pfannendachplastik durchgeführt, z.B. die „Siebener-Plastik“ („number seven graft“). Im Anschluss erfolgen nochmaliges Fräsen im neuen Knochenbett und das Einbringen einer größeren Schraubpfanne, als gefräst wurde. Falls eine Pressfit- Pfanne verwendet wird, kann die letzte Fräsung im Rückwärtsgang durchgeführt werden, um Knochenmaterial nicht zu entfernen, sondern nur zu komprimieren, da der Knochen immer sehr weich ist. Pressfit- Pfannen sollten zusätzlich verschraubt werden. Im nächsten Schritt wird der Schaft präpariert, bis die Raspel am Calcar anliegt. Wir verwenden den SLV-Schaft des Variall- Systems (Fa. Zimmer). Hier ist wichtig, dass exakt präpariert und das metaphysäre Knochenlager nicht ausgehöhlt bzw. ausgeweitet wird, da dieses für die Rotationsstabilität des proximalen Fragmentes wichtig ist. Nun wird die gerade subtrochantäre Verkürzungsosteotomie durchgeführt. Hier ist zu beachten, dass die Osteotomie so knapp wie möglich unterhalb des Trochanter minor und auch so weichteilschonend wie möglich erfolgt. Wie bei jeder Osteotomie sollte Hitzeentwicklung vermieden werden. Danach wird ein ca. 2,5–3,5cm großes kortikales Fragment entfernt. Im distalen femoralen Fragment wird daraufhin separat geraspelt. Falls eine sehr schlechte Knochenqualität vorliegt, kann hier eine Sicherungscerclage verwendet werden. Dann erfolgen das Einfädeln der Fragmente, nochmaliges Raspeln und Probereposition mit Bildwandlerkontrolle. Falls rotationsstabile Verhältnisse vorliegen, kann auf eine Plattenosteosynthese verzichtet werden. Im Zweifelsfall ist diese sinnvoll. Zuletzt erfolgen das Einbringen der definitiven Implantate und die Reposition.<br /> Die postoperative Mobilisierung beinhaltet 6 Wochen Teilbelastung mit 15kg und weitere 6 Wochen Teilbelastung mit 30kg, dann zunehmende Vollbelastung nach Röntgenkontrolle.<br /> Insgesamt ist zu erwarten, dass wir in Zukunft dieses Krankheitsbild immer seltener sehen werden. Aufgrund der berichteten hohen Komplikationsrate und der Komplexität des Eingriffes empfehlen wir, die Operation nur an Abteilungen durchzuführen, an denen mehrere Fälle pro Jahr operiert werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1705_Weblinks_ortho_1705_s22_abb.1.jpg" alt="" width="1417" height="940" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1705_Weblinks_ortho_1705_s23_abb.2.jpg" alt="" width="1417" height="1499" /></p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Die endoprothetische Versorgung einer hohen Hüftluxation ist eine chirurgische Herausforderung, da man neben der großen Beinlängendifferenz auch auf typische acetabuläre und femorale Gegebenheiten bzw. Problemstellungen trifft. Eine zementfreie Versorgung mittels Geradschaft und subtrochantärer Verkürzungsosteotomie ist unter Einhaltung wichtiger Details eine gute Versorgungsmöglichkeit dieser Pathologie.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»
Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...
Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk
Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...
Patellofemorale Instabilität
In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.


