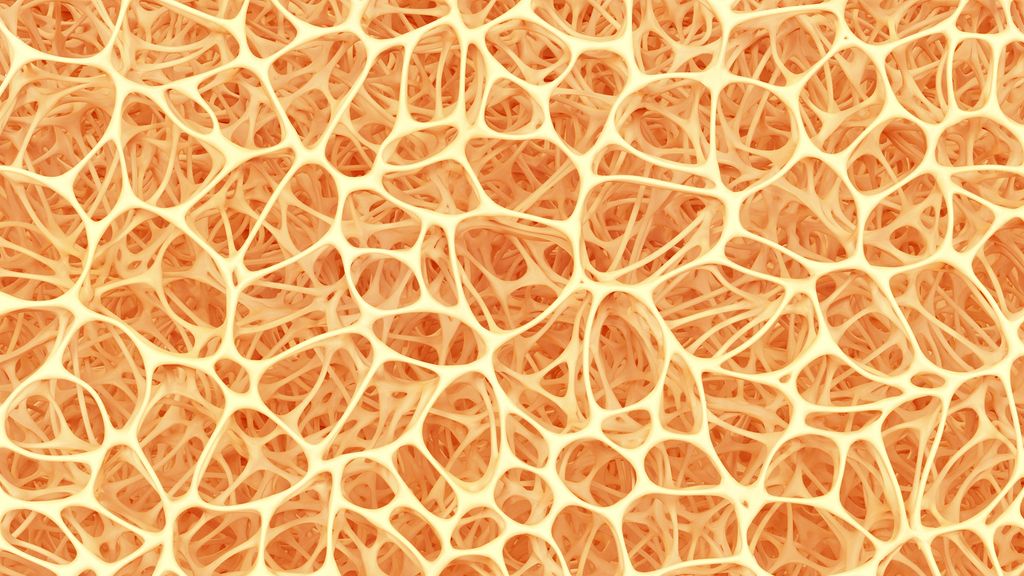
©
Getty Images/iStockphoto
Extrakorporale Stoßwellentherapie: Evidenz und Trends
Jatros
Autor:
Dr. Raphael Scheuer
Abteilung für orthopädische Schmerztherapie,<br> Orthopädisches Spital Speising, Wien<br> E-Mail: raphael.scheuer@oss.at
30
Min. Lesezeit
23.02.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die extrakorporale Stoßwellentherapie erfreut sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit in der Therapie von Schmerzzuständen am Bewegungsapparat. Neue Erkenntnisse hinsichtlich möglicher Wirkmechanismen sowie innovative Anwendungen auch in anderen Fachgebieten zeigen das große Potenzial dieser Therapieform auf. Ein Überblick zu Grundlagen, bewährten und innovativen Indikationen sowie ein Ausblick auf mögliche Entwicklungen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Das Anwendungsspektrum der extrakorporalen Stoßwellentherapie hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert.</li> <li>Es sind bei sachgemäßer Anwendung keine anhaltenden Nebenwirkungen bekannt.</li> <li>Stoßwellentherapie wird generell noch als Second- Line-Therapie gesehen.</li> <li>Unterstützende Heilgymnastik ist bei Schmerzzuständen am Bewegungsapparat ohnehin erforderlich.</li> </ul> </div> <h2>Rückblick</h2> <p>Im Jahr 1980 wurde die Stoßwellentherapie weltweit erstmals in Deutschland zur Behandlung von Nierensteinen am Menschen eingesetzt. Im Jahr 1986 fiel einem aufmerksamen Urologen in Bochum im Zuge einer Röntgenverlaufskontrolle nach Behandlung eines Uretersteins eine Sklerosezone an einer Beckenschaufel auf, welche just dort auftrat, wo Stoßwellen den Beckenkamm passieren mussten. Diese Nebenwirkung weckte rasch das Interesse findiger Unfallchirurgen, welche bereits 1989 erstmalig eine Pseudoarthrose erfolgreich mittels extrakorporaler Stoßwellentherapie behandeln konnten. Seit Anfang der 1990er-Jahre wird die Stoßwellentherapie auch in der Schmerztherapie angewandt, wobei zu Beginn die Behandlung von Insertionstendinopathien wie etwa der Plantarfasciitis oder der Epicondylitis im Vordergrund standen. Im Zuge der Behandlung einer Vielzahl von Pseudoarthrosen zeigte sich nach offenen Frakturen auch eine deutlich verbesserte Wundheilung, weshalb man alsbald das rein mechanistische Modell des Wirkprinzips der Stoßwellentherapie hinterfragen und sich auf die Suche nach biologischen Wirkmechanismen machen musste.</p> <h2>Physik der Stoßwellen</h2> <p>Bei Stoßwellen handelt es sich um energiereiche Druckwellen, wie sie beispielsweise bei Explosionen oder Blitzabgängen freigesetzt werden. Fokussierte Stoßwellen sind gekennzeichnet durch einen raschen Druckanstieg (<10ns) mit einer kurzen Impulsdauer, eine Ausbreitung im Gewebe mit Überschallgeschwindigkeit und Spitzendrücken über 100 bar. Die Generierung fokussierter Stoßwellen erfolgt elektrohydraulisch, elektromagnetisch oder piezoelektrisch. Die so unterschiedlich produzierten Wellen unterscheiden sich physikalisch nicht unerheblich voneinander, auch die Größe des Wirkfokus nimmt in der angegebenen Reihenfolge von elektrohydraulisch zu piezoelektrisch ab.<br /> Radiale Druckwellen werden pneumoballistisch, also mit Pressluft, generiert. Sie unterscheiden sich sowohl hinsichtlich Erzeugung als auch in ihren physikalischen Eigenschaften deutlich von fokussierten Stoßwellen und erfüllen die Formalkriterien von Stoßwellen prinzipiell nicht. Dennoch ist der Terminus „radiale Stoßwelle“ weit verbreitet und akzeptiert.<br /> Einer der wesentlichsten Unterschiede besteht wohl darin, dass fokussierte Stoßwellen ihre Energie in der Tiefe des Gewebes bündeln und somit die maximale Energie pro Fläche in der vorgegebenen Fokustiefe erreicht wird, während radiale Stoßwellen ihre maximale Energie pro Fläche direkt am Eintrittspunkt durch die Haut freisetzen und sich dann kegelförmig ins Gewebe ausbreiten (Abb. 1). Dem Quadrat-Abstand-Gesetz folgend, ist das Wirkmaximum der radialen Stoßwellen somit oberflächennahe zu suchen, während es bei fokussierten Stoßwellen in der einstellungsabhängig vorgegebenen Fokustiefe zu finden ist. Naheliegend erscheint daher die Schlussfolgerung, dass radiale Stoßwellen oberflächennahe gut anzuwenden sind; möchte man tiefer liegende Strukturen erreichen, ist hingegen die Therapie mit fokussierten Stoßwellen aussichtsreicher.</p> <p><img style="undefined" src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1701_Weblinks_s18_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="816" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1701_Weblinks_s18_abb2.jpg" alt="" width="1051" height="904" /></p> <h2>Hypothesen über Wirkmechanismen</h2> <p>Bis heute sind die Wirkmechanismen der Stoßwellentherapie nur teilweise geklärt. Das mag auch daran liegen, dass die zugrunde liegende Pathologie verschiedener Indikationen ebenso nicht vollständig geklärt ist. So gibt es beispielsweise im Hinblick auf die häufige Plantarfasciitis mehrere Autoren, die von einer rein degenerativen Ursache ausgehen, während eine Vielzahl anderer Autoren eine in erster Linie entzündliche Genese in Betracht ziehen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist die Stoßwellentherapie die wahrscheinlich meistbeforschte schmerztherapeutische Methode.<br /> Ursprünglich ging man von einer rein mechanischen Wirkung der Stoßwellentherapie aus, welche durch die direkte Krafteinwirkung zur Desintegration des Gewebes mit Knochenfissuren bzw. einer Gewebszerreißung im Sinne von Spannungsrissen führt. Die direkte Krafteinwirkung dürfte durch das Auftreten und unmittelbar im Anschluss das Kollabieren von sog. Kavitationsblasen unterstützt werden. Im Zuge dieses Blasenkollapses unter Einfluss von Stoßwellen kommt es neuerlich zur asymmetrischen Abgabe von Energie. Die Kavitation ist nicht auf den Fokus beschränkt, dort aber besonders ausgeprägt. Insgesamt kommt es somit also zu petechialen Blutungen und einer Erhöhung der Permeabilität von Zellwänden. Im Gegensatz zur Lithotripsie wird aber nichts „zertrümmert“ – auch nicht bei der Kalkschulter.<br /> Auch neuronale Effekte wurden vielfach diskutiert. Deren Existenz scheint insofern unbestritten, als schon während der Therapie ein anästhetischer Effekt eintritt, der unterschiedlich lang anhält. Außerdem wird die Therapie auch erfolgreich bei spastischen Zuständen eingesetzt. Im Zuge der Beforschung dieser neuronalen Effekte stellte sich auch heraus, dass die Verwendung eines Lokalanästhetikums bei der Therapie von Schmerzzuständen am Bewegungsapparat das Outcome verschlechtert.<br /> Wie schon angedeutet, musste man dieses rein mechanistische Denkmodell recht bald verlassen, auch weil sich positive Effekte der Stoßwellentherapie gerade in der Schmerztherapie schon bei sehr niedrigen Energieflussdichten feststellen ließen. Das Stichwort in diesem Zusammenhang lautet „Mechanotransduktion“ – es soll die Überführung der mechanischen Energie in eine biologische Gewebeantwort versinnbildlichen. Vereinfacht gesagt, geht man davon aus, dass es durch die Stoßwellentherapie zu einer Genexpression und enzymatischen Gewebsreaktion kommt. Man hat im Tierversuch festgestellt, dass nach Stoßwellentherapie vor allem Wachstumsfaktoren ausgeschüttet und Stammzellen im Gewebe aktiviert werden. Es scheint somit nicht nur Gewebereparatur, sondern tatsächlich auch Geweberegeneration stattzufinden. Einen der zugrunde liegenden Mechanismen dürfte zuletzt ein Team rund um Doz. Johannes Holfeld, Herzchirurg am Universitätsklinikum Innsbruck, entschlüsselt haben: Durch Aktivierung des sogenannten Toll-like-Rezeptors 3 (TLR3) kommt es zu einer Immunmodulation und Angioneogenese. Diese gesteigerte Einsprossung von neuen Blutgefäßen nach Stoßwellentherapie war schon zuvor vielfach im Tierversuch in unterschiedlichen Geweben festgestellt worden.</p> <h2>Indikationen und Trends</h2> <p>Die Stoßwellentherapie gilt in der Orthopädie und Traumatologie als Second- Line-Therapie. Gerade in den häufigen Fällen der Ansatztendinopathien muss neben jedweder Therapieform aber ohnehin ein entsprechendes Dehnungs- und exzentrisches Kräftigungsprogramm verordnet werden, welches prinzipiell die First-Line-Therapie darstellen sollte.<br /> Das Konsensuspapier der Internationalen Gesellschaft für Stoßwellentherapie (ISMST), welches in Zusammenarbeit mit der deutschsprachigen internationalen Gesellschaft für Stoßwellentherapie (DIGEST) erarbeitet wird, teilt die bereits mehr oder weniger gut untersuchten Indikationen nach aktuellem Stand der Literatur in gut untersuchte Standardindikationen, ausreichend gut untersuchte Indikationen, Expertenindikationen sowie experimentelle Indikationen ein.<br /> Zu den gut untersuchten Standardindikationen zählen neben den häufigen Ansatztendinopathien vor allem auch Pseudoarthrosen, Stressfrakturen, avaskuläre Knochennekrosen im Frühstadium und Osteochondrosis dissecans im Frühstadium. Am Beispiel der Hüftkopfnekrose betrifft dies also jedenfalls die Stadien ARCO I und II, laut einigen Autoren auch ARCO III. Diverse Studien zeigen, dass sowohl radiale als auch fokussierte Stoßwellen zufriedenstellende Resultate bei der Behandlung von Insertionstendinopathien zeigen.<br /> Ausreichend gut untersucht sind muskuläre Schmerzzustände (myofasziales Syndrom, Triggerpunkte), die eher eine Domäne der radialen Therapie darstellen, sowie Wundheilungsstörungen.<br /> Die Behandlung muskulärer Schmerzzustände mit Stoßwellentherapie stellt sicherlich einen der großen Trends der letzten Jahre dar. Die Industrie trägt diesem Trend mit der Entwicklung spezieller Applikatoren oder hochfrequent arbeitender Handstücke Rechnung. Während viele dabei in erster Linie auf akute Schmerzzustände abzielen, sehen andere auch durchaus Möglichkeiten in der Therapie chronischer, panalgetiformer Schmerzsyndrome wie des „myofascial pain syndrome“ (MPS), teils auch der Fibromyalgie. Die Therapie akuter Schmerzen, wie etwa bei Muskelverletzungen im Sport, hat zwar derzeit noch wenig Evidenz, findet aber durchaus positive Resonanz in deutschen und italienischen Profiligen.<br /> Die Therapie von Arthrosen oder Knochenmarködemen jeglicher Lokalisation ist den experimentellen Indikationen zuzurechnen.</p> <h2>Kontraindikationen</h2> <p>Im niedrig- und mittelenergetischen Bereich, der bei Anwendungen in der Ordination nur selten überschritten werden muss, bleibt als absolute Kontraindikation der maligne Tumor im Fokus. Antikoagulation und Herzschrittmacher stellen hingegen keine Kontraindikationen mehr dar. Die Anwendung in der Schwangerschaft sollte nur nach Abwägung des Nutzen- Risiko-Verhältnisses erfolgen. Im hochenergetischen Bereich kommen einige relative Kontraindikationen hinzu, diese sind den Leitlinien der Fachgesellschaften zu entnehmen.</p> <h2>Welches ist das richtige Gerät für mich?</h2> <p>Wie so oft ist diese Entscheidung keine einfache. Will man in der Ordination gelegentlich Ansatztendinopathien oder myofasziale Schmerzzustände behandeln, ist ein radiales Gerät mit Sicherheit eine gute Option. Nach 3 bis 5 Sitzungen in etwa wöchentlichen Abständen lässt sich eine hohe Patientenzufriedenheit erzielen. Mit fokussierter Therapie lässt sich gerade bei Insertionstendinopathien mit deutlich weniger Therapiesitzungen eine mindestens ebenso zufriedenstellende Wirkung erreichen. Die Behandlung von Pseudoarthrosen, avaskulären Knochennekrosen sowie Stressfrakturen ist eine Domäne der fokussierten Therapie.<br /> In der Praxis sind der Einkaufspreis sowie die Betriebskosten eines Gerätes ein entscheidender Faktor. Diese liegen bei fokussierten Geräten erheblich höher als bei radialen. Der Betrieb eines fokussierten Gerätes lohnt sich also wirtschaftlich nur bei regelmäßiger Anwendung.<br /> Ein ebenso wesentlicher Punkt ist die Erstattung der Therapiekosten durch Sozialversicherungen bzw. Privatarztversicherungen. Während in Österreich Letztere diesbezüglich für gewöhnlich unkomplizierte Kostenübernahme garantieren, ist dies bei den gesetzlichen Krankenversicherungen leider nicht der Fall. Gebietskrankenkassen bezahlen diese Therapieform nicht, kleine Kassen übernehmen oftmals nach vorheriger Bewilligung einen Großteil der Kosten. Hierbei werden allerdings fokussierte Geräte leicht bevorzugt.</p> <h2>Ausblick</h2> <p>Die intensive Forschungstätigkeit der letzten Jahre hat das Indikationsspektrum der Stoßwellentherapie deutlich erweitert. In der Urologie wird sie längst nicht mehr nur zur Lithotripsie angewandt, auch hier macht man sich mittlerweile biologische Wirkmechanismen zunutze und behandelt Schmerzzustände wie chronische Prostatitis.<br /> Die Regeneration peripherer Nervenläsionen lässt sich mittels Stoßwellentherapie ebenso deutlich beschleunigen, wie auch periphere Durchblutungsstörungen. Beides wurde am Tiermodell eindrucksvoll bewiesen. In Innsbruck läuft derzeit eine Studie an Patienten mit ischämischem Spinalinfarkt bedingt durch Aortendissektionen, wobei sich in derzeitigen Pilotversuchen vielversprechende Ergebnisse erhoffen lassen. Somit sind auch Behandlungen am Zentralnervensystem von der Kontraindikation zur möglichen Indikation geworden.<br /> Die Anwendung extrakorporaler Stoßwellentherapie im Zuge von Bypass-Operationen über ischämischen Bezirken am schlagenden Herzen brachte erstaunliche Steigerungen der LVEF bei diesen Patienten im Vergleich zur Kontrollgruppe und ist somit ein weiterer Beweis für die regenerative Wirkung von Stoßwellen. Dieses Wissen hat natürlich auch für die Orthopädie und Traumatologie entscheidende Bedeutung im Hinblick auf die Erschließung neuer Anwendungsgebiete.</p> <h2>Fazit</h2> <p>Das Anwendungsspektrum der extrakorporalen Stoßwellentherapie hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert. Es sind bei sachgemäßer Anwendung keine anhaltenden Nebenwirkungen bekannt. Die Erkenntnisse der letzten Jahre hinsichtlich möglicher Wirkmechanismen sowie die innovativen Anwendungen auch in anderen Fachgebieten offenbaren das immer noch bestehende Entwicklungspotenzial dieser Therapieform.<br /> Abschließend festzuhalten ist, dass die Stoßwellentherapie – abgesehen von der Lithotripsie – generell noch als Second- Line-Therapie geführt wird. In Anbetracht der guten Ergebnisse, welche durchwegs ohne nennenswerte Komplikationen erreicht werden, sollte dies allerdings alsbald überdacht werden. Unterstützend ist Heilgymnastik bei der Behandlung von Schmerzzuständen am Bewegungsapparat als First- Line-Therapie therapeutisch wie auch präventiv ohnehin zwingend erforderlich.<br /> Dem interessierten Behandler seien die sogenannten Fachkundekurse, die von der Deutschsprachigen internationalen Gesellschaft für extrakorpale Stoßwellentherapie (DIGEST) angeboten werden, ans Herz gelegt.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»
Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...
Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk
Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...
Patellofemorale Instabilität
In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.


