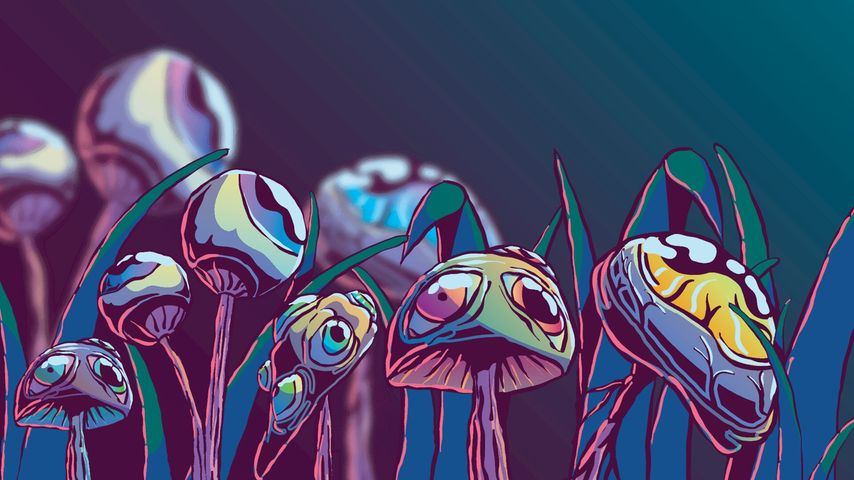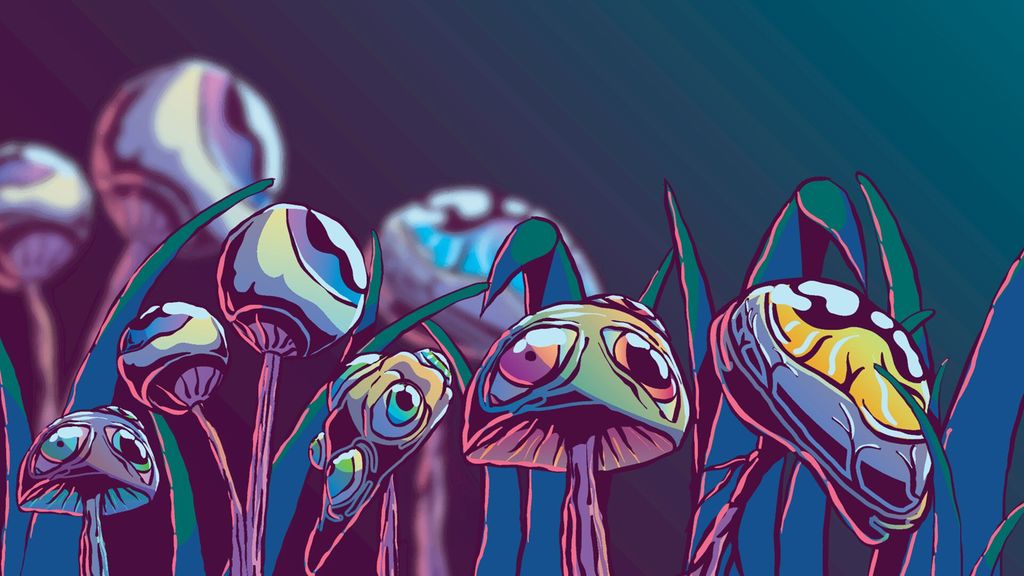
Die psychedelische Renaissance
Autor: Prof. Dr. med. Daniele Zullino
Chefarzt Kliniken für Suchtpsychiatrie
Departement für Psychiatrie
Universitätsspitäler Genf
E-Mail: Daniele.Zullino@hcuge.ch
Seit Beginn des neuen Jahrtausends erlebt die psychiatrische Forschung eine eigentlich psychedelische Renaissance, ein kraftvolles Wiedererwachen des wissenschaftlichen Interesses insbesondere an LSD und Psilocybin.
Keypoints
-
Psilocybin und LSD wirken vornehmlich über die Aktivierung von 5HT2A-Rezeptoren.
-
Sie interferieren auf diese Weise mit der Aktivität des «Default Mode Network» (DMN, Ruhezustandsnetzwerk).
-
Einsicht und emotionale Intensität während der psychedelischen Sitzung sind signifikante Prädiktoren der therapeutischen Wirkung.
-
Die unkritische Übernahme von Praktiken aus dem rituellen/religiösen Gebrauch birgt in sich die Gefahr der Esoterisierung und der Verwischung zwischen einer wissenschaftlich fundierten therapeutischen Anwendung von Psychedelika und Psychonautik.
Eine erste solche Phase intensiver Forschung hatte von Ende der 1950er-Jahre (Entdeckung der Wirkungen dieser beider Substanzen durch Albert Hofmann in Basel) bis zu Beginn der 1970er gedauert, bis sie durch die Prohibition der Psychedelika ab 1971 jäh zu einem ziemlich abrupten Stillstand gebracht wurde. Ein nicht unwesentlicher Antrieb dieses neu erwachten wissenschaftlichen Interesses dürfte unter anderem die ansonsten seit Jahrzehnten stagnierende psychopharmakologische Forschung sein, welche seit Jahrzehnten kaum wirkliche therapeutische Innovationen hervorzubringen vermochte.
Zwei Therapieformen
Es lassen sich grundsätzlich zwei Behandlungsformen mit Einsatz psychedelischer Substanzen unterscheiden.1 Zunächst die psycholytische Therapie, welche in den 1960er-Jahren vor allem im damals noch massgeblich psychoanalytisch ausgerichteten Europa entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei um eine eigentlich psychoanalytische Therapie, in deren Rahmen einige der Sitzungen unter Psychedelika abgehalten werden. Die Substanzen werden hierbei in niedriger bis mittlerer Dosis verabreicht, der Patient vermag hierunter noch strukturiert mit den Therapeuten zu interagieren. Der Therapeut selber interveniert in ähnlicher Weise wie während einer klassischen psychoanalytischen Therapie.
Die derzeit im Rahmen der zweiten psychedelischen Welle vornehmlich zur Anwendung kommende Behandlungsform ist die psychedelische Therapie, welche sich in den 1960er- und 1970er-Jahren unter Einfluss der humanistischen Therapien hauptsächlich in Nordamerika entwickelt hat. Sie besteht in der Applikation höherer Dosen, anlässlich von 1 bis 3 Sitzungen, mit dem Ziel, sogenannte «Peak Experiences» auszulösen. Der Therapeut interveniert hierbei möglichst wenig während der Sitzung, das Erlebte wird erst in den darauffolgenden Tagen in Integrationssitzungen aufgearbeitet.
Unterschied zur klassischen Pharmakotherapie
Eine klassische Psychopharmakotherapie besteht in der wiederholten Applikation der Substanz, die typischerweise zu einer Aufsättigung und Stabilisierung der Rezeptorokkupation führt, welche ihrerseits mit einer gewissen, häufig wochenlangen Latenz der eigentlichen therapeutischen Response zugrunde liegt. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass neurobiologische Systeme progressiv in ihrer Funktion korrigiert werden («orthopädischer» Effekt).
Im Kontrast hierzu geht man bei der psychedelischen Therapie, in deren Rahmen isolierte Dosen mit relativ kurzen Rezeptorokkupationen vorgesehen sind, von einem disruptiven Effekt aus, indem unter Einwirkung des Psychedelikums ein Prozess ausgelöst wird, der in der Folge zum therapeutischen Erfolg führt.2,3 Unter Psychedelika soll es hierbei zu einem Kipp-Phänomen zwischen verschiedenen psychischen Ordnungen kommen, welche schliesslich den therapeutischen Erfolg bedingen. Disruptive Behandlungsansätze sind für die Psychiatrie nicht ganz neu (z.B. Elektrokrampfbehandlung), für die Psychopharmakologie allerdings eher ungewohnt.
Wirkmechanismen
Die die direkte pharmakologische Wirkung überdauernden Effekte lassen sich sowohl neurobiologisch als auch psychologisch deuten. Es wird davon ausgegangen, dass es unter Psychedelika zu neuen Einsichten kommen kann, welche auf neurobiologischer Ebene mit der Aktivierung und Stabilisierung neuer Schaltkreise korrelieren. Psychedelische Therapien öffnen in diesem Sinne therapeutische Fenster, sie erlauben die Revision von vormals rigiden Grundüberzeugungen.
Psilocybin und LSD wirken vornehmlich über die Aktivierung von 5HT2A-Rezeptoren, welche zahlreich auf den Pyramidenzellen der Schicht 5 zu finden sind, Zellen mit einer in erster Linie integrierenden, System-stabilisierenden Funktion. Diese Substanzen interferieren auf diese Weise mit der Aktivität des sogenannte «Default Mode Network» (DMN, Ruhestandsnetzwerk).4 Das DMN ist eine untereinander verschaltete Gruppe von Hirnregionen, welche mit introspektiven Funktionen, nach innen gerichteten Gedanken wie Selbstreflexion und Selbstkritik in Verbindung gebracht wurde. Unter dem Einfluss von Psychedelika weichen folglich gewisse neuronale Netzwerke von ihrer üblichen, eng begrenzten und vorhersehbaren Arbeitsweise ab, was zu einer globalen Zunahme der Konnektivität führt.2 Anders gesagt: Unter Psychedelika ist die Aktivität des DMN deutlich verringert, während die Konnektivität im übrigen Gehirn zunimmt. Das Resultat kann eine neuronale «Neuverkabelung» sein, welche sich wiederum auf psychologischer Ebene in neuen Einblicken und Überzeugungen manifestieren kann.
Die 5HT2A-Aktivierung spielt eine wesentliche Rolle für die Neuroplastizität und die Neuorganisation neuronaler Netzwerke. So weisen Resultate präklinischer Studien auch in Bezug auf die längerfristige Wirkung von Psychedelika auf eine Erhöhung der neuronalen Plastizität hin.4
Eine wesentliche Wirkung von Psychedelika ist die Bewusstseinserweiterung. Hierunter wird die Erweiterung des Erfahrungsbereiches der Person verstanden, welche sich unter anderem in der Überwindung der Zeit- und Ichbezogenheit, dem Verwischen von Ich und Objekt (Ich-Auflösung), dem Gefühl des Eins-Sein mit der Welt (dem sogenannten Ozeanischen Gefühl) manifestieren kann. Einzelne Sinne können dabei verstärkt werden (z.B. Hör- oder Farberlebnisse). Andererseits scheinen Einsicht und emotionale Intensität während der psychedelischen Sitzung signifikante Prädiktoren der therapeutischen Wirkung zu sein.
Psychedelische Substanzen finden zunehmend Platz unter den wissenschaftlich fundierten therapeutischen Optionen
Indikationen
Das Forschungsfeld um den therapeutischen Gebrauch psychedelischer Substanzen ist derzeit weit gestreut und weiterhin im Wachsen begriffen. Derzeit liegen bereits zuverlässige positive Daten vor, welche einen Einsatz im Rahmen von Depressionen, mit lebensbedrohlichen Diagnosen einhergehenden Angstzuständen sowie Alkohol- und Nikotinkonsumstörungen stützen.2 Interessant ist hierbei, dass es sich vornehmlich um sogenannte internalisierende Störungen handelt, welche durch besonders rigide Denk- und Verhaltensschemata charakterisiert sind und wahrscheinlich deshalb besonders auf die Disruption und eventuelle Neuausrichtung zerebraler Schaltkreise unter Psychedelika ansprechen. Das Interesse an diesen Substanzen wird schliesslich auch durch den Entscheid der Amerikanischen Food and Drug Administration Ende 2019 unterstrichen, dem Einsatz von Psilocybin den Status einer «innovativen Behandlung» zu verleihen, um die Forschung zu beschleunigen und die Substanz möglicherweise gegen schwere Depressionen zuzulassen.
Herausforderungen
Der rituelle Gebrauch psychedelischer Substanzen lässt sich bis in die Frühgeschichte der Menschheit zurückverfolgen. So wurden verschiedene Aspekte des Settings oft aus der Tradition der rituellen/religiösen Anwendungen abgeleitet und so in die Behandlungsempfehlungen aufgenommen, aber bislang kaum wissenschaftlich untersucht. Die unkritische Übernahme von Praktiken birgt jedoch in sich die Gefahr einer Esoterisierung und der Verwischung zwischen einer wissenschaftlich fundierten therapeutischen Anwendung von Psychedelika und der Psychonautik, zweier Anwendungsgebiete, welche sich grundsätzlich unterschiedlicher Argumente und unterschiedlicher Logiken bedienen: evidenzbasierte Argumente vs. Konsumentenrechte, hauptsächlich wissenschaftlich vs. hauptsächlich politisch.
Eine wesentliche weitere Frage, nicht zuletzt aus ökonomischer Sicht, ist diejenige nach den Wirkanteilen pharmakologischer und psychotherapeutischer Faktoren. Bedarf es des psychotherapeutischen Anteils einerseits und bedarf es der psychedelischen Wirkung andererseits? Antworten auf diese Fragen dürften erstens aus künftigen Studien kommen, welche sogenannte Micro-Dosen anwenden (ca. 1/10 der psychedelischen Dosis), welche vom Patienten nicht als psychedelisch wahrgenommen werden, und zweitens aus Studien unter Narkose, bei denen grössere Dosen verabreicht werden könnten, ohne dass der Patient sich der eigentlichen psychedelischen Wirkung bewusst würde. Solche Studien bedürfen heute allerdings noch einer gründlichen ethischen Abklärung.
Literatur:
1 Garcia-Romeu A, Richards WA. Current perspectives on psychedelic therapy: use of serotonergic hallucinogens in clinical interventions. Int Rev Psychiatry 2018; 30: 291-316 2 Nutt D, Erritzoe D, Carhart-Harris R: Psychedelic Psychiatry’s Brave New World. Cell 2020; 181: 24-8 3 Carhart-Harris RL, Muthukumaraswamy S, Roseman L et al.: Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016; 113: 4853-8 4 Nichols DE: Psychedelics. Pharmacol Rev 2016; 68: 264-355
Das könnte Sie auch interessieren:
Das «Feeling Safe»-Programm und eine neue postgraduale Fortbildungsmöglichkeit in der Schweiz
Evidenzbasierte Psychotherapie für Menschen mit Psychosen ist sehr wirksam. Sie gilt heute wie auch die Pharmakotherapie als zentraler Bestandteil einer modernen, Recovery-orientierten ...
Psychedelika in der Psychiatrie
Stellen Sie sich vor, Ihr Gehirn ist wie eine verschlungene Landkarte, auf der die immer gleichen Wege gefahren werden. Diese Strassen sind Ihre Denkmuster, Gefühle und Erinnerungen. ...
Klinische Interventionsstudie bei ME/CFS
An der Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik des Universitätsspitals Zürich wird eine Sprechstunde für chronische Fatigue angeboten. Seit 2023 wird hier in Zusammenarbeit mit ...